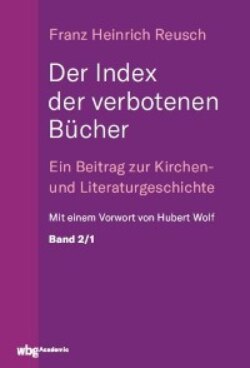Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.2/1 - Franz Reusch - Страница 36
28. Philosophische, naturwissenschaftliche und medicinische Schriften.
ОглавлениеDie philosophische Literatur des 17. Jahrhunderts ist, abgesehen von Descartes und anderen, von denen später zu handeln ist, im Index vertreten durch Montaigne, Charron, Fludd, Bacon von Verulam, Herbert von Cherbury, Hobbes, — von dem, reiflich erst 1709, — sämmtliche Werke verboten wurden, und einige weniger bedeutende Namen. Von Julius Caesar Vanini, der 1619 zu Toulouse, von dem Parlamente als Verbreiter des Atheismus verurtheilt, verbrannt wurde und der im spanischen Index als impiissimus atheus in der 1. Classe steht, — von Hobbes steht im spanischen Index nichts, — wurde in Rom 1623 nur ein Buch mit d. c. verboten und dieses d. c. erst unter Benedict XIV. gestrichen. — Die Naturwissenschaften sind, abgesehen von Galilei (§ 48) in dem Index Alexanders VII. nur durch einige Chemiker oder Alchymisten und durch eine Anzahl Medicinen vertreten. Von diesen sind einige durch die um 1600 viel erörterte „magnetische Heilung der Wunden“ in den Index gekommen, — J. B. van Helmont, der dadurch in Belgien in eine mehrjährige Untersuchung verwickelt wurde, ist nicht darunter, — Lionardo di Capua durch seine scharfe Kritik der scholastischen Philosophie, andere aus unbekannten, wahrscheinlich gar nicht mit der Medicin zusammenhangenden Gründen, wegen gelegentlicher anstössiger Aeusserungen.
Petrus Ramus (de la Ramée, geb. 1515, ermordet in der Bartholomaeusnacht 1572) und einige Anhänger seiner Philosophie, wie Thomas Freigius und Frid. Beurhusius, stehen schon bei Clem. in der 1. Cl., nicht als ob man die Ramistische Philosophie geprüft und verwerflich gefunden, sondern weil man die Namen bei Frisius fand. Die Pariser Universität hatte allerdings schon 1543 ein königliches Verbot von antiaristotelischen Schriften von Ramus erwirkt1). In den ersten Decennien des 17. Jahrh. kamen mehrere Ramisten und Semiramisten in den Index, aber meist mit nicht eigentlich philosophischen Schriften, wie Libavius, Goclenius, Alstedius. Schon 1603 wurde aber auch ein Buch verb., welches sich auf dem Titelblatt als der Schule angehörend bezeichnet, die eine Vereinbarung der Ramistischen und der Melanchton’schen Logik anstrebte: Syntagma Philippo-Rameum artium liberalium methodo brevi ac perspicua concinnatum per Jo. Bipsterium (erst Ben. hat Bilstenium) Marsbergianum in gratiam tyronum etc., Basel 1598. Daneben sind ein paar Compendien der Logik zu nennen: Jo. Schollii Praxis logica, verb. 1619, und Barth. Keckermann Gymnasium logicum, verb. 1605; von Keckermanns theologischen Schriften steht keine im Index. — Von dem Semiramisten Rodolphus Goclenius (Goeckel aus Corbach, Prof. in Marburg, 1547— 1628; A. D. B. 9, 308) wurden verb. Physicae completae speculum, 1604, verb. 1613; Partitionum dialecticarum 11. 2, 1595—1598, und Controversiae logicae, 1604, verb. 1623; Lexicon philosophicum, 1613 u. s., verb. 1633. Der Tractatus de magnetica vulnerum curatione (s.u.), der im Index mitten unter seinen Schriften steht, ist von seinem gleichnamigen Sohne (1572 —1621). — Nic. Taurellus (1547— 1606) steht im span., aber nicht im Römischen Index. Von Daniel Sennert, 1572—1637, Prof. der Medicin in Wittenberg, sind nur die Physica hypomnemata, 1635, 1642 verb., und zwar nur mit d. c. Noch Benedict XIV. citirt seine Epitome physicae oft in dem Buche De beatif. Honoratus Fabri polemisirt u.a. gegen seine Ansicht, die Seele sei nicht von Natur, sondern durch den Willen Gottes unsterblich (Bayle s. v., Nic. 14, 140). Im span. Index von 1747 werden seine Opera medica expurgirt. Mir unbekannte, wahrscheinlich unbedeutende Sachen stehen unter Bouzaens (vor Ben. Rauzeus), Mangetus, Rudigerus (Ruediger), Ulmius, Witekindus. Eine Reihe von Schriften steht im Index von dem Mediciner Jo. Jonstonus Polonus (geb. 1603 zu Samter in Polen, aus einer schottischen Familie stammend, † 1675 in Schlesien): Naturae constantia; Thaumatographia naturalis; Historia universalis civilis et ecclesiastica [ab orbe condito usque ad a. 1633, später fortgesetzt bis 1672]; De festis Hebraeorum et Graecorum cum lectionum philos. miscellis, (abgedr. bei Gronovius, Thes. VII.), verb. 1662; Polymathiae philologicae s. totius rerum universitatis ad suos ordines revocatae adumbratio, 1667, verb. 1690. Im span. Index steht er in der 1. Cl. (Mich. a S. JoS. 3, 83).
Von Jo. Blancus (Bianchi aus Nizza, Dr. med.) wurde 1640 verboten Divina sapientia arte constructa ad cognitionem et amorem Dei acquirendum, 1642: Sapientiae examen, in quo eruditissimi viri peripateticae et communis doctrinae apologi dubia proponuntur et a Jo. Blanco solvuntur, Lugd. 1640, 8, letzteres Buch nach Mazzuch. 2, 1136, weil der Verfasser sich nicht nur von der Lehre des Aristoteles und den gewöhnlichen Ansichten der Philosophen, sondern auch von der bei den Theologen üblichen Ausdrucksweise entfernt und neue Ansichten vorträgt.
Jacob Boehme steht nicht im Röm. Index (im span. als Jacobus Bohmen, Germanus, Lutheranus, in der 1. Cl.), aber seit 1633: Ψυχολογία vera J. B. T. [d. i. Jacobi Boehmii Teutonici] 40 quaestionibus explicata a Jo. Angelio Werdenhagen, Amst. 1632, 620 S. 12., Böhme’s Antwort auf 40 Fragen des Mediciners Balth. Walther (Baumg. 8, 404). Von Werdenhagen, Prof. in Helmstädt (1581—1652), wurde 1636 noch verb. Universalis introductio in omnes res publicas s. Politica generalis, 1632 (Moll, Cimbria 2, 966).
1676 wurden verb. Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne, mit dem Zusatze: wo immer und in welcher Sprache auch immer gedruckt. Die beiden ersten Bücher waren schon 1580, das ganze Werk 1588 u. o. gedruckt, zu Venedig 1633 auch eine italien. Uebersetzung. Dagegen wurde schon 1605 das Werk eines mit Montaigne befreundeten und eine ähnliche philosophische Richtung verfolgenden katholischen Geistlichen verb.: Liber gallico idiomate conscriptus cui titulus est: De sapientia 11. 3 auct. Petro Charron J. V. D. Paris 1604. Erst seit Ben. steht der französische Titel im Index: De la sagesse, trois livres. Die erste Ausgabe: Traité de la sagesse war schon 1601 erschienen, Der vor dem Tode Charrons 1603 begonnene Druck der 2. Ausgabe wurde 31. Dec. 1603 von der Pariser Universität inhibirt, bis das Buch revidirt und approbirt sei (Jourdain, Hist. P. just. 19). In der 1605 verbotenen Ausgabe von 1604 ist also manches geändert. In der Ausgabe von 1607 sind die weggelassenen Stellen beigefügt (Bayle s. v.; noch 1830 ist eine deutsche Uebersetzung des Buches von Willemer erschienen).
Von Franz Bacon von Verulam (1561—1626) wurde De dignitate et augmentis scientiarum, 1605 englisch, 1624 vollständiger lateinisch, mit d. c. verb., und zwar erst 1669. Bei Sot. stehen Franc. Baconus und Franc. Verulam als zwei Autoren in der 1. Cl.; von ersterm wird De sapientia veterum, 1617, freigegeben, von Ietzterm Instauratio magna, 1620, expurgirt, in dem Index von 1707 auch die Opera omnia, 1665 (1 Spalte). Erst in dem Index von 1790 steht Fr. Baco Baro de Verulamio. — Von den vielen Schriften von Robert Fludd, † 1637, steht nur eine im Index: Utriusque cosmi, majoris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia. Authore Roberto Fludd alias de Fluctibus, Armigero et in Medicina Doctore Oxoniensi … 1617—23, 3 Tomi Fol. (Clement 8, 377). Bei Sot. steht er in der 1. Cl. und wird potissimum die Medicina catholica verb. —Von Edward Herbert, Lord Cherbury, † 1648, wurde 1634 verb.: De veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimilitudine, a possibili et a falso, Par. 1624, 4., u. o. Sein Buch De religione gentilium errorumque apud eos causis, von dem die erste unvollständige Ausgabe zu London 1645, vollständige Ausgaben zu Amsterdam 1663 (von Isaac Vossius besorgt) und 1700 erschienen waren (Clement 9, 422), wurde erst 1709 verb. (in dem Decrete wird die Ausg. Amst. 1663 angegeben), in demselben Decrete: Jo. Musaei, S. Th. Dr. et Prof., Dissertatio de aeterno electionis decreto, an ejus aliqua extra Deum causa impulsiva detur necne etc. Accessit de luminis naturae, insufficientia ad salutem dissert. contra Eduardum Herbert Decher-Puris Baronem Anglum, Jenae 1668. Erst Ben. hat Decher-Puris in de Cherbury geändert, führt aber die zwei Dissertationen als besondere Schriften auf. (De rel. gent. p. 312 erklärt Herbert, er unterwerfe censuram hane censurae et judicio catholicae et orthodoxae Ecclesiae). — In diesem Decrete von 1709 werden auch sämmtliche Werke von Thomas Hobbes (1588—1679) verb. Vorher war von ihm nur verb., und zwar erst 1703: Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis … una cum appendice, 1668 (die englische Ausgabe war schon 1651 erschienen), und gleichzeitig vita Thomae Hobbes Angli Malmesburiensis philosophi, Carolopoli (London) 1681 (von dem Mediciner Rich. Blackburn; Bayle, Oeuvres 4, 841). Viel prompter als die Schriften von Hobbes wurde ein harmloseres Buch auf den Index gesetzt: Religio medici. So in dem Decrete vom 18. Dec. 1646 und im Index noch jetzt, obschon der Verfasser, der Mediciner Sir Thomas Browne (1605—82), der diese religiösen Betrachtungen und Grübeleien zunächst für sich selbst aufgezeichnet hatte, in den späteren Ausgaben des Buches in der Vorrede genannt wird. Das Buch erschien 1642 englisch, eine lateinische Uebersetzung von John Merryweather zu Leyden 1644. In Paris galt Browne, dessen Buch viel gelesen, in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach nachgebildet wurde, — Religio laici, jurisconsulti, medici catholici u. dgl.2) — als katholisch gesinnt, in Deutschland als Atheist; in Rom erschien eine Gegenschrift Medicus medicatus.
Das Buch von Julius Caesar Vanini, welches 1623 mit d. c. verb. wurde, De admirandis Naturae, reginae deaeque mortalium, arcanis ll. 4, Lutetiae 1616, 8., war mit königlichem Privileg und mit einer vom 20. Mai 1616 datirten Approbation von zwei Doctoren der Sorbonne, Edm. Corradin, Ord. Min., und Claudius Le Petit, erschienen, in welcher erklärt wird, es enthalte nichts der katholischen, apostolischen und römischen Religion Widersprechendes und sei sehr scharfsinnig und des Druckes durchaus würdig. Auch sein Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum, christiano-physicum necnon astrologico-catholicum adv. veteres philosophos Atheos, Epicureos, Peripateticos et Stoicos, Lugd. 1615, 8., war mit geistlicher und weltlicher Approbation erschienen. Der erzbischöfliche Censor de Ville bezeugt, das Buch enthalte nichts von dem katholischen und römischen Glauben Abweichendes, aber viele scharfsinnige und kräftige Argumente gemäss der gesunden Lehre der bedeutendsten Magister der h. Theologie. In der Vorrede unterwirft Vanini alles der Censur der Römischen Kirche3). Dieses Buch steht nicht im Röm. Index.
Von Andreas Libavius, einem der Begründer der wissenschaftlichen Chemie, † 1616, stehen im Index: Defensio et declaratio perspicua alchimiae transmutatoriae … 1604, verb. 1605 (der Titel scheint aus den Nund. von 1605 abgeschrieben zu sein), und Appendix necessaria syntagmatis arcanorum chimicorum, verb. 1618 (das 1615 erschienene Syntagma selbst ist nicht verb.). Bei Sot. werden mehrere andere Werke expurgirt. — 1624 wurde verb. Symbola aureae mensae; erst Ben. hat Mich. Maierus, Symb. aureae mensae duodecim nationum … 1617; von demselben Maier († 1622) wurde 1628 noch verb. Verum inventum, h. e. munera Germaniae ab ipsa primitus reperta et reliquo orbi communicata, 1619 (diese munera sind: das deutsche Kaiserthum, die Erfindung des Schiesspulvers und der Buchdruckerkunst, Luthers Reformation, die Reform der Medicin durch Theophrastus Paracelsus und die Fraternitas roseae crucis; Moll, Cimbria 1, 376). — Theatrum chemicum, praecipuos selectorum authorum tractatus de chemiae et lapidis philosophici antiquitate, praestantia et operationibus continens, Argent., Laz. Zetzner, 1659, 6 vol., wurde erst 1709 verb. Bei Sot. wird die Ausgabe Ursellis 1602 in 3 Bänden expurgirt.
Die magnetische Heilung der Wunden spielt in der medicinischen Literatur um 1600 eine grosse Rolle. Bei Sot. wird ein Tractat von Andreas Libavius De impostoria vulnerum per unguentum armarium sanatione vom J. 1594 expurgirt. Der jüngere Rudolph Goclenius veröffentlichte 1608 zu Marburg Oratio qua defenditur, vulnus non applicato etiam remedio citra ullum dolorem curari naturaliter posse, si instrumentum vel telum, quod sauciavit seu quo vulnus est inflictum, peculiari unguento inunctum obligatur, dann 1609: Tractatus de magnetica vulnerum curatione citra ullum dolorem et remedii applicationem et superstitionem, verb. 1621. Gegen diesen Tractat schrieb der Jesuit Jo. Roberti Anatome magici libelli R. Goclenii etc., 1615, und es folgten nun noch mehrere Streitschriften von beiden Seiten bis zum Tode des Goclenius 1621 (Strieder 4, 495. Backer I, 635). Nun trat Joh. Bapt. van Helmont (1577—1644) für Goclenius ein. Die für seine Schrift schon ertheilte Druckerlaubniss der geistlichen CensurbehÖrde wurde auf Betreiben der Jesuiten zurückgenommen, die Schrift aber ohne Helmonts Vorwissen in Paris 1621 gedruckt: De magnetica vulnerum naturali et legitima curatione contra Jo. Roberti S. J. Dieser antwortete in Curationis magneticae et unguenti armarii magica impostura clare demonstrata etc., 1621. Die spanische Inquisition verbot Helmonts Schrift 1626, nachdem vier Examinatoren 27 Sätze daraus censurirt und erklärt hatten: ipse auctor tam videtur haereticus quam impudenter audax; gleichzeitig wurden verb. J. B. Helmontii medici et philos. per ignem propositiones notatu dignae depromptae ex ejus disputatione de magn…. Parisiis edita, Col. 1624, 16 S. 8. Im J. 1627 wurde dann von dem Official des Erzbischofs von Mecheln gegen Helmont ein Process eingeleitet. Die theologische Facultät zu Löwen gab ein (auch von Cornelius Jansenius unterzeichnetes) Gutachten ab, worin seine Ansichten als ketzerisch und zur diabolischen Magie gehörend bezeichnet wurden. Auch die theologische Facultät zu Douay und die medicinischen Facultäten beider Universitäten censurirten 27 Sätze von Helmont (die oben erwähnten Propositiones wurden nochmals gedruckt mit Censurae celeberrimorum tota Europa theologorum et medicorum ex autographis optima fide descriptae, Leodii 1634, 20 S. 4). Helmont wurde 1634 für kurze Zeit verhaftet; es wurde beantragt, ihn zu verbannen und sein Buch öffentlich zu verbrennen; man nahm aber von einer Bestrafung Abstand, da er selbst erklärte, er verdamme sein Buch, sofern es etwas Bedenkliches enthalte, und unterwerfe sich in allem der Censur der Kirche und der Oberen4). — Im Röm. Index steht Helmont, wie gesagt, nicht; aber 1659 wurde eine Disceptatio apologetica de sanguinis missione in vulneribus von Horatius Vaccherius verb. (1668 schrieb der Theatiner Girolamo Vitale Physico-theologica de magnetica vulnerum curatione; Nicodemo-Toppi 139). — Von dem Sohne J. B. van Helmonts, Franz Mercurius v. H. (1618—99), — er war um 1662 in seinen jüngeren Jahren einige Zeit im Gefängniss der Inquisition zu Rom5), — wurden nach seinem Tode zwei anonyme Schriften von der Inquisition verb., ein Compendium der cabbalistischen Theologie: Seder olam sive ordo saeculorum, historica enarratio doctrinae, s. l. 1693, 196 S. 12, verb. 1700, und eine Schrift über Seelenwanderung: De revolutione animarum humanarum: quanta sit istius doctrinae cum veritate christianae religionis conformitas. Problematum centuriae duae, lectori modesto modeste propositae et latinitate donatae juxta exemplar Anglicanum Londini a. 1684 impressum (144 S. 12., in den Opuscula philosophica, Amst. 1590. Clement 9, 369).
Von dem Neapolitanischen Mediciner Seb. Bartoli († 1676) wurde 1667 verb. Astronomiae microcosmicae systema novum cum annexo opusculo: In eversionem scholasticae medicinae exercitationum paradoxicarum decas, und 1669 eine neue Ausgabe dieses Anhangs: Artis medicae dogmatum communiter receptorum examen, 1666. — Genauer unterrichtet sind wir über das Verbot der Schriften eines andern Neapolitanischen Mediciners, Lionardo di Capoa. Er war, wie in dem Avviso vor dem 2. Bande der Discussioni von Grimaldi (s.u.) berichtet wird, zu einem Gutachten über die Reform des medicinischen Studiums aufgefordert worden und hatte in diesem gezeigt, dass für den Mediciner auch das Studium der Philosophie nöthig sei, das Studium der scholastischen Philosophie aber nicht genüge. Dadurch hatte er sich die Anhänger der letztern zu Feinden gemacht. Seit Ben. steht im Index unter seinem Namen nur Parere divisato in otto ragionamenti; aber aus den älteren Indices ist zu ersehen, dass es sich um ein Buch über Medicin handelt und dass die Inquisition es ist, die es 1693 verb. hat. Als Titel wird angegeben: Parere di Lionardo di Capoa divis. in otto rag., ne’ quali parimenti narrandosi l’origine e’l progresso della medicina chiaramente l’incertezza della medicina si fa manifesta. Lionardo hat aber zwei Schriften veröffentlicht, 1681 Parere sopra l’origine etc. und acht Jahre später (s. a.) Ragionamento oder Tre ragionamenti intorno alla incertezza de’medicamenti (der Titel, wie er im Decrete angegeben wird, gehört vielleicht zu einer neuen Ausgabe beider). Die scharfe Kritik der herkömmlichen Heilmethode erregte in Neapel grosses Aufsehen (es erschien auch eine Gegenschrift von Lavagna), und der berühmte Mediciner Redi schreibt, die medicinischen Pfuscher und ihr Anhang (il volgo e la plebe de’ mediconzoli) hätten Lust gehabt, den Entlarver ihres Schwindels (ciurmeria) zu steinigen (Valéry 1, 324. Tirab. 8, 325). Woher die Inquisition die Mission hatte, sich in die Sache einzumengen, ist schwer zu sagen. Sie verbot aber 1700 auch ein ähnliches Buch eines Engländers Gedeon Harvey, Ars curandi morbos exspectatione, item de vanitatibus, dolis et mendaciis medicorum, Amst. 1695, nach Haeser 2, 427 eine schon 1689 englisch erschienene „werthlose, gegen die China gerichtete Schrift von einem zanksüchtigen Vielschreiber, dem Leibarzt Karls II.“ —Von der Index-Congr. wurde 1717 eine Schrift eines angesehenen Anatomen verb.: Tractatus de natura substantiae energeticae … auth. Fr. Glissonio, Lond. 1672. Erklärlicher ist, dass ein halb medicinisches, halb exegetisches Buch des Dänen Thomas Bartholinus, Paralytici Novi Test. medico et philologico commentario illustrati, verb. wurde (zuerst 1653 gedruckt, verb. erst 1700; De morbis biblicis miscellanea medica, 1672, steht nicht im Index), obschon darin die wunderbare Heilung nicht bestritten wird und Benedict XIV. De beatif. l. 4, p. 1, c. 12 u. s. das Buch citirt.
Auch Lettera del Dr. Bart. Corte Milanese, nella quale si discorre, da qual tempo probabilmente s’infonda nel feto l’anima ragionevole, von der Inq. verb. 1704, behandelt eine Frage, die auch von den Theologen erörtert wurde. — Martin Weinrich De ortu monstrorum commentarius, Lpz. 1595, wurde 1621 mit d. c. verb. Im Anfange des 17. Jahrh. wurden ausserdem noch Schriften verb. von den Medicinern Caspar Hofmann, Godfr. Smoll, Chr. Fr. Garmann und Henr. Petraeus (verschieden von dem bei Clem. in der 1. Cl. stehenden Henr. Petraeus Herdesianus).
Reusch, Indes II. 12
1) Werner, Thomas von Aquin 3, 506,
2) Weingarten, Revolutionskirchen S. 306.
3) Nachr. von der Stollischen Bibl. 2, 181. 206. Baumg. 4, 519.
4) G. Broeckx, Notice sur le manuscrit Causa J. B. Helmontii (im erzbischöfl. Archiv zu Mecheln) in den Annales de Vacad, l’archéol. de Belgique, t. 9 (1852), 277; t. 13 (1856), 306. Haeser, Gesch. der Medicin 2, 346.
5) Adelung, Gesch. der menschl. Narrheit 4, 298.