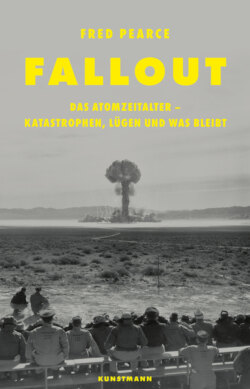Читать книгу Fallout - Fred Pearce - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 KRITISCHE MASSE: MAUD IM GARTEN DER ATOME
ОглавлениеVon allen moralischen Fragen einmal abgesehen, war die Entwicklung der beiden auf Japan abgeworfenen Atombomben eine wissenschaftliche Glanzleistung des 20. Jahrhunderts. Nach Hiroshima und Nagasaki wirkte die dampfgetriebene industrielle Revolution plötzlich reizend altmodisch. Doch das Atomzeitalter hatte ganz unvermittelt begonnen. Es war das Ergebnis einer wahren Flut neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse über den Aufbau der Atome und darüber, wie unbeständig diese vermeintlich soliden Bausteine der Materie in Wirklichkeit waren.
Begonnen hatte alles Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Entdeckung, dass die anscheinend so klar voneinander zu unterscheidenden Atome jedes Elements – Sauerstoff oder Uran, Kupfer oder Kohlenstoff – verschiedene Formen annehmen konnten: Isotope mit unterschiedlicher Anzahl Neutronen, die ihrerseits zu den Bausteinen der Atome zählen. Das Beunruhigende daran war die Instabilität vieler Isotope. Ein Isotop eines bestimmten Elements konnte sich in ein Isotop eines anderen verwandeln und dabei Energie freisetzen.
Als man verstand, dass sich manche Atome gezielt spalten ließen, indem man sie mit den Neutronen eines anderen radioaktiven Elements beschoss, wurde aus einer spannenden wissenschaftlichen Erkenntnis eine Entdeckung, mit der sich die Kriegsführung revolutionieren ließ. Als Erstem gelang eine solche Atomspaltung oder »Kernfission« 1917 dem neuseeländischen Physiker Ernest Rutherford. Doch erst 1933 äußerte der Ungar Leó Szilárd die Vermutung, man könne damit eine explosive Kettenreaktion auslösen, bei der jedes gespaltene Atom viele weitere Neutronen freisetze, die wiederum mit anderen Atomen kollidieren würden. Jede Stufe dieser nuklearen Kettenreaktion würde enorme Energiemengen erzeugen.
Am besten, so Szilárd, eigne sich für eine solche Kettenreaktion Uran, ein Metall, das aufgrund der Größe seines Atomkerns mit jedem Schritt die meisten Neutronen freisetze. Dazu müsse das Uran stark komprimiert vorliegen, damit bei der Spaltung möglichst viele frei gewordene Neutronen weitere Uranatome träfen. Und könne man eine »kritische Masse« Uran im Inneren einer Bombe zusammenführen, so würde sie mit einer Sprengkraft von Tausenden Tonnen TNT explodieren.
Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren die wenigen Atomwissenschaftler vom europäischen Festland nach Großbritannien und in die USA geflohen, wo sie an ihren Ideen weiterarbeiteten. Ende 1939 traf sich der inzwischen in Amerika lebende Szilárd mit Albert Einstein, dem damals berühmtesten Physiker weltweit. Gemeinsam schrieben sie Präsident Franklin Roosevelt und schlugen vor, dass Amerika, wenngleich neutral, eine solche Bombe entwickeln sollte – nicht zuletzt für den Fall, dass Deutschland dasselbe täte.1
Roosevelt schien anfangs wenig interessiert. In Großbritannien aber, das sich von einer deutschen Invasion bedroht sah, erhielten zwei weitere emigrierte Physiker eine ganz andere Resonanz. Wenige Wochen nachdem Szilárd von Roosevelt einen Dämpfer bekommen hatte, wandten sich der österreichische Physiker Otto Frisch und sein deutscher Kollege Rudolf Peierls in einem Brief mit derselben Idee an Winston Churchill. Er enthielt eine wichtige Ergänzung. Nach ihren Berechnungen war zur Herstellung einer Kernspaltungsbombe nur eine kritische Masse von 22 Pfund Uran nötig, viel weniger als die meisten Physiker erwartet hatten. Doch es gab eine Voraussetzung: Für die Bombe musste ein bestimmtes Uran-Isotop verwendet werden, Uran-235, das nur einen sehr geringen Anteil des natürlich vorkommenden Urans ausmacht.2 Unter dieser Voraussetzung jedoch versprachen sie Churchill eine Explosion, die »in einem großen Gebiet alles Leben zerstören würde […], wahrscheinlich das ganze Zentrum einer Großstadt«.
Das war im Sommer 1940. Die Luftschlacht um England war in vollem Gang. Täglich bombardierten die Deutschen London, und eine Invasion stand womöglich kurz bevor. Innerhalb weniger Tage ernannte Churchill eine geheime Kommission mit dem Namen MAUD Committee, die die Umsetzbarkeit des Vorschlags prüfen sollte – und wie schnell eine solche Bombe bereitgestellt werden konnte.3 Es war der Beginn eines politischen Prozesses, der auf der anderen Seite des Atlantiks das Manhattan-Projekt ins Leben rufen und nur fünf Jahre später zum verhängnisvollen Abwurf zweier Atombomben auf das bereits geschwächte Japan führen sollte.
Schon bald nahmen zwei weitere emigrierte Wissenschaftler mit der MAUD-Kommission Kontakt auf: der Österreicher Hans von Halban und der Russe Lew Kowarski. In ihrem gemeinsamen Labor in Cambridge hatten sie nach Möglichkeiten gesucht, aus der freigesetzten Energie nuklearer Kettenreaktionen nutzbare Elektrizität zu gewinnen. Anstelle einer unkontrollierten Explosion war es nach ihrer Überlegung auch möglich, die Kettenreaktion in einem von ihnen so bezeichneten Kernreaktor kontrolliert ablaufen zu lassen.4 Die dabei gewonnene Energie könne zu nicht-zerstörerischen Zwecken genutzt werden. Bei ihren Forschungen erkannten sie allerdings auch, dass bei der Spaltung von Uranatomen unter anderem das Element Plutonium entstand. Plutonium kam allem Anschein nach in der Natur nicht vor, doch ihre Berechnungen ergaben, dass eines seiner Isotope, Plutonium-239, sogar noch leichter spaltbar war als Uran-235. Für eine Bombe reichten daher womöglich noch kleinere Mengen aus. In Kriegszeiten interessierte sich natürlich niemand für die Möglichkeiten der Stromerzeugung durch Kernspaltung, aber die Idee einer Plutoniumbombe ließ die MAUD-Kommission aufhorchen.
Um die Bestandteile einer Atombombe herstellen zu können, hätte man entweder eine Quelle für Uranerz finden müssen, um daraus Uran-235 zu isolieren, oder Reaktoren bauen müssen, um Plutonium zu gewinnen. Beides waren gewaltige technische Vorhaben, die Großbritannien sich nicht leisten konnte. Nur die Amerikaner waren in der Lage, sie zu stemmen.
Kurz geriet das Projekt ins Stocken, doch dann traten die USA nach dem Angriff auf Pearl Harbour Ende 1941 in den Krieg ein. Churchill wies seine Wissenschaftler an, die führenden Köpfe der Atomforschung in den USA in die Ergebnisse der MAUD-Kommission einzuweihen. Wenige Wochen später gab Präsident Roosevelt grünes Licht für das Vorhaben, das heute als Manhattan-Projekt bekannt ist.5 Bald schon investierte Amerika Hunderte Millionen Dollar und ließ die Erkenntnisse europäischer Forschung in Bomben umsetzen, mit denen der Krieg gewonnen werden sollte.
Für den Fall, dass eine der Konstruktionen nicht funktionierte, entschied die US-Regierung vorsorglich, aufs Ganze zu gehen und sowohl eine Uran- als auch eine Plutoniumbombe bauen zu lassen. Unter strenger Geheimhaltung wurde Ende 1942 Uranerz aus der praktisch einzigen Quelle erworben, der Shinkolobwe-Mine tief im Süden von Belgisch-Kongo, und die Gewinnung von Uran-235 lief an.6 In der Zwischenzeit war in einem Reaktor in Chicago eine nukleare Kettenreaktion geglückt und Plutonium-239 gewonnen worden.
Mit ihrem Plutonium verband die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts eine eigenartige Hassliebe. Zwar konnte es Welten zerstören, doch es hatte auch verführerische Eigenschaften. Dank seiner Strahlung fühlte es sich »warm an, wie ein lebendiges Kaninchen«, sagte Leona Marshall Libby, eine der wenigen beteiligten Wissenschaftlerinnen.7 Andere berichteten von einem metallischen Geschmack.
Mitte 1943 war ein großes Halbwüstengebiet am Columbia River im US-Staat Washington requiriert worden, um dort das Isotop Plutonium-239 herzustellen, das so leicht spaltbar ist, dass man sich von wenigen Kilogramm eine Explosion mit der Sprengkraft von 20.000 Tonnen TNT versprach.
In einem gigantischen Unternehmen mit Tausenden Arbeitern wurden für die Anlage von Hanford neun riesige Atomreaktoren errichtet, in denen durch Neutronenbeschuss aus Uran kleine Mengen Plutonium gewonnen wurden. In einem chemischen Prozess, der sogenannten Wiederaufbereitung, wurde anschließend das entnommene »verbrauchte« Uran in Salpetersäure gelöst, um so das Plutonium für die Bomben zu extrahieren.
Das intellektuelle Zentrum des Manhattan-Projekts jedoch war das viel weiter südlich gelegene Los Alamos in der Wüste von New Mexico. Hunderte Wissenschaftler arbeiteten hier in einem ehemaligen Internat an den Plänen für die Bomben und versuchten, ihre Wirkung zu maximieren. Ihr Durchschnittsalter betrug fünfundzwanzig Jahre. Nahezu alle britischen Forscher, die an dem Bericht der MAUD-Kommission beteiligt gewesen waren, stießen hier zu der Gruppe junger US-amerikanischer Koryphäen um Robert Oppenheimer, so auch Peierls und Frisch sowie einer ihrer engen Mitarbeiter, der in Deutschland geborene Mathematiker Klaus Fuchs. Neben seiner täglichen Arbeit behielt Fuchs stets auch das Gesamtprojekt im Auge. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis und leitete, wie später ans Licht kommen sollte, alle Geheimnisse, von denen er Kenntnis bekam, an Igor Kurtschatow weiter, den leitenden Atomwissenschaftler Josef Stalins.8 Während er ein Jahrzehnt lang in britischen und amerikanischen Atomforschungseinrichtungen ein und aus ging, trug der zurückhaltende, aber umgängliche und aufgeschlossene Auswanderer eine Unmenge Informationen zusammen.
Bald wusste Kurtschatow, dass in Los Alamos sowohl eine Uranals auch eine Plutoniumbombe gebaut wurde. Quelle der Neutronen, die in beiden Bauprinzipien die Kettenreaktion in Gang setzen sollten, war ein eingebauter »Initiator« aus Polonium- und Beryllium-Isotopen. Davon abgesehen aber war der Aufbau völlig unterschiedlich. In der Uranbombe wurden zwei relativ kleine Uran-235-Pakete durch konventionellen Sprengstoff ineinandergeschossen, sodass die für eine Kettenreaktion nötige kritische Masse entstand. Im Fall der Plutoniumbombe entschieden sich Oppenheimer und seine Kollegen für die kompliziertere »Implosionsmethode«. Das Plutonium hatte die Form einer Kugel, etwa so groß wie ein Tennisball. Eine sie umgebende Sprengstoffhülle sollte zur Explosion gebracht werden, wodurch die Kugel komprimiert und so die kritische Masse erreicht würde. Es fiel in Fuchs’ Spezialgebiet, die physikalischen Voraussetzungen für diese Implosion zu berechnen und die ideale Konfiguration der Sprengstoffhülle festzulegen.
Die Uranbombe wurde vor dem Abwurf auf Hiroshima nie getestet. Da aber bei der Plutoniumbombe mehr schiefgehen konnte, fand im Juli 1945 in der Wüste bei Los Alamos eine Testzündung statt. Mit einem Vierfachen der erwarteten Sprengkraft erwies sich der Test als großer Erfolg. Nur drei Wochen später wurde auf Nagasaki eine identische Bombe abgeworfen. Wenige Tage darauf erklärte der japanische Kaiser Hirohito die Kapitulation. Die Aufgabe war erledigt. Ein gespenstisches Detail: Nach offiziellen Angaben arbeiteten im Rahmen des Manhattan-Projekts 175.000 Menschen – das entspricht fast genau der Zahl der Toten durch die beiden Bomben.
Viele Wissenschaftler des Manhattan-Projekts erschraken vor dem, was sie geschaffen hatten. Ihr Leiter, Robert Oppenheimer, sagte in den Worten der Hindugottheit Krishna: »Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.« Daneben herrschte große Verärgerung, vor allem über die Entscheidung des Militärs, die beiden japanischen Städte zu bombardieren. Szilárd, der Entwickler der Grundidee, hatte sich für eine Demonstration der mächtigen neuen Waffe an einem entlegenen Ort ausgesprochen. Er wurde jedoch von Politikern und Generälen überstimmt, die wissen wollten, was beim Abwurf auf eine echte Stadt passieren würde.9
Da das Vorhaben gelungen war, wussten die Wissenschaftler, dass andere es ihnen gleichtun konnten. Manche riefen öffentlich dazu auf, Atomwaffen internationaler Kontrolle zu unterwerfen, um ein atomares Wettrüsten zu verhindern. Auch von dieser Idee hielten die Generäle nicht viel. Der Gedanke, »Welten zerstören« zu können, gefiel ihnen besser. Eine Zeit lang hoffte Amerika, die Technologie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für sich behalten zu können. Daher wurden sogar die britischen Forschungspartner aus Kriegszeiten nach Hause geschickt – nicht ohne die absurde Anweisung, ihr erworbenes Wissen nicht anzuwenden, sollte sich Großbritannien selbst zum Bau einer Bombe entschließen.
An Fuchs jedoch dachte niemand. Über Jahre hatte er sich bewusst über die Arbeit jedes Einzelnen auf dem Laufenden gehalten. Sein Wissen teilte er mit seinen britischen Kollegen in Harwell, Oxfordshire, das sich schon bald zu einem britischen Los Alamos entwickelte, und leitete kontinuierlich wissenschaftliche Artikel und Konstruktionspläne an Kurtschatow weiter. Angespornt von dem Wissen, dass die Technologie ganz offensichtlich funktionierte, war die Sowjetunion schließlich in der Lage, ein eigenes Waffenprogramm ins Leben zu rufen. Bereits Ende 1948 lief in einem Nachbau der Anlage von Hanford – in der eilig hochgezogenen geschlossenen Atomstadt im Schatten des Urals, die heute Osjorsk heißt – die Plutoniumproduktion auf Hochtouren. Im August 1949 wurde die erste sowjetische Plutoniumbombe in der kasachischen Steppe getestet.
Ein Wettrüsten hatte begonnen. Während jedoch Russland, Großbritannien und später auch Frankreich und andere in aller Eile ihre eigenen Kernspaltungsbomben entwickelten, hatten die Beteiligten des Manhattan-Projekts weit explosivere Pläne – für einen Apparat, der anfangs »Super-Gadget« genannt wurde. Dahinter stand mit Edward Teller ein weiterer ungarischer Physiker sowie der polnische Mathematiker Stanisław Ulam. Physikalisch gesehen war das »Super-Gadget« fast das Gegenteil einer Kernspaltungs- oder Fissionsbombe. In Fissionsbomben werden schwere Elemente wie Uran oder Plutonium gespalten. Die neue Waffe aber war eine »Fusionsbombe«, in der Atomkerne der beiden leichten Wasserstoff-Isotope Deuterium und Tritium zur Fusion gezwungen werden sollten, daher der populäre Name »Wasserstoffbombe«. Wenn Tellers und Ulams Überlegungen stimmten, sollte sie ein Vielfaches der Energie einer Fissionsbombe freisetzen.
Um eine Fusionskettenreaktion in Gang zu setzen, bedurfte es jedoch einer Menge Energie – einer so großen Menge, wie sie nach Tellers und Ulams Berechnungen nur eine Fissionsbombe liefern konnte. Im Inneren einer Wasserstoffbombe befand sich also immer auch eine Kernspaltungsbombe. So schrecklich die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Kernwaffen auch gewesen waren, im Vergleich zu den neuen Wasserstoffbomben waren sie nichts. Entsprechend war die Wüste New Mexicos für ihre Sprengkraft und ihren Fallout nicht groß genug. Daher wurde die erste echte Wasserstoffbombe im März 1954 auf dem Bikini-Atoll gezündet, in einer entlegenen Region des Pazifischen Ozeans. Sie hatte die tausendfache Stärke der Bombe von Nagasaki. Für die Größe einer Wasserstoffbombe gab es offenbar keine Grenzen.
Bereits vor dem Abwurf der ersten Kernspaltungsbombe war in Los Alamos an der Konstruktion einer Wasserstoffbombe geforscht worden. Zu den Entwicklern in dieser frühen Phase zählte auch Fuchs. Im Mai 1946 reichte er ein Patent für den exakten Zündmechanismus einer Kernfusionsbombe ein, das bis heute der Geheimhaltung unterliegt. Wem diese Geheimhaltung nutzt, ist unklar, da wir heute wissen, dass alle Einzelheiten, kaum dass das Patent erteilt war, ohnehin durch Fuchs’ sowjetische Kontaktleute an Kurtschatow und den »Vater« der sowjetischen Wasserstoffbombe, Andrei Sacharow, weitergeleitet worden waren. Als in den 1990er-Jahren die Archive des sowjetischen Atomenergieministeriums geöffnet wurden, fand der britische Militärhistoriker Mike Rossiter Kopien von Mitschriften zur Wasserstoffbombe, die 1945 bei Vorträgen in Los Alamos entstanden waren, sowie Berichte über die Entwicklung aus den Jahren bis 1948.10
Bei seinem Marsch durch die britischen und amerikanischen Atomforschungseinrichtungen hatte das Genie Fuchs eine Unmenge Informationen zusammengetragen. Er spionierte für die Briten ebenso wie für die Sowjets. Das könnte erklären, warum seine britischen Vorgesetzten – trotz eines frühen Verdachts auf der anderen Seite des Atlantiks – ihm bis zum Eingeständnis seiner Verbindungen zur Sowjetunion 1950 freien Zugang zu allen Einrichtungen gewährten. Anschließend wurde er von den Briten wegen Spionage verurteilt, aber bereits nach neun Jahren wieder freigelassen.
Als Fuchs schließlich in ein Flugzeug mit Ziel DDR gesetzt wurde, waren die Atompilze der sowjetischen Wasserstoffbomben aus der Steppe Kasachstans bereits nicht mehr wegzudenken. Und als Sinnbild des jungen Atomzeitalters hatte sich der Atompilz längst im globalen Bewusstsein verankert.