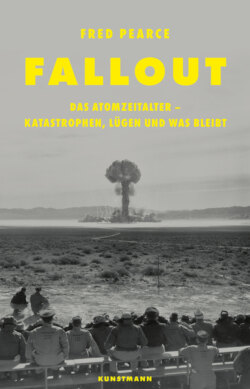Читать книгу Fallout - Fred Pearce - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6 DER PLUTONIUMBERG: GREIFEN SIE NUR ZU!
ОглавлениеAuf den meisten Testgeländen war es nach dem Moskauer Atomteststoppabkommen von 1963 vorbei mit oberirdischen Kernwaffentests. Doch wie in Nevada bedeutete das auch in Semipalatinsk nicht das Ende der Versuche an sich, sie gingen lediglich in den Untergrund. Sie wurden in einen Granitberg in einer entlegenen Ecke des sowjetischen Testareals verlegt, den Geografen unter dem Namen Degelen kennen und viele Mitglieder der Atomgemeinde den »Plutoniumberg« nennen. Er heißt so, weil man das spaltbare Metall, das das Herzstück der meisten Atomwaffen bildet, nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt fördern könnte, wenn man wollte. Das Plutonium ist allerdings nicht das Ergebnis geologischer Prozesse. Plutonium ist im Wesentlichen ein vom Menschen hergestelltes Element. Es existiert hier, weil sowjetische Atomingenieure fast drei Jahrzehnte lang, zwischen 1961 und 1989, in 181 in den Berg getriebenen Stollen Experimente durchführten.1
Viele davon waren gewöhnliche unterirdische Atomexplosionen, bei denen spaltbares Material verdampfte. Allerdings hatten die russischen Bombenbauer eine Vorliebe dafür, die Wirkung konventioneller Sprengstoffe auf Plutonium und dessen Verhalten in verschiedenen möglichen Kampfszenarien zu testen. Bei diesen Experimenten, häufig »Nebentests« genannt, verdampfte das Plutonium nicht und es wurde auch nicht zerstreut. Vielmehr blieben ganze Brocken davon in den Stollen zurück. Die Umweltfolgen sind daher alles andere als nebensächlich.
Derartige Experimente gab es nicht nur in der Sowjetunion. In der Anfangszeit gingen die USA in der Wüste von Nevada auf ganz ähnliche Weise vor. Die amerikanischen Forscher allerdings kamen bald zu dem Schluss, dass sie damit eine große Schweinerei anrichteten und dass dabei eine unvertretbare Menge Plutonium vernichtet würde. Daher gingen sie schon früh dazu über, derartige Experimente in kleinerem Maßstab und unter kontrollierten Bedingungen im Labor durchzuführen. Die sowjetischen Atomwissenschaftler und Waffeningenieure hatten solche Skrupel nicht. Fast drei Jahrzehnte lang war der Berg Degelen ihr Spielplatz. Als die Forscher 1991 nach dem Ende der Sowjetunion abzogen, ließen sie Hunderte Kilogramm waffenfähiges Plutonium in den Stollen zurück: eine wahre Fundgrube für jeden, der auf der Suche nach radioaktivem Material ist, um damit Unfug anzustellen.
Vorhang auf für Siegfried Hecker, einen der berühmtesten Atomwaffenforscher Amerikas und den früheren Direktor des National Laboratory in Los Alamos. Anfang der 1990er-Jahre – als Boris Jelzin im Kreml regierte und die ehemaligen Sowjetbehörden sich gegenüber technischen Beratern, Geldgebern und Wissenschaftlern aus den USA öffneten – wurde Hecker zur zentralen Figur eines Kraftakts der amerikanischen Nuklearinstitutionen, die sich vom sowjetischen Atomerbe ein Bild machen wollten.2
Hecker und die anderen Ermittler waren zum einen neugierig. Sie wollten herausfinden, was ihre Gegner während des fast fünfzig Jahre andauernden Kalten Krieges getrieben hatten. Außerdem wollten sie sicherstellen, dass es in Zukunft keine Unfälle mit der nuklearen Hardware der Sowjets gab. Vor allem aber wuchs ihre Sorge darüber, wer sich sonst noch für das spaltbare Material der Russen interessieren könnte. Sie wussten, dass Terroristen, Schurkenstaaten und einfache Kriminelle in den Weiten der früheren Sowjetunion auf eine wahre Wunderkammer strahlender Scheußlichkeiten stoßen könnten. Womöglich würden die Übeltäter außerdem bereitwillige Unterstützung von den Kadern der staatlichen Wissenschaftler und Techniker erhalten, die während der frühen Neunzigerjahre oft noch nicht einmal ihr Gehalt bekamen.
Durch den Zusammenbruch der Sicherheitssysteme im gesamten sowjetischen Netzwerk von Laboren, Testgeländen, Armeegerätelagern und Kraftwerken »war die Lage im russischen Nuklearkomplex der 1990er-Jahre so gefährlich wie nie zuvor in der Geschichte der Atomenergie«, schreibt Hecker in seinem Buch Doomed to Cooperate. Das Risiko eines Atomkriegs zwischen den Supermächten mochte zwar geringer geworden sein, »aber die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen irgendwo auf der Welt hatte zugenommen, weil es möglich wurde, Nuklearwaffen oder nukleares Material zu stehlen oder zur Seite zu schaffen«.3
1995 brachte seine Reise durch das unbekannte Sowjetsystem Hecker nach Kurtschatow, der eigens zum Unterhalt des Testgeländes errichteten Stadt, benannt nach dem Atompionier Igor Kurtschatow. Früher war sie fast ein zweites Las Vegas gewesen, nur ohne die Hotels. Mitten im Nirgendwo der ostkasachischen Steppe hatte man sie aus dem Nichts hochgezogen, und zu ihrer Blütezeit wohnten hier 40.000 Einwohner auf dem höchsten Lebensstandard, den das Sowjetsystem zu bieten hatte.
Als Hecker dort eintraf, herrschten andere Zeiten. Anstelle eines lebendigen Orts, bewohnt von den militärisch-industriellen Eliten der Sowjetunion, fand er eine Art Geisterstadt vor, mehr wie Mercury denn wie Las Vegas. Ein paar Tausend Einwohner waren noch da, die meisten angestellt beim Nationalen Nuklearzentrum von Kasachstan, einer damals neuen Behörde, die sich noch in ihre Rolle einfinden musste. Doch die Stadtränder waren zum großen Teil verwaist, und der grandiose Kulturpalast stand verlassen da. Aus der Villa, die einst Lawrenti Beria bewohnt hatte, Leiter der Atomwaffenproduktion unter Stalin, war kurioserweise eine russisch-orthodoxe Kirche geworden.
»Es war nichts zu hören als eine Herde Pferde, die am Stadtrand frei durch die Straßen lief, und zahllose Raben«, schreibt Hecker. Auch in der Steppe weiter südlich, wo sich das Polygon erstreckt, herrschte Stille. Die Straßen und Türme, Büros und Abschussrampen, die für Hunderte Atomwaffentests erbaut worden waren, lagen verlassen da. Am meisten aber erschreckte ihn der Berg Degelen.
Er hatte gehört, er sei schlecht gesichert, und die Menschen aus der Gegend würden darin nach Altmetall graben, das zum Teil bereits im benachbarten China aufgetaucht sei. Das allein war schon schlimm genug. Jedes Stück Schrott war potenziell mit Plutoniumpartikeln kontaminiert. Womöglich war manch einer sogar auf der Suche nach Plutonium, das sich verkaufen ließe. Was ihn jedoch überraschte, war das Ausmaß der Aktivitäten. »Ich hatte Kerle mit Kamelen erwartet, die Kupferkabel aus dem Boden ziehen«, schrieb er 1998 in einem Bericht. Stattdessen sah er »meilenlange Gräben, die nur mithilfe schwerer Baumaschinen angelegt worden sein konnten«. Auf dem ganzen Gelände wurde in industriellem Ausmaß nach Metallen gegraben.4
Durch den Wegfall der Arbeitsplätze auf dem Testgelände blieb den Einheimischen wenig anderes übrig, als den nuklearen Müll nach allem zu durchforsten, was sich verkaufen ließ. Da sie die Stollen ja selbst angelegt hatten, wussten sie ganz genau, wo etwas vergraben lag. Sie hatten sogar ein Vorbild. Der letzte russische Bürgermeister der Stadt Kurtschatow war 1993 wegen Plünderungen gefeuert worden.
Solche Plünderungen waren in den 1990er-Jahren weit verbreitet. Die Täter hatten sich an den zurückgelassenen sowjetischen Bergbaumaschinen bedient und trugen Waffen. Es ist nicht bekannt, dass Plünderer Plutonium aus dem Berg entnommen oder in ernstem Maß Kontaminationen erlitten hätten, aber niemand kann mit Sicherheit sagen, was diese Leute in den Jahren der Gesetzlosigkeit haben verschwinden lassen. Hecker schätzt, in dem Berg könnten 200 Kilogramm Plutonium liegen. Angesichts der offenen Tore und der Abwesenheit von Wachpersonal hätte man das Material »leicht aufsammeln können, [es war] für jeden leicht zugänglich«.
Kaischa Atachanowa, die Biologin und Umweltschützerin, erzählte mir 2005, wie Dorfbewohner, die sie kannte, regelmäßig Halden aufgruben, in denen die abziehenden Russen militärische Ausrüstung vergraben hatten. Sie fanden Flugzeuge und Panzer, die man während der Atomtests im Freien hatte stehen lassen, um herauszufinden, welche Schäden sie davontragen würden. Während ihrer Forschungen an Wildtieren »haben wir diese Halden regelmäßig aufgesucht, und dabei habe ich beobachtet, dass sie immer kleiner wurden«. Die Stollen im Berg Degelen waren ein bevorzugtes Ziel der Plünderer. »Mit der Hilfe der Amerikaner wurden die Eingänge zu den Stollen, in denen unterirdische Tests stattgefunden hatten, versperrt, aber die Leute vor Ort öffneten sie wieder, um an den wertvollen Schrott zu kommen.«5
Über zehn Jahre lang kämpfte Hecker unter nahezu vollständiger Geheimhaltung gegen das Misstrauen und die Verschwiegenheit, bis das 150-Millionen-Dollar-Projekt, den Plutoniumberg abzusichern, vollendet war. Es war eine anstrengende und manchmal gefährliche Aufgabe.
Mit einem Picknick vor Ort wurde im Oktober 2012 das Ende der Sanierungsarbeiten gefeiert. Nun sei alles sicher, die Stollen seien zubetoniert und das Sicherheitspersonal tue seinen Dienst, versicherte Sergej Lukaschenko, der neue kasachische Verantwortliche für die Sicherheit des Bergs, den Anwesenden. Sogar amerikanische Militärdrohnen standen ihm zur Verfügung, um Eindringlinge aufspüren zu können. Es sei immer noch Plutonium im Berg, ein Zugang jedoch nun »unmöglich«, sagte Lukaschenko.6 Das ist beruhigend. Doch Plutonium hat eine Halbwertszeit von Tausenden Jahren. Wie lange wird es Wachpersonal und Drohnen geben? Wie lange wird der Beton halten? Wird das Wissen um die Schätze im Berg das Pflichtbewusstsein der Wächter überdauern?
Womöglich ist es schon bald so weit. Nur Monate nach dem feierlichen Picknick berichtete das Belfer Center der Universität Harvard, ein kasachisches Vermessungsteam habe fünf weitere Areale in der Umgebung des Bergs gefunden, wo bislang unbekannte Experimente mit Plutonium stattgefunden hätten. Es gebe dort so viel Plutonium in ausreichend hoher Konzentration, dass ein großes Risiko der Proliferation bestehe. Das Center zitiert Byron Ristvet von der Defense Threat Reduction Agency, einer Dienststelle des Pentagon, wonach »an manchen Stellen […] jemand mit einem Kleinlaster und einer Schaufel schon genug [für eine Bombe] zusammenbekommen würde«. Anscheinend hat der Plutoniumberg noch nicht alle seine Geheimnisse offenbart.7
In den westlichen Ländern diskutieren die Behörden mit Umweltschützern, wie Atommüll, der Plutoniumspuren enthält, während der langen Zerfallsdauer sicher gelagert werden kann. Wie tief unter der Erde muss er liegen? Unter welchen geologischen Voraussetzungen? Welche Risiken bergen Erdbeben, steigende Meeresspiegel und der Klimawandel? Im Plutoniumberg hingegen liegt das Metall – von dem bereits ein bisschen Abrieb tödlich ist und eine Handvoll für eine Bombe ausreicht – brockenweise und nahe der Oberfläche herum, mit einer maroden Betondecke als einzigem Schutz. Kein schöner Gedanke.
Auf den früheren britischen Testgeländen in Südaustralien ist die Lage vermutlich kaum besser. Dort habe man »viel Schindluder getrieben«, schrieb Ian Anderson, mein Melbourner Kollege vom New Scientist, 1993 in einem Exklusivbericht: »Wie neue Anhaltspunkte nahelegen, wusste Großbritannien schon in den 1960er-Jahren, dass die radioaktive Belastung seines ehemaligen Testgebiets in Australien höher war als zuerst angenommen. Doch Australien wurde nicht informiert.« Mit Sicherheit nicht informiert wurden auch die Maralinga Tjarutja, das Aborigine-Volk, auf dessen 3.300 Quadratkilometer großem Gebiet die Tests durchgeführt wurden. Gleiches gilt aber auch, wie sich jetzt herausgestellt hatte, für die Regierung in Canberra.8
Damals noch britisches Hoheitsgebiet, hatte Australien Großbritannien während des Kalten Krieges bereitwillig bei der Entwicklung eigener Nuklearwaffen unterstützt. Es gestattete den Briten zuerst, Atombomben auf den unbewohnten Montebello-Inseln vor der australischen Nordwestküste zu testen, dann auf dem Gelände Emu Field im entlegenen Bundesstaat South Australia, und schließlich, nach 1957, im benachbarten Maralinga. Die örtlichen Aborigines bemerkten schon bald den Fallout. Sie nannten ihn puyu, »schwarzer Nebel«. 1953 gerieten etwa fünfundvierzig Aborigines nach einem Emu-Test in eine puyu-Wolke. Manche erlitten Hautverbrennungen, doch offenbar hat sich kein Wissenschaftler je um die Pressemeldungen gekümmert, die von etwa fünfzig Todesopfern berichteten.9 Bis heute ist nicht bekannt, was mit den Menschen dort geschah.
Neben den Bombentests führten die Briten auch Experimente mit Plutonium durch, ähnlich denen der Sowjets im Berg Degelen. Sie fanden zwar in kleinerem Maßstab statt, dafür aber an der frischen Luft und nicht in Stollen wie bei den Sowjets oder im Labor wie bei den Amerikanern. Dabei schossen, wie Anderson es ausdrückt, »Fontänen aus geschmolzenem Plutonium« durch die Luft. Bis heute hat kaum jemand auch nur davon gehört. Gleichwohl waren sie Auslöser der meisten Probleme, die Anderson in seinem Scoop für den New Scientist herausstellt. Während sich nämlich der Fallout der Bomben über ein großes Gebiet ausbreitete, hinterließen diese »kleineren Tests« toxisches Restmaterial in potenziell tödlicher Dosis, häufig als Anhaftung an militärischer Ausrüstung, die nach dem Ende der Experimente zurückgelassen wurde. Nach den fünfzehn »kleineren Tests«, die zwischen 1961 und ’63 unter dem Namen »Vixen B« durchgeführt wurden, blieben in der Gegend um Maralinga rund 23 Kilogramm Plutonium zurück. Angeblich wurden anschließend Säuberungsarbeiten durchgeführt. Man deponierte kontaminierte Ausrüstung in einundzwanzig Gruben, die mit Beton verschlossen wurden. Die britischen Waffenentwickler in Aldermaston gaben an, 90 Prozent des Plutoniums sei auf diese Weise entsorgt worden.10
Als aber 1984 die Regierung in Canberra das dekontaminierte Land dem Volk der Tjarutja zurückgeben wollte, wurde bei einer letzten Überprüfung überall Plutonium gefunden, vor allem an kontaminierter Ausrüstung, die nicht in einer der Gruben entsorgt worden war. Peter Burns vom Australian Radiation Laboratory schätzte damals, es sei das bis zu Zehnfache der von den Briten angegebenen Plutoniummenge am Boden verblieben – insgesamt rund drei Millionen Bruchstücke: »Man könnte sie einfach aufheben.« Wie der nach Burns’ Entdeckung von Australiern, Amerikanern und Briten gegründete technische Beratungsausschuss festhielt, könne angesichts der Halbwertszeit von Plutonium ein Kind, das irgendwann in den kommenden Jahrtausenden in dem kontaminierten Staub spielt, womöglich mehr als 460 Millisievert pro Jahr mit der Atemluft aufnehmen.11
Die Erkenntnisse wurden mehrere Jahre geheim gehalten, während offenbar die australische Regierung die Briten dazu überredete, eine zweite Säuberung zu bezahlen.12 1993, nachdem der Deal vereinbart worden war, wurden sie Anderson zugespielt.
Die zweite Säuberung begann 1995. Hunderttausende Tonnen kontaminierter Boden wurden abgetragen und in Gräben deponiert. Berichten zufolge wurde das Plutonium in den Gruben zusätzlich verglast, also durch elektrischen Strom in hartes, glasartiges Gestein verwandelt und so gebunden. Nach den 100 Millionen Dollar teuren Maßnahmen war die potenzielle Dosis, der das Kind in einer hypothetischen Zukunft ausgesetzt wäre, auf unter fünf Millisievert pro Jahr gesunken, was nicht viel höher ist als die weltweit durchschnittliche Umgebungsstrahlung.13
2014 gab man schließlich im Rahmen einer Zeremonie in Maralinga die letzten 1.800 Quadratkilometer Testareal an die Tjarutja zurück. Und für uns alle gibt es jetzt Besichtigungstouren mit dem Minibus. Doch selbst die letzte Säuberungsaktion war begrenzt. Am Rand eines 116 Quadratkilometer großen Gebiets warnen heute Schilder, hier lägen »Artefakte aus der Ära der Kernwaffentests, darunter leicht radioaktiv kontaminierte Gegenstände«.14 Innerhalb dieses Bereichs würde ein Kind der Zukunft 65 Millisievert pro Jahr erhalten, kommentierte verärgert Alan Parkinson, der Vorsitzender des ersten technischen Beratungsausschusses gewesen war und die zweite Säuberung gefordert hatte. Der jetzige Status sei eine »billige und widerliche Lösung, die man für das Land von Weißen nie akzeptieren würde«. Ein Teil des verbliebenen Plutoniums hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Das sei, so Parkinson bissig, wahrscheinlich länger, als die schicken neuen Warnschilder halten werden.