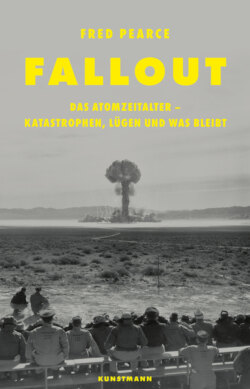Читать книгу Fallout - Fred Pearce - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 HIROSHIMA: EINE UNSICHTBARE NARBE
ОглавлениеAm Ground Zero in der Stadtmitte von Hiroshima, dort, wo die erste Atombombe der Welt explodiert war, die alle Gebäude hinweggefegt und einen Feuersturm ausgelöst hatte und Tausende Menschen verglühen ließ, hatte ich wohl eine größere Gedenkstätte erwartet. Doch der Ort der umfassendsten Zerstörung war nur durch eine kleine Gedenktafel auf einem parkuhrhohen Marmorsockel gekennzeichnet, den man auf den Gehweg einer Seitenstraße vor die nackte Mauer neben einer Waschanlage gequetscht hatte. Es war der Gedenktag, einundsiebzig Jahre nach der Detonation. Jemand hatte ein paar Blumen abgelegt. Von der anderen Straßenseite aus sah ich zu, wie eine amerikanische Familie einige Minuten stehen blieb und die Tafel las. Die Leute machten ein Selfie für die Daheimgebliebenen, doch alle anderen gingen vorbei, ohne überhaupt Notiz zu nehmen.
Offenbar möchte sich Hiroshima von seiner Vergangenheit bewusst ungerührt zeigen. Heute hat die Stadt mehr als eine Million Einwohner, viermal so viele wie an dem Tag, als die Bombe fiel. Das riesige Mazda-Werk am Stadtrand ist zum Symbol der wirtschaftlichen Erneuerung geworden, der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen rast auf seinem erhöhten Schienenstrang vorbei, die Einkaufszentren sind voll von amerikanischen Markenprodukten. Die Straßenbahnen fahren noch immer auf denselben Strecken wie 1945 – ein gespenstisches Andenken an die Vergangenheit. Doch nur fünf Gebäude im gesamten Stadtzentrum von Hiroshima haben die Detonation überstanden. Sie sind bis heute erhalten. Eines davon, die alte Halle zur Förderung der Industrie mit ihrer Stahlskelettkuppel, steht am Flussufer. Sie ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und gleichzeitig das bekannteste Symbol der Ereignisse. Hier versammeln sich die Touristen. Eine junge Frau bat mich, ein Foto von ihr zu machen, und reckte den Daumen in die Höhe, im Arm ein Kuscheltier.
Einem der anderen Gebäude, der ehemaligen örtlichen Zentrale der Bank von Japan, stattete ich einen spontanen Besuch ab. Der massige Steinbau mit seiner klassischen Fassade steht nur vierhundert Meter vom Ground Zero entfernt. Heute werden dort Kunstausstellungen gezeigt. Eine kleine Tafel erinnert daran, dass das Gebäude nicht zerstört wurde. Wie sie sachlich bemerkt, wurde »der Bankbetrieb zwei Tage nach der Bombenexplosion in vermindertem Umfang wieder aufgenommen, und andere Finanzinstitute der Stadt verlegten ihre Büros vorübergehend in das Gebäude«. Das verschlug mir die Sprache. Als es noch überall brannte, Tausende Menschen auf der Straße an der Strahlenkrankheit starben und Leichen herumlagen, war das Geschäft rund ums Geld offenbar bereits wieder im Gange. Ich liebe Japan, aber seine Menschen sind mir sehr fremd.
Etwas Vergleichbares hatte die Welt noch nicht erlebt. Am 6. August 1945 um 8 Uhr 15 morgens flog ein amerikanischer B-29-Bomber die Südküste der japanischen Insel Honshu entlang. Er warf eine einzige Bombe ab, welche die Handvoll Menschen, die zu dem Flugzeug aufsahen und anschließend davon berichten konnten, als winzigen dunklen Fleck im strahlend blauen Himmel wahrnahmen. Die Bombe trug den Codenamen »Little Boy« und war gut drei Meter lang. Sie sollte die Welt verändern.1 Zuerst stürzte sie fünfundvierzig Sekunden auf Hiroshima zu. Dann, in etwa 600 Metern – der Höhe, in der sich gemäß den Berechnungen des britischen Mathematikers William Penney die größte Zerstörungskraft entfalten würde –, schoss ein Sprengstoff-Auslöser einen Zylinder mit 38 Kilogramm Uran-235 in einen zweiten Zylinder mit 25 Kilogramm des gleichen Materials hinein. Diese Kollision löste eine rasante nukleare Kettenreaktion aus, bei der die rasch gespaltenen Uranatome enorme Energiemengen freisetzten – das Äquivalent einer Explosion von 13.000 Tonnen TNT.
Dem Bomber folgten zwei weitere Flugzeuge, bestückt mit Kameras und anderer Ausrüstung, um den Fortgang der Verwüstung zu beobachten. Es muss ein erschütterndes Bild gewesen sein. Alles begann mit einem weißen Blitz, der so hell war, dass Menschen am Boden erblindeten. In Sekundenbruchteilen schoss durch die Hitze der Explosion ein fast vierhundert Meter großer Feuerball in Richtung Boden. Bei Temperaturen von rund 7.000 Grad Celsius schmolzen Dachziegel, und menschliches Fleisch verdampfte. Nach wenigen Sekunden blieb von vielen morgendlichen Pendlern nichts als ein Schatten an einer Mauer, wo ihr Körper die Hitzestrahlung abgefangen hatte. Auf den Feuerball folgten die Druckwellen der Explosion, die Gebäude zerstörten und Straßenbahnen umstürzten, und ein Stoß radioaktiver Strahlung, die innerhalb weniger Stunden zahllose Menschen tötete.
Brände breiteten sich aus. Innerhalb von zwanzig Minuten war ein Feuersturm von drei Kilometern Durchmesser entstanden, genährt von Gas aus geborstenen Leitungen. Staub und Rauch verhüllten die Stadt. Durch das Inferno ausgelöste Wirbelwinde entwurzelten Bäume im Stadtpark, wohin sich viele, die vor dem Feuer Schutz suchten, geflüchtet hatten. Es fiel schwarzer Regen: riesige, murmelgroße Tropfen aus radioaktivem Ruß, vermischt mit Wasser.2 Drei Tage lang brannte es. Der erste Strahlungsstoß der Bombe war rasch vorbei, doch Staub und Trümmer am Boden nahe dem Detonationsort strahlten noch wochenlang. Sie verursachten Verbrennungen bei den Menschen, die sie berührten – unter ihnen Rettungskräfte –, töteten die Fische im Fluss Ota und kontaminierten die Brunnen, aus denen die Menschen ihr Trinkwasser bezogen.
Damals lebten in Hiroshima rund eine Viertelmillion Menschen. Die meisten wohnten und arbeiteten im eng bebauten Zentrum, dem gezielt ausgewählten Ort der Zündung. Etwa 60.000 von ihnen starben am ersten Tag, darunter 90 Prozent derjenigen, die sich innerhalb eines 450 Meter weiten Radius um den Ground Zero aufgehalten hatten. Im Laufe der folgenden Wochen starben weitere 40.000. Die meisten Menschen wurden durch die Detonation getötet und durch die Feuer, die durch die Stadt fegten. Fast möchte man sagen, dass sie noch Glück hatten. Andere waren horrenden Strahlungsmengen ausgesetzt – mehr als 10.000 Millisievert, wie akribische amerikanische Forscher später schätzten – und starben innerhalb weniger Tage an inneren Blutungen, Verletzungen der Organe oder Schädigungen des Immunsystems, wofür die Medizin später die Bezeichnung »akute Strahlenkrankheit« prägen sollte.
Menschen, die durch geringere Strahlendosen belastet waren, starben über einen Zeitraum mehrerer Wochen oder Monate, häufig weil ihr verstrahlter Körper kein frisches Blut mehr herstellen konnte. Wer jedoch weniger als 4.000 Millisievert erhalten hatte, überlebte in der Regel, und diese Menschen erwartete ein überraschend mildes Schicksal. Die amerikanisch-japanische Forschungskommission Radiation Effects Research Foundation geht heute davon aus, dass jemand, der an diesem Tag einer Strahlung von 150 Millisievert oder mehr ausgesetzt war, ein erhöhtes Risiko hatte, an Leukämie oder anderen Krebsarten zu erkranken.3 Das betrifft die Mehrheit der Einwohner der Stadt. Allerdings wurden bis zum Jahr 2000 nur 573 Todesfälle mehr verzeichnet, als ohnehin statistisch wahrscheinlich waren, was nur einen zusätzlichen Prozentpunkt ausmacht.4 Ebenfalls im Gegensatz zu früheren Erwartungen der Wissenschaft – und im Widerspruch zu den andauernden Befürchtungen der breiten Öffentlichkeit – haben Forscher bei den folgenden Generationen bis heute keine Anzeichen genetischer Mutationen festgestellt. Wenn es für Hiroshima eine gute Nachricht gibt, dann ist es diese.
Die Bombe, die auf Hiroshima fiel, kam nicht nur für die Stadt aus heiterem Himmel, sondern im übertragenen Sinn auch für die ganze Welt. Eine Warnung gab es nicht. Einzelne Zeitungsartikel waren erschienen, in denen berühmte Physiker wie Albert Einstein zur Entwicklung von Nuklearwaffen aufriefen. Doch vor Hiroshima wussten nur wenige, dass solche Waffen bereits entwickelt, geschweige denn zum Abwurf auf eine Stadt vorbereitet wurden.
Dass selbst zu Kriegszeiten eine derart hohe Geheimhaltung fortbestehen konnte, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Fünf Jahre lang hatte die US-Regierung diese Waffen im Rahmen eines gigantischen Geheimunternehmens entwickelt. Drei Wochen zuvor hatte es einen einzigen, unangekündigten Bombentest in New Mexico gegeben. Doch an dem Tag, als Hiroshima getroffen wurde, wussten selbst gut informierte Reporter nur wenig. Die Zeitungsberichte des folgenden Tages mussten einen großen Informationsrückstand ausgleichen. Der Artikel im englischen Manchester Guardian begann mit den Worten: »Japan wurde von einer atomaren Bombe getroffen, die eine 2000-mal stärkere Sprengkraft hatte als die Zehntonner, die die Royal Air Force über Deutschland abwarf […]. Britische und amerikanische Forscher haben seit mehreren Jahren daran gearbeitet.«5
Die Gesamtzahl der rund 170.000 Toten von Hiroshima und Nagasaki, dem Ort des zweiten Atombombenabwurfs, sticht in den Annalen des Krieges nicht besonders heraus. Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs hatten bei dem belgischen Dorf Passchendaele durch ein fünf Monate andauerndes Bombardement mehr als eine halbe Million Soldaten ihr Leben verloren. In Hiroshima starben wahrscheinlich weniger Japaner als in Tokio Opfer von Feuerstürmen wurden, nachdem amerikanische Flugzeuge in zwei früheren Nächten des gleichen Jahres die Stadt unerbittlich bombardiert hatten. Erschütternder war vielmehr die Tatsache, dass ein einziges Flugzeug mit einer einzigen Bombe ausreichte, um eine ganze Stadt zu zerstören.
Noch größere Aufmerksamkeit bekam die neue Wirklichkeit des Krieges in den darauffolgenden Jahren durch die nach und nach veröffentlichten Geschichten der Überlebenden, der Hibakusha. Den meisten Außenstehenden wurden sie erst durch den 1946 veröffentlichten Buchklassiker des amerikanischen Journalisten John Hersey mit dem schlichten Titel Hiroshima zugänglich.6 Darin verfolgte Hersey das Schicksal von sechs Hibakusha. Seither haben viele andere öffentlich ihre Geschichte erzählt – damit, wie sie sagen, die Welt nicht vergisst. Während meines Besuchs anlässlich der Gedenkfeiern 2016 nahmen mehrere von ihnen an einem Treffen teil. Keine Statistik kann den Geschichten, die ich dort gehört habe, gerecht werden.
Etwa der von Keiko Ogura, einer kleinen, quirligen Frau von neunundsiebzig Jahren. Sie war erst acht und auf dem Weg zur Schule gewesen, als sie durch die Detonation das Bewusstsein verlor. Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, lief sie benommen durch die Straßen. Sie erinnerte sich, dass sie an Hunderten Toten und Sterbenden vorbeikam, deren verbrannte Haut sich vom Körper schälte. »Was mich am meisten verängstigte, waren die Leute, die mich am Fuß packten und sagten: ›Gib mir Wasser‹«, erzählte sie. »Von einem Brunnen bei einem Shinto-Schrein holte ich welches und gab es ihnen. Doch als sie es tranken, mussten sie sich übergeben und starben. Später hat mein Vater mir erzählt, Menschen mit Verbrennungen dürfe man kein Wasser geben. Noch Jahre danach hatte ich Albträume und machte mir Vorwürfe dafür, dass ich den Leuten Wasser gegeben hatte. Ich glaubte, ich hätte sie umgebracht. Bis mein Vater starb, habe ich niemandem davon erzählt. Es war eine unsichtbare Narbe.«
Kazuhiko Futagawa erzählte, dass er als ungeborenes Kind der Strahlung ausgesetzt war, weil seine Mutter über Tage die bombardierte Stadt durchstreifte. Sie suchte nach ihrem Mann, der im Hauptpostamt, nur zweihundert Meter vom Ground Zero entfernt, beschäftigt gewesen war, und nach ihrer dreizehnjährigen Tochter, die in fünfhundert Metern Entfernung Brandschneisen geschlagen hatte. Wie er berichtete, verloren Tausende Eltern aus den Vororten ihre Kinder, weil der Stadtrat von Hiroshima an diesem Tag die Jugendlichen ins Zentrum hatte bringen lassen, um dort Gebäude abzureißen und so das Risiko eines Feuersturms bei Bombenangriffen zu reduzieren.
Nach dem Treffen besuchte ich das Friedensmuseum von Hiroshima, das an einem Platz im Friedenspark steht, und fand Futagawas Geschichte bestätigt. Hiroshima ist eine Hafenstadt an der Trichtermündung des Ota und war eine von nur zwei Städten, die 1945 von den Amerikanern noch nicht bombardiert worden waren. (Die andere war die alte Hauptstadt Kyoto, deren sagenumwobene Tempel ein amerikanischer General früher einmal besichtigt hatte und deshalb vor der Zerstörung retten wollte.) Es gab Gerüchte – die sich bewahrheiten sollten –, wonach die Amerikaner womöglich etwas »Besonderes« mit Hiroshima vorhatten. Rund 8.400 Jugendliche arbeiteten am fraglichen Tag an den Brandschneisen; 6.300 von ihnen starben.
Im Museum waren mehrere Uniformen ausgestellt, die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag zu Hause gelassen hatten, als sie die Brandschneisen anlegen gingen. Dort hing das Kleid von Noriko Sado, damals in ihrem ersten Jahr an der höheren Schule, gestiftet von ihrer Mutter Mieko, sowie Hose, Stiefel und Hut von Koso Akita, einem fünfzehnjährigen Jungen, dessen Eltern ihn gerade noch in den Trümmern fanden, ehe er starb. Außerdem sah ich eine Schuluniformbluse, gestiftet von Herrn Futagawa, dessen Vortrag ich zuvor gehört hatte. Sie war das Eigentum seiner älteren Schwester gewesen, die bei der Arbeit verglühte. Er hatte geweint, als er erzählte, wie er die Bluse nach dem Tod seiner siebenundachtzigjährigen Mutter sorgfältig gefaltet hinten in einer Schublade gefunden hatte. Ihr ganzes Leben lang habe seine Mutter sich geweigert, über die Katastrophe zu sprechen, die ihrer Familie widerfahren war. Die Bluse, sagte er, »war das Einzige, was ihr von ihrer Tochter blieb, doch erzählt hatte sie uns davon nie. Ich kann mir das Leid nicht vorstellen, das hinter diesem Geheimnis verborgen lag.«
Mit ergreifender Sorgfalt geben die Kuratoren des Museums die Identität jedes Opfers an, dessen persönliche Dinge dort ausgestellt sind. Daher wissen wir, dass das verbogene Dreirad in einem der Räume dem dreijährigen Shinichi Tetsutani gehörte und dass sein Vater es mit ihm bestattet hatte, sich dann aber anders entschied und es für das Museum exhumierte. Wir erfahren, dass Tsuneyo Okahara nach der Explosion der Bombe das Büro aufsuchte, in dem ihr achtundvierzig Jahre alter Mann Masataro damals arbeitete. Auf der verzweifelten Suche nach seinen Überresten durchsuchte sie das zerstörte Gebäude. Schließlich fand sie auf einem Schreibtisch seine Lunchbox und seine Pfeife aus Elfenbein – und Knochen auf dem Schreibtischstuhl. Der Anblick der Knochen bleibt uns erspart, aber die geschmolzene Lunchbox und die Pfeife sind ausgestellt.
Begonnen hatte mein Tag in Hiroshima mit der jährlichen Gedächtniszeremonie im Friedenspark, der dort angelegt ist, wo früher das dicht bevölkerte Innenstadtviertel Sarugaku-cho stand. Sie war kurz, aber ernst und fand zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs statt. Die Familien der Hinterbliebenen schlugen die Friedensglocke an. Der Bürgermeister, der Premierminister und andere hielten kurze Reden, dann stiegen Friedenstauben auf, und es wurden Tausende von den Teilnehmern gefaltete Papierkraniche aufgehängt, die für die verstorbenen Kinder stehen.
Abseits der Zeltdächer für die geladenen Gäste stand eine stille Menschenmenge und folgte dem Ereignis auf Bildschirmen; die Musik und die Reden wurden von den Zikaden auf den Bäumen fast übertönt. Viele Besucher hatten Anstecker mit der Aufschrift »No Nukes« (Stoppt Atomwaffen) und Fächer mit der gleichen Botschaft mitgebracht. Einige alte Menschen standen in stummer Erinnerung mit ausdruckslosen Gesichtern da. Die meisten jedoch waren viel jünger. Für sie war das Ereignis ein erschütternder Teil der Geschichte. Es folgten einige – in meinen Augen – ausgesprochen sonderbare Formen des Gedenkens. Eine Frau im weißen Abendkleid sang mit zitternder Stimme, während eine andere – ebenfalls in Abendgarderobe – sie auf einem ramponierten Klavier begleitete, das die Detonation überstanden hatte. »Das bombardierte Klavier der verstorbenen Akiko« stand in englischer Sprache auf einem Schild.
Mich beeindruckte, wie die Menschen den Tatsachen ins Auge schauten. Niemand versuchte, seinen Kindern die Schrecken der Bombe zu ersparen. Während der Gedächtniszeremonie wurde von einem Jungen erzählt, der sah, wie »verkohlte Leichen die Straße blockierten. Ein unheimlicher Gestank drang mir in die Nase. So weit ich sehen konnte, erstreckte sich ein Feuermeer. Hiroshima war die Hölle auf Erden.« Zwei Sechstklässler trugen eine Friedenserklärung vor, die mit den Worten begann: »Ich roch die brennenden Körper. Die Haut der Menschen war geschmolzen. Sie sahen nicht mehr menschlich aus.« Im Museum zeigten Eltern ihren kleinen Kindern großformatige Bilder von verbrannten und entstellten Menschen und lasen ihnen die Texttafeln vor, auf denen die Symptome der Strahlenkrankheit ausführlich aufgelistet waren. »Zahnfleisch- und Nasenbluten durch Zerstörung der Schleimhäute, Haarausfall, Knochenmarksversagen, Verminderung der roten Blutkörperchen, Darmblutungen« und so weiter. Manche Opfer, so erfuhren die Kinder, hatten buchstäblich ihre Eingeweide ausgehustet.
Während meiner Forschungsreise um die Welt zu den Schauplätzen nuklearer Katastrophen habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich ihre Vorstellungen von den unsichtbaren Schädigungen durch die Kerntechnik zurechtlegen. Hier, wo die Menschen mit den schlimmsten Folgen eigene Erfahrungen gemacht hatten, ging man verstörend schonungslos und direkt damit um.
Ebenso eindrucksvoll war, wie wenig Groll gegen die Amerikaner es hier gab – was angesichts der Fernsehberichte über rüpelhafte ausländerfeindliche Äußerungen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016, die ich am Abend zuvor gesehen hatte, kein Wunder gewesen wäre. Doch nichts dergleichen. Manche zeigten sich vielmehr dankbar darüber, dass in diesem Jahr Präsident Barack Obama das Museum besucht hatte. Auch in Privatgesprächen äußerte sich niemand kritisch über die amerikanischen Touristen, die die Zeremonie still verfolgten. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass sich die Amerikaner auf ähnliche Weise jede harsche Kritik verkneifen würden, hätten die Japaner eine vergleichbare Bombe über dem amerikanischen Festland abgeworfen.
Doch da war noch etwas anderes. Wenngleich das Museum in Hiroshima sich sehr direkt mit der Bombe und ihren schrecklichen Folgen beschäftigte, erwähnte weder dieses Haus noch sein Pendant in Nagasaki die Kapitulation Japans wenige Tage nach den Bombenabwürfen, die das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeläutet hatten. Mein Eindruck ist, dass Japan auf das Bombardement mit stoischer Ruhe und mit Würde zurückblicken kann. Die Niederlage hingegen war zu viel.
Als ich das Museum verließ, gab die lächelnde Mitarbeiterin am Ausgang jedem eine abschließende Botschaft mit auf den Weg. »Bitte denken Sie immer daran«, sagte sie, »dass schon innerhalb eines Monats nach der Bombe das Gras in Hiroshima wieder zu wachsen begann.« Archivaufnahmen hinter ihr zeigten, wie sich entlang des Flussufers Pflanzen schnell wieder ausgebreitet und durch die Risse im Straßenbelag gedrängt, wie sie die Asche überdeckt und sich zwischen die Trümmer der Gebäude geschoben hatten. Das sei eine »Hoffnungsbotschaft«, sagte sie. Eine solche Botschaft hatte ich nötig, als ich an dem Hügeldenkmal vorbeiging, das die Überreste von 70.000 Menschen enthält, deren Leichen überall in der Stadt gefunden worden waren, aber nie identifiziert werden konnten. Die Widerstandskraft der Natur gegenüber atomarer Strahlung wurde zu einem weiteren Leitgedanken auf meiner Reise zu den nuklear belasteten Landschaften der Erde.