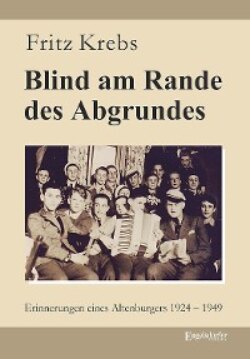Читать книгу Blind am Rande des Abgrundes - Fritz Krebs - Страница 10
3. Die ersten Schuljahre
ОглавлениеIn unserer Schule umfasste mein Jahrgang etwa 100 bis 120 Kinder. Sie waren auf je eine Klasse für Jungen und eine für Mädchen aufgeteilt. Das restliche Drittel musste in einer gemischten Klasse unterrichtet werden. Ich befand mich in Klasse a, in der ausschließlichen Gesellschaft von Jungen. Unsere Ausrüstung bestand im ersten Schuljahr vor allem aus einer Schiefertafel, Schieferstiften zum Schreiben und einer Schwammdose, in der sich stets ein gut angefeuchteter Gummischwamm zu befinden hatte. Das Stillsitzen während des Unterrichts lernten wir ja einigermaßen schnell. Dagegen wurde das Kratzen der Buchstaben und Zahlen auf die Schiefertafeln anfangs recht beschwerlich für mich. Im zweiten Jahr verließen wir zum Glück diese steinzeitliche Methode und schrieben mit Bleistiften in richtige Schreibhefte. Am meisten gefielen mir die Fächer Lesen, Zeichnen und Turnen. Alles Übrige erforderte fleißiges Üben, wovon ich nicht viel hielt. Ich sah nicht ein, dass man von seiner Freizeit allzu viel für eine solche Dressur opfern sollte. Als größtes Übel empfand ich das sogenannte „Kleine Einmaleins“. Es gelangte vermutlich in der dritten Klasse auf den Unterrichtsplan, ohne dass mir die Nutzanwendung klargeworden war. Es ist ja bis heute so geblieben: Wenn Kinder etwas nicht einsehen können, dann stemmen sie sich dagegen. Meinen inneren Widerstand überwand mein Vater durch die einfache Aufforderung zum täglichen Üben. Das wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit durch Abfragen einer sogenannten „Reihe“ kontrolliert und zog bei Nichterfüllung der Norm Spielverbot außer Haus nach sich. Letzteres nannte man damals „Stubenarrest“. Es stellte sich alsbald der gewollte Erfolg auch ohne meine tiefere Einsicht in den Sinn der Sache ein. Zu meinem Besten hatte ich einen notwendigen Fortschritt gemacht. Man wird vermutlich über Methoden der Erziehung noch mancherlei bedenken müssen. Eines steht für mich heute fest, dass nämlich der den Deutschen meiner Generation nachgesagte unbedingte Gehorsam gegenüber der Obrigkeit auch von einer solchen Art der Erziehung herrührt. Kinder, die autoritär erzogen werden und nachträglich die für sie positiven Ergebnisse eines vormals ausgeübten Zwanges feststellen können, sind im Erwachsenenalter leichter geneigt die gute Absicht auch hinter den Härten einer staatlichen Obrigkeit zu vermuten.
Meine Mitschüler in der Volksschule kamen ebenso wie ich aus einfachen Verhältnissen. Wir hatten jedoch auch Kinder aus sehr armen Elternhäusern bei uns. Sie erschienen ohne Frühstück in der Schule und liefen fast das ganze Jahr über barfuß. Es betraf dies etwa drei bis vier Jungen. Als ich davon zu Hause erzählte, gab mir meine Mutter öfter ein doppeltes Frühstück mit, das ich nicht lange anbieten musste, um es an den Mann zu bringen. Unser Klassenraum mit seinen drei Bankreihen, deren Schülerpulte mit Klappsitzen fest verbunden und unverrückbar auf eiserne Schienen aufgeschoben waren, machte einen sehr nüchternen Eindruck. Deshalb durften wir ihn in der Adventszeit mit Tannengrün und selbstgebastelten Papierketten ausschmücken. An einer Seitenwand prangte das ganze Jahr über ein Schild mit einer Art Leitspruch. Er drang mir während der Dauer meiner vier Volksschuljahre so unausrottbar in das Gedächtnis, dass ich ihn noch jetzt wortwörtlich aufsagen kann. Er lautete: „Wer behauptet Deutschland sei am Kriege schuld, lügt. Und diese Lüge ist die Wurzel unserer Not!“
Vielleicht gelang mir das zwanghafte Aufsagen dieser Zeilen schon zu einer Zeit, als ich gerade Lesen gelernt aber den Sinn derselben noch nicht begreifen konnte. Lange Zeit stand das Fach Zeichnen auf Platz eins unter meinen Lieblingsfächern. So „malte“ ich mit großer Geduld auch zu Hause, ohne dass eine Aufgabenstellung des Lehrers dies erforderte. Es regte dazu schon ein Blick aus dem Fenster an. Da ich, wie schon gesagt, vom Wohnzimmer aus das Bahngelände einsehen konnte, brachte ich anfangs serienweise Eisenbahnzüge zu Papier. Bald interessierte ich mich auch für die Häuser und Gärten, die man von unserem Küchenfenster aus überschaute. Es entstanden neue Bildserien mit Häusern, die teilweise mit Fachwerk verziert waren. Ich machte mir gewissermaßen zeichnend meine nähere Umgebung zu Eigen und fühlte ein wohliges Vertrautsein mit den vielen kleinen Details in dieser heimatlichen Landschaft. Zwar habe ich später mein Talent nicht weiterentwickelt, als Hilfsmittel zur Aneignung von Kenntnissen über meine Umgebung hat es mir in meinem Leben jedoch oft gute Dienste geleistet. Besonders bei meiner späteren Beschäftigung mit Naturwissenschaften konnte ich noch häufig davon profitieren. Es verhalf mir, wie ich meine, sehr zur Verinnerlichung von Naturerlebnissen weil Zeichnen sowohl den Blick für das Detail schärft als auch die Fähigkeit entwickeln hilft, Gesehenes zu gliedern und zu reflektieren. Heute weiß ich, dass ich unzählige Male hieraus Kraft schöpfen konnte wenn manchmal das Rohe und Primitive in meiner Umgebung überhandnehmen wollte.
Wir wurden regelmäßig auch im Fach Religion unterrichtet. Die biblischen Geschichten, besonders die aus dem Alten Testament hörte ich gewöhnlich gern, was damals schon nicht mehr für alle meine Klassenkameraden zutraf. Sobald aber das Auswendiglernen von Bibelsprüchen gefordert war, sträubte ich mich wie alle meine Mitschüler dagegen. Es half nichts denn auch in diesem Fach herrschte die übliche Strenge der Pädagogen. So blieb einiges in meinem Gedächtnis hängen, was später zu meinem Vorteil manchmal wie ein innerer Kompass wirkte. In jener Zeit musste auch täglich vor der ersten Unterrichtsstunde von allen Schülern gemeinsam das sogenannte Thüringer Schulgebet aufgesagt werden. Es begann mit den Worten: „Schütze Herr mit starker Hand unser Volk und Vaterland …“
Dieser von uns gleichmütig unbeteiligt und neben unseren Bänken stehend heruntergeleierte Text hinterließ in mir keinen besonderen Eindruck. Eine Langzeitwirkung rechne ich ihm dennoch zu. Durch seine ständige Wiederholung dürfte er in unseren Hirnen zur festen Verknotung der Begriffskombination „Gott“ und „Vaterland“ beigetragen haben. Später schaffte Hitler das Beten vor Unterrichtsbeginn ab und führte an seiner Stelle die militärisch exakte Meldung des Klassenältesten vor dem Lehrer ein. Ich wage nicht die Behauptung, dass die Schulbehörde der Weimarer Republik mit diesem Schulgebet dem zweiten Weltkrieg bewusst Vorschub leisten wollte. Aber es steht für mich außer Zweifel, dass es für Hitler und seine Leute leicht war, ein solcherart bestelltes Feld in den Köpfen einer gegenüber der Obrigkeit unkritischen deutschen Jugend raffiniert auszubeuten.
Mein Klassenlehrer in den ersten vier Schuljahren war ein junger Lehrer mit Namen Karl Demut. Ich habe ihn nur mit Knickerbockerhosen bekleidet in Erinnerung. Er hatte einen eigenartig federnden Gang, als befände er sich ständig auf einer ausgedehnten Wanderung. Er stammte aus dem Thüringer Glasbläserort Lauscha. Für die damaligen Verhältnisse war er sicher der Typ des progressiven Pädagogen.
Ich mochte ihn wegen seiner offenkundigen Gerechtigkeit und vor allem deshalb, weil er sehr phantasievoll unterrichtete. Wir hatten bei ihm Deutsch, Zeichnen, Rechnen und Werken. In unserer Klasse gab es anfangs Probleme mit dem fehlerfreien Lesen, die dieser findige Pädagoge auf eine heute merkwürdig anmutende Weise zu beheben verstand. Eines Tages stellte er einen Sandkasten ins Klassenzimmer und baute darin Zinnsoldaten auf. Es waren darunter auch stattlich anzuschauende Reiterfiguren und wir trauten unseren Augen nicht, dass die Schule uns mit des damaligen deutschen Jungen liebstem Spielzeug beglücken sollte. Es gab seinerzeit kaum einen unter uns, der nicht in irgendeiner Weise mit militärischem Spielzeug umging. Mancher besaß selbst eine kleine Armee von „Bleisoldaten“, die durch Einschmelzen alter Bleirohre und mittels überkommener Gussformen hergestellt wurden. Die Armee unseres Lehrers zog aber nicht für das Vaterland, sondern im pädagogischen Dienst in den Krieg. Herr Demut sagte uns zu, dass derjenige, der einen Text vorgegebener Länge fehlerfrei lesen würde, mit einer Reiterfigur belohnt werden solle. Fortan übten wir das Lesen mit einer Inbrunst wie ich sie nie wieder unter Schülern erlebte. Es war eine regelrechte Leseschlacht entbrannt und täglich meldeten sich mehrere Schüler zum Lesen vor der Klasse. Immer jedoch, wenn wir schon dachten es habe einer das Ziel erreicht, kam der obligatorische Versprecher. So zog die Armee des Herrn Demut nach einigen Wochen ohne Verluste wieder in ihre Quartiere. Wir aber hatten im Lesen enorme Fortschritte gemacht. Bemerkenswert an dieser Geschichte ist noch, dass keine einzige Figur gestohlen wurde. Es sei auch gesagt, dass dieser Lehrer alles andere als ein Militarist war. Er aber kannte seine Umwelt und die von ihr geprägten Kinder.
Die große Schülerzahl erforderte an unserer Schule die Einhaltung einer strengen Pausendisziplin. Wir mussten dazu auf dem Schulhof getrennt nach Geschlecht in je einem großen Kreis um einen aufsichtsführenden Lehrer herumspazieren. Das fiel besonders den unteren Klassen schwer denn dieses Verfahren der Pausengestaltung verstieß gegen den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern. So verging keine Pause, ohne dass mehrere Delinquenten im Kreis neben dem Lehrer stehen mussten ,um darauf zu warten bis sie am Schluss die Butterbrotpapiere auflesen durften, die jedes Mal wenn die Klingel das Pausenende verkündete auf dem Schulhof herumlagen. Natürlich hatte diese Methode ihre Vorteile für die Sauberhaltung des Schulobjektes. Man durfte nur nicht zu den Schülern gehören, denen öfter das Temperament durchging weil man dann dauernd mit Papierauflesen dran war.
Im Werkunterricht lernten wir bei Herrn Demut, wie man aus anscheinend unnützen Dingen das schönste Spielzeug basteln konnte. Anstatt uns aufzutragen, Material für den Unterricht zu kaufen, was unseren Eltern ohnehin nicht möglich gewesen wäre, schickte er uns zu Schuhmachern, in Fotogeschäfte und Konsumlager oder in Mutters Küche. Dort lernten wir alsbald, Pappkartons aller Art, Filmspulen, Blechdosen und anderes Verpackungsmaterial für den jeweiligen Unterrichtszweck ausfindig zu machen. Als Klebstoff diente uns ein Kleister, den wir aus Wasser und Mehl zusammenrührten. Mir machte das Verwandeln dieser Dinge in Häuser, Wagen, Eisenbahnen, Brücken, Fahrstühle, Türme, Burgen und dergleichen einen solchen Spaß, dass ich zeitweise meine Freizeit nur noch mit der Umwandlung profanen Abfalls in Produkte meiner Phantasie verbrachte. Besonders in den nasskalten Tagen vor Einbruch des Winters wurde dies zu einer Beschäftigung, bei der ich die Zeit vergessen konnte. Dabei entstanden manchmal in Erwartung des baldigen Schneefalls auch Landschaften im Winterkleid, in denen man den Schnee durch erstarrten dicken Mehlkleister darstellte. So schön das alles auch sein mochte, wenn eines Tages die ersten echten weißen Flocken vom Himmel herabschwebten, dann war es mit der Stubenhockerei vorbei. Jubelnd pflegten an solchen Tagen die Kinder unserer Straße die glitzernden weißen Sterne zu begrüßen. Sie wussten, nun konnten bald die Schlitten herausgeholt werden. Es begann die Zeit, wo wir in Scharen vom nahen Steinberg oder vom Weißen Berg herabrodelten. Damit kam aber auch die Zeit der kribbelnden Zehen und des großen Appetits auf Fett Bemmen. Bis es dunkel in den Straßen wurde, hatte sich jedes Mal genügend Schnee an unseren Wollstrümpfen verklumpt oder war in die Schnürschuhe gestiebt, dass es schließlich höchste Zeit wurde, den elterlichen Wohnungen entgegen zu zuckeln. Dort brachten wir vor der geöffneten Bratröhre des Küchenherdes manchmal mit tränenden Augen wieder Leben in die Glieder von Händen und Füßen. Wenn Mutter dann das selbstgemachte Griebenfett aus dem Schrank holte, um uns damit unser Brot zu bestreichen, dann kuschelten wir uns wohlig in der kleinen Wohnküche zusammen, die seinerzeit zu fast allen Haushaltungen in unserer Straße gehörte. In einem Monat Heimatkunde hätten wir nicht besser lernen können, was der Begriff „Heimat“ beinhaltet, als in diesen Stunden. Es ist mit den Kindern so wie mit den Katzen: Sie müssen das Schnurren lernen, wenn sie heimisch werden sollen.
War erst einmal der erste Schnee gefallen, dann dauerte es gewöhnlich nicht lange bis zum Weihnachtsfest. Die Schule bereitete uns auf ihre Weise darauf vor, indem sie im nahen Gasthof Rasephas regelmäßig eine Weihnachtsfeier ausgestaltete. Alle Klassen beteiligten sich entsprechend ihrer Kenntnisse und Befähigung daran, indem sie kleine Theaterstücke einübten. Die entsprechenden Vorbereitungen liefen über viele Wochen hinweg und wurden teilweise mit dem Unterricht verbunden. In der zweiten Klasse übten wir das Lesestück „Abenteuer im Walde“ als Bühnenstück ein, wobei alle Schüler mitwirkten. Unser Klassenlehrer hatte entsprechende Dialoge verfasst. Im Werkunterricht bastelten wir die Kulissen. Sie bestanden aus Pappbäumen, von denen jeder einen Holzstiel bekam, damit man den Baum anfassen und festhalten konnte. Ich gehörte zu den Statisten, die den wackelnden Wald auf der Bühne vorzustellen hatten und für die unwissenden Zuschauer im Chor erklären mussten: „Wir sind die Bäume“. Ich war zufrieden, keine Hauptrolle übernehmen zu müssen, wie etwa der Darsteller eines wichtigtuerischen Hirschhornkäfers oder die einiger anderer Waldbewohner, die unter einem großen Fliegenpilz in Regenschirmformat ihre Dialoge zu sprechen hatten. Die Elternschaft applaudierte am Schluss voller Rührung und ich hastete von der Bühne, die mir damals nicht die Welt bedeutete. So traten nach und nach alle Klassen mit irgendwelchen Darbietungen vor der zahlreich versammelten Elternschaft auf. Ich war jedenfalls froh, dass ich wieder unter den Zuschauern Platz nehmen durfte. Wenngleich mir selbst der öffentliche Auftritt als Schauspieler nicht lag, so war ich doch von den Vorführungen der älteren Schüler so sehr beeindruckt, dass ich noch auf dem Heimweg wie aufgezogen herumzappelte. Dabei ging ein Erinnerungsstück an meinen Auerbacher Großvater zu Bruch, das meine Eltern als Requisite für den Auftritt des Hirschhornkäfers zur Verfügung gestellt hatten. Es war eine sehr schöne Tabakspfeife mit einem buntbemalten Porzellankopf.