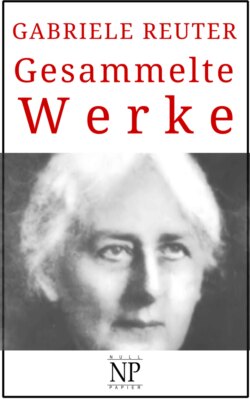Читать книгу Gabriele Reuter – Gesammelte Werke - Gabriele Reuter - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX.
ОглавлениеAgathe war nun schon zwanzig Jahre alt.
Die Regierungsrätin freute sich recht, als im Februar eine entfernte viel jüngere Verwandte, mit der sie hin und wieder kurze Briefe wechselte, die Bitte an sie richtete, ihr das Töchterchen für einige Wochen zu schicken. Agathes Fotografie habe in ihr den Wunsch erweckt, sie kennen zu lernen.
Die Cousine, die, zur Malerin ausgebildet, einen polnischen Künstler, Kasimir von Woszenski, geheiratet hatte, galt bei Heidlings für geistig anregend, ja für genialisch. Dabei waren die Familienverhältnisse des Ehepaares doch so solide gefestigt, dass selbst der Regierungsrat nichts Ernstliches gegen einen Besuch der Tochter einwenden konnte. Aber es gefiel ihm nicht, sie von seiner Seite zu lassen. Er war an ihr Schwatzen und Lachen, an das Gehen und Kommen all der jungen Mädchen um ihn her gewöhnt. Er mochte diesen leichten anmutigen Reiz in seinem trockenen, arbeitsvollen Berufsdasein nicht entbehren – auch nicht für vier Wochen. Er sah nicht ein, wozu er eine Tochter habe, wenn sie auf Reisen gehen wollte.
Unsicher bemerkte die Rätin: Agathe könnte doch da vielleicht jemand kennen lernen … jemand mit Vermögen.
Der Regierungsrat wurde sehr zornig. Er habe nicht nötig, seine Tochter verschachern zu lassen; er könne selbst für seine Tochter sorgen, und sie brauche durchaus nicht zu heiraten.
So hatte es ja die Rätin nicht gemeint. Sie wollte etwas andeuten, was sie nicht zu sagen wagte, weil es ihr unzart vorkam. Agathes Wesen, das gegen die jungen Männer ihres Kreises immer steifer und verschlossener wurde, bekümmerte die Mutter. Agathe hatte durch hochmütige Nichtachtung schon mehrere Herren, die sich ihr auffällig zu nähern suchten, verletzt und zurückgestoßen. Die Rätin wusste nicht von der Erfahrung, die Agathe an ihrem Bruder gemacht hatte, und die auf ihr ruhte, wie ein Unrecht, an dem sie durch ihr Verschweigen mit schuldig geworden war. Die Rätin wusste auch nichts von den Beziehungen Lord Byrons zu ihrer Tochter.
In ihrem, durch die Sorgen um einen weitläufig und umständlich geführten Haushalt, von den Erinnerungen an ihre toten Kinder und von ihrem Nervenleiden gequälten Kopf war längst ein Zustand der Ermattung eingetreten, der es ihr unmöglich machte, Ursache und Wirkung irgend welcher Verhältnisse zu übersehen, eine Gedankenfolge klar und scharf zu Ende zu führen. Aber je schwächer ihr ursprünglich nicht armes Verstandesvermögen wurde, desto mehr steigerte sich die Ahnungsfähigkeit ihres Gemütes, das mit unendlich feinen Gefühlstastern den verborgensten Stimmungen ihrer Lieben nachspürte und sie leidend mitempfand. Sie seufzte, sobald die Rede auf Walters und Eugeniens Hochzeit kam, und doch war für alle Freunde der Familie in dem bevorstehenden Ereignis eitel Freude für ein Mutterherz zu sehen. So fühlte Frau Heidling auch jetzt, dass eine Zerstreuung, ein Wechsel der Eindrücke für Agathe heilsam sein werde. Sie hatte nicht ohne Absicht die letzte schöne Fotografie des Mädchens dem Malerehepaar geschickt. Weil sie keine überzeugenden Gründe vorbringen konnte, suchte sie ihr Ziel mit stillem Eigensinn zu erreichen.
Frau Heidling eröffnete ihrer Tochter mit betrübtem Gesicht, der Vater habe entschieden, wenn sie reisen wolle, so könne sie die Kosten von ihrem Taschengelde tragen.
»Papa weiß ja gar nicht, dass Du Dir was gespart hast«, fügte sie mit einem schelmischen Triumph hinzu. »Zwanzig Mark gebe ich Dir aus der Wirtschaftskasse – die kann ich gut erübrigen! Da muss er es doch erlauben! – Freust Du Dich nicht auf die Reise?«
Agathe blickte ihre Mutter verstört und erschrocken an.
Ja – sie hatte sich einen kleinen Schatz erspart …
Schon lange trug sie in Gesellschaften keine Glaceehandschuhe mehr, sondern Halbseidene, und auf Spaziergängen sogar Baumwollene. Machten die jungen Damen einen Abstecher zum Konditor, so wusste sie sich auf irgend eine Weise zurückzuziehen, und ihre Geburtstagsgeschenke waren geradezu mesquin. Die öffentliche Meinung beschäftigte sich bereits mit der augenfälligen Vernachlässigung ihrer sonst so gepflegten Erscheinung und mit der Veränderung ihres sorglos generösen Charakters.
Da der Wortschatz der jungen Mädchen kein allzu reichhaltiger war, wurden zwei Ausrufe bald von Lisbeth Wendhagen, bald von Fräulein von Hennig, dann wieder von Kläre Dürrheim oder von Eugenie als neueste Beobachtung preisgegeben.
»Kinder, was sagt ihr nur zu Agathe? –«
»Ich finde das eigentlich …«
Der Grad von Missbilligung, von Entrüstung schien so stark zu sein, dass er nur durch eine unheimliche Pause hinter dem »eigentlich« … recht zur Geltung gebracht werden konnte.
Agathe sparte für eine Reise nach England. Sie wollte ihres toten Lieblings Grab besuchen, an den Stätten wandeln, wo er geatmet und gesungen – wo er das Leben gelitten und genossen hatte.
Ach – und wie lange dauerte es, bis aus den einzelnen Nickel- und Silbermünzen ihres Taschengeldes auch nur ein Goldstück eingewechselt werden konnte. Auf dem Grunde des Kästchens, in dem Agathe ihren Schatz bewahrte, lag ein Zettel, der in gotischen Buchstaben den Spruch enthielt: Vernunft, Geduld und Zeit macht möglich die Unmöglichkeit. Wenn Agathe ihn las, war ihr zu Mute, als nähme sie einen Schluck Chininwein.
Mit nervöser Lust fühlte sie das Geld zwischen ihren Fingern, das ihr endlich ein Erlebnis bringen sollte – das große Erlebnis, nach dem ihr ganzes Wesen gespannt war. Vielleicht erlaubten ihr die Eltern die Reise nicht – vielleicht musste sie heimlich gehen und durfte dann niemals wiederkommen … Sie besann sich, ob irgend etwas in dem Kreise ihrer jetzigen Freuden sie mit starker Gewalt hätte zurückhalten können?
Nein – da gab es nichts. Alles erschien ihr fade und klein, von allem kehrte sie sich misstrauisch oder gleichgültig und verdrossen ab.
Nun wurde sie plötzlich vor eine schwere Wahl gestellt.
England zu erreichen, ohne die Einwilligung der Eltern, war ja höchst unwahrscheinlich – wie eine ganz tolle Idee kam der Plan ihr jetzt vor.
Frau von Woszenska schrieb reizende Briefe – zu drollig … Und ihr Mann war ein richtiger Pole – große Künstler verkehrten in seinem Hause …
Agathe antwortete, sie wolle reisen – natürlich wollte sie!
… Ach Gott – nun musste sie die Goldstücke in ihr Portemonnaie stecken. Wie sie damit ihre Liebe profanierte.
Sie war feige – sie war kein großer Mensch, der sich und seinen Entschlüssen treu bleibt.
Aber was half’s! Nun wollte sie auch einmal wieder von Herzen vergnügt sein.
*
Frau von Woszenska erwartete Agathe auf dem Bahnhof und schleppte sie gleich zu ihrem Manne ins Atelier. Ein starker Duft von Terpentin und ägyptischen Zigaretten drang ihnen entgegen. Der polnische Maler schob die Brille auf seine magere Adlernase herunter und blickte Agathe mit blauen traurigen Beobachteraugen an, während seine dürre lange Hand sie herzlich begrüßte. Er hatte in einem geschnitzten Lehnstuhl gesessen, den Kopf an ein altes Lederkissen gelehnt – seine begonnene Arbeit prüfend. Auf einer Staffelei vor ihm stand eine große Leinwand.
Frau von Woszenska, die, aus Leipzig gebürtig, ein lebhaftes Sächsisch redete, stellte sich neben ihren Mann, legte ihm die Hände auf die Schulter, blickte das Bild mit scharfer Aufmerksamkeit an und rief dann fröhlich:
»So wird’s, Kas! Here mal, mei Kutster – so wird’s!«
Herr von Woszenski wendete sich höflich zu Agathe und sagte:
»Ich wollte es die Extase der Novize nennen.«
Agathe suchte sich in das unvollendete Gemälde hineinzufinden.
Vor einem mit fantastischer Vergoldung prunkenden Altar, auf dem Kerzen im Weihrauchnebel flimmern und blutroter Sammet über weiße Marmorstufen flutet, ist eine junge Nonne in die Knie gesunken – ihr dunkler Schleier, die schweren Gewänder flatternd in geisterhaftem Sturmwind, der mit einem Strom von Glanz durchs hohe Kirchenfenster bricht – unzählige geflügelte Köpfchen, amorettengleiche Engels-Gestalten vom Himmel herabwirbelnd. Und die junge Nonne hat in den erhobenen Armen das Jesuskindlein empfangen.
Ihre Gestalt, die selige Innigkeit ihrer Gebärde waren erst in Kohlenstrichen angedeutet – ihr Antlitz ein leerer grauer Flecken. Aber Agathe seufzte tief in andächtiger Verwunderung, als sie die Meinung verstand.
Frau von Woszenska nahm sie bald mit sich, indem sie ihrem Manne zurief: »Höre, Du – heut gibts nur Eierkuchen und ein Stück Schinken – ich brauche die Köchin.«
Er lächelte einverstanden.
Frau von Woszenska hatte ihr Atelier in der Wohnung, um neben der Kunst den Haushalt überwachen zu können. Sie malte lustige Schulmädchen und blonde Kinder, die einen schwarzen Pudel abrichten. Damit verdiente sie das tägliche Brot und für ihren Gatten die Muße, die er zu seinen großen, unverkäuflichen Werken brauchte.
Nachdem die robuste Dienstmagd Agathes Koffer heraufgetragen und noch einmal Kohlen in den Ofen geschaufelt hatte, legte sie ihr Kleid ab und schälte aus dem berußten Baumwollenstoff ein Paar prachtvolle Schultern und Arme. Sie setzte sich auf ein erhöhtes Podium, Frau von Woszenska zeichnete ernst und eifrig. Agathe stickte eine Decke für Mama und wunderte sich dabei über die Situation im Allgemeinen und im Besonderen über die seltsamen Grimassen, die Frau von Woszenska bei der Arbeit ein unbewusstes Bedürfnis zu sein schienen.
Sie nannte Agathe sofort mit dem Vornamen und »Du«. Auf diese Weise gab sie ihr gleich ein Heimatsgefühl.
Der kleine Sohn Michel kam aus der Schule. Er sah blass und müde aus. Frau von Woszenska schimpfte auf die verrückten Schuleinrichtungen. Sie schnarrte das doppelte »R« so eindrucksvoll, dass der Laut förmlich eine pathetische Bedeutung von Zorn und Leidenschaft erhielt.
Die Köchin hatte ihre Götter-Schultern schon vorher wieder in blauen Gingan gehüllt und brachte dem Kleinen die Suppe. Michael reckte seine dünnen Glieder auf dem Stuhl vor dem Teller und ließ die Winkel seines eingeknifften Mündchens hängen. Er hatte keinen Appetit.
»Das Kind isst wieder nicht … Einem sein Kind in solchem Zustand nach Haus zu schicken!« murmelte Frau von Woszenska. Sie versprach Michel, wenn er essen wolle, zur Belohnung »die traurige Ziegenfratze« oder »die lustige Mohrenfratze«. Die Orang-Utangfratze, erzählte sie Agathe, dürfe sie nur machen, wenn es Kas nicht sehe – die wäre ihm zu unästhetisch.
»Mutter – jetzt hab’ ich ’ne närrische«, sagte Michel, »– – weißt Du, wie unser Klassenlehrer macht, wenn er Fliegen aus den Tintenfässern fischt?«
Der Junge nahm ein Stückchen Brot, holte Reisbröckchen aus seiner Bouillon, schleuderte sie fort und murmelte ingrimmig:
»So ’ne Schweinerei – nee, so ’ne Schweinerei!« Er brachte den Eifer und den Ekel eines vertrockneten Gymnasiallehrer-Gesichtes in erstaunlicherweise zur Darstellung.
Seine Mutter und Agathe lachten laut auf. Frau von Woszenska schüttelte sich vor Vergnügen, in ihren Augen funkelte eine wilde Rachebefriedigung.
»Famos, Michel! Noch mal! Das muss ich auch lernen!«
Michels erschlaffte kleine Züge röteten sich, während er und seine Mutter die neue Fratze probierten. »Du kannst’s, Du kannst’s!« schrie er begeistert. »Jetzt esse ich auch meine Suppe!«
Sich an der Dummheit, der Trivialität, der Hässlichkeit wie an einem seltsamen Genusse zu ergötzen – das war die Weise, in der die drei verfeinerten Menschen sich gegen diese Gewalten wehrten, wodurch sie sich Freiheit und geistreichen Frohsinn bewahrten.
Nannte Woszenski seine Frau bei ihrem Vornamen, so fand er es entzückend, dass die ungewöhnliche Person, deren Bewegungen an ein japanisches Götzenbild erinnerten, welches kurzes, krauses, nach allen Seiten davonstarrendes Negerhaar besaß und grelle aufgeregte Augen – dass sie gerade »Mariechen« heißen musste. Der Gegensatz, den ihr scharfes Organ und ihr Leipziger Dialekt zu seinem gewählten, leicht von ausländischem Akzent berührten Deutsch bildete, hatte vielleicht auf den Entschluss, sie zu heiraten, eingewirkt, als ein subtiler und närrischer Reiz. Ihm waren die gesellschaftlichen und künstlerischen Verhältnisse der Gegenwart so zuwider gewesen, dass er verwundet und ermattet allem den Rücken gekehrt und sich bei einem Einsiedler auf Capri in Kost und Wohnung gegeben hatte, als dem einzigen Menschen, der seinen Nerven nicht unerträglich wurde. Bis Mariechen kam und ihn sich durch ihren sieghaften Humor in die Welt zurück holte.
Am Abend, während das Ehepaar mit dem jungen Gast in ihrem Wohnzimmer saß, von dessen Decke eine Messing-Lampe aus einer Synagoge niederhing, wo lebensgroße buntbemalte Kirchenheilige an den Wänden lehnten und über den gefalteten Händen Fetzen von japanischer Seide trugen, begann Herr von Woszenski aus jener Zeit zu erzählen. Er war in einem alten Pelzrock gewickelt, auf dessen Schultern sein langes, schon ergrauendes Haar Spuren gelassen hatte. Seine ausdrucksvolle Künstlerhand liebkoste den wirren Bart, und er rauchte unzählige Zigaretten, während er mit leiser bedeckter Stimme sprach.
Bei Pagano war ein junger Maler gestorben. Er und ein paar andere hatten seine Leiche zum Festland hinübergerudert … »Das Meer glänzte still im frühen Morgenlicht wie so eine kostbare Perlmutterschale – und auf der grauen Flur trieb ein großer Strauß blassroter Rosen an uns vorüber – wir sahen sie immer auf- und niederschwanken, mit der Bewegung der Wellen. Und der schwarze Sarg im Boot war ganz bedeckt mit Rosen …«
*
Agathe lag lange wach auf dem ungewohnten Lager, in dem ihr noch fremden Raum.
Sie hörte das Murren der Wogen zwischen Capri und Neapel – sie sah die Rosen auf der silbernen Flut … Blutroter Sammet strömte über den Hochaltar, Engelsköpfe umgaukelten sie … Und ein Sturmwind vom Himmel schauerte durch ihre Seele.
*
»Das Kind soll die alte Hauptmann Gärtner besuchen, ihre Mutter kennt sie von früher. Ich will Mittag mit ihr hingehen. Du könntest ’mal bei Lutz vorsprechen, Kas. Wir treffen uns dann.« So bestimmte Frau von Woszenska das Programm des Tages.
Agathe verspürte Lust, sich zu putzen. Sie nahm ihren neuen Rembrandtut aus dem Koffer. Der Hut stand ihr reizend. Papa hatte ihn zu auffallend gefunden, aber Mama hat gemeint, für die Künstlerstadt wäre so etwas gerade das Richtige. Doch Frau von Woszenska trug sich sehr einfach – beinahe schäbig sah sie aus in ihrer schwarzen Trikotbluse.
Nein – Agathe genierte sich … Frau von Woszenska würde sie für eine oberflächliche, eitle Fliege halten. Und man zog auch seine besten Sachen nicht so mir nichts dir nichts an, wenn man gerade vergnügt war, sondern wenn die Gelegenheit es forderte. Die Anschauung war Agathe nun einmal in Fleisch und Blut übergegangen. Es taute überdies und das Wasser klatschte in großen Tropfen von den schneebedeckten Dächern. Der Rembrandtut wanderte in den Koffer zurück und die Pelzmütze wurde aufgesetzt. Ganz nett sah sie ja so auch aus – wenn sie einmal nicht geistreich und bedeutend sein konnte, so war es doch recht angenehm, dass sie wenigstens so ein hübsches Gesichtchen hatte. Frau von Woszenska tauschte beim Frühstück mit ihrem Manne ganz beifällige Bemerkungen über sie, eigentlich ein bisschen als wäre sie ein Bild, nicht ein lebendiger Mensch, der eitel werden konnte. – – Merkwürdig lau war die Luft, ihre Winterjacke wurde Agathe viel zu warm. Sie knöpfte sie auf, denn sie hatte schon so eine Freude, dass man sich hier in dem stillen alten Städtchen und bei Woszenskis mehr gehen lassen konnte als zu Haus, wo man fortwährend Rücksicht auf Papas Stellung nehmen musste.
Während des Besuches saß sie nach einigen von ihr beantworteten Fragen still und hörte auf Frau von Woszenskas Gespräch mit der alten Dame. Alles, was Frau von Woszenska sagte, war Agathe spannend und merkwürdig, wenn sie auch nur, wie eben jetzt, von Dienstboten sprach.
»… Ja – ich wollte mal ’ne Solide haben. … Eine Solide!! sage ich zu Kas. Da nehmen wir eine, die ’n Kropf hat …«
Das »R« wurde mit Leidenschaft geschnarrt. »Und een’ Buckel! Einen ordentlichen Buckel! – So. – Am ersten Sonntag kommt das Frauenzimmer: ist zum Maurerball eingeladen. Willst Du nicht vorher essen? frage ich. Da stellt sie sich vor mich hin und sagt so ganz von oben – von oben herab – über den Kropf weg: Ich danke – die Herren traktieren! – Nun habe ich aber eine Schöne! Die kann ich doch zum Modell brauchen!« Laut und triumphierend schlug sie auf den Tisch.
Die Hauptmann Gärtner machte ein Gesicht, als tue man ihr weh. Sie bemerkte mit schwachem Lächeln, eine besondere Schönheit könne sie an Woszenskis jetziger Köchin nicht finden – aber Künstler wären in allem so originell.
Frau von Woszenska grinste mit der lustigen Mohrenfratze zu Agathe hinüber. Sie verabschiedete sich höflich und versicherte, ihr Mann warte schon unten auf sie.
Er kam aus der höheren Etage und traf mit ihnen auf der Treppe zusammen.
»Da hab’ ich ja nicht ’mal gelogen!« rief die Malerin.
»Kommt doch einen Augenblick herauf, Lutz möchte Dir sein Bild zeigen. Das Atelier wird Fräulein Agathe auch interessieren«, sagte Woszenski.
»Sie wird sich doch nicht verlieben?« flüsterte Frau von Woszenska und machte strenge Augen. »Kind – lass das lieber – der da oben ist nichts für Dich.«
Agathe lächelte, sie dachte an Lord Byron.
Ein junger Mann hielt den Vorhang, durch den sie eintreten sollten, zurück und nahm den Hut ab. Er war schon zum Fortgehen gerüstet und trug Überschuhe, die für seine schmale, dürftige Figur viel zu groß und plump erschienen. Die Bewegung, mit der er grüßte und hinter seinen drei Gästen den alten Gobelin fallen ließ, war von eigentümlich zarter, liebenswürdiger Anmut.