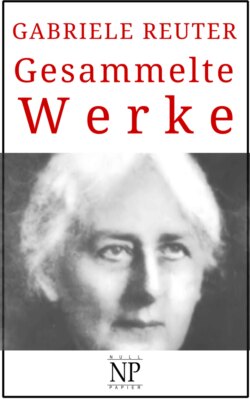Читать книгу Gabriele Reuter – Gesammelte Werke - Gabriele Reuter - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X.
ОглавлениеAls Agathe in ihr Gastzimmerchen bei Woszenskis zurückkehrte, schloss sie eilig die Tür hinter sich.
Sie blieb einen Augenblick stehen, sah erstaunt und verwirrt umher. Plötzlich fiel sie vor dem Bett auf die Knie, drückte ihren Kopf in die Arme und blieb so eine lange Weile, das Gesicht in den weißen Decken verborgen, ohne sich zu regen. Sie weinte nicht. Ein heftiges, anhaltendes Zittern lief durch ihren Körper. Dann war es, als ob die Luft ihr fehle. Sie warf den Kopf in den Nacken und blickte mit geöffneten, bebenden Lippen empor.
»Ach Gott! Ach Gott – ach mein lieber Gott!«
Ungeduldig zerrte sie die Handschuhe ab, sprang auf, schleuderte ihre Mütze, ihre Jacke von sich und lief planlos, die Augen mit Tränen gefüllt, in dem engen Raum umher.
Sie blieb stehen …
… Wie eine Erscheinung sah sie das Profil – die Linien seines Kopfes vor sich in der Luft.
Allmählich erblühte aus der Qual in ihrem Antlitz ein Lächeln, ein trunkenes Leuchten der Augen. Tief aus der Brust rang sich seufzend der Atem, die Tränen quollen und rannen klar über die glutheißen Wangen. Das Mädchen faltete die Hände und sprach leise, feierlich:
»Ich liebe ihn.«
Erschöpft saß sie auf dem Rand ihres Lagers, presste die gefalteten Hände gegen die Brust und wiederholte entzückt:
»Ich hab’ ihn lieb – ich hab’ ihn lieb …«
So versank sie in Träume. Wie war nur alles gewesen? – sie erinnerte sich nicht mehr, was er mit ihr gesprochen … Wie er den kleinen schwarzen Hut von dem hellen Kopf genommen und ihr seinen Blick zugewandt – das wusste sie noch. Ja – hell und zart – mit seinen schlanken Formen, ein wenig blass und müde um die Augen – so trat seine Erscheinung wie hinter einen leichten Nebel, der alles nur undeutlich erkennen ließ, vor ihre Fantasie.
Sie hatten wenige Worte gewechselt – er redete mit Frau von Woszenska über seine begonnene Arbeit. Da gebrauchten sie Ausdrücke, die Agathe fremd waren, die auch ihr Vater niemals benutzte, wenn er über die Kunst sprach. Und sie machten mit Händen und Fingern andeutende, zeichnende und fortwischende Bewegungen in der Luft. Frau von Woszenska rührte an bunte Stoffe, die auf einem weißlackierten Tischchen lagen, und entschuldigte sich ernsthaft, als habe sie eine große Rücksichtslosigkeit begangen. Er lächelte und bemerkte, das habe nichts auf sich. Er hob einen der Stoffe in die Höhe und liebkoste ihn gleichsam mit seinen unruhigen Händen – eine weiche, weiße, türkische Seide von kühlen, blaugrünen Streifen durchzogen. Sie war auf dem Bilde wiedergegeben, ein bronzener Amor sprang aus ihren Falten.
Agathe wagte zu sagen, sie möge Stillleben nicht leiden – aber diese Idee wäre lustig.
Da sah er sie noch einmal schnell und flüchtig an. »Ja? – Meinen Sie? Ich denke auch.«
Sie hörte, dass er Herrn von Woszenski »mein Freund Hamlet« nannte und ihm riet, nach München zu ziehen. Hier würde er kein Modell zu der Nonne finden. »Das Naive ist hier immer gleich roh!«
Schüchtern hatte Agathe sich in dem Atelier umgesehen. Eine kleine Chaiselongue mit blauem Seidenplüsch bezogen – Kissen von verblasstem, blumendurchwirktem Damast auf graziös geschweiften Stühlen – alles andere war ein Gewirr von weichen, einschmeichelnden Farben – Formen – Stoffen – Dunkelheiten, die durch alte Radierungen und Bronzen in die lichte Eleganz gebracht wurden. Die Einrichtung unterschied sich stark von dem herben Künstlergeschmack, der bei Woszenski herrschte.
Niemals hatte Agathe dergleichen gesehen. Aber in ihr tauchte eine Erinnerung auf, als habe sie davon geträumt – als habe sie das alles unbewusst gesucht.
*
Sie hob ihre Hand, die der Maler beim Abschied flüchtig gedrückt – ein süßes, liebes Gefühl war ihr in den Nerven geblieben. Zitternd näherte sie sie den Lippen – es war kein Kuss, nur ein leises, behutsames Ruhen des Mundes auf der Stelle, die er berührt hatte. –
Ihr Staunen, von der längst erwarteten, gefürchteten, erhofften Gewalt berührt, ergriffen, eingehüllt und gefangen zu sein, wich mehr und mehr einer schelmischen Neugier auf alles, was nun folgen musste.
Und die Fantasie mit ihren trügerischen Spiegelungen ließ sie im Stich.
Es gab für Agathe nur noch zwei Menschen auf der Welt. Sie mussten sich vereinigen, und das Geheimnis der Vereinigung musste ihr enthüllt werden. Die Neugier wich auch von ihr. Sie war Entweihung.
Das Mädchen stand mitten im Allerheiligsten des Gefühls – sie war bereit – wie Julia bereit war für den Geliebten.
*
Während des Mittagsmahles streifte Frau von Woszenska ihren Gast zuweilen mit aufmerksamem Blick. Agathe aß kaum etwas. Auch am Abend nicht. Sie war sehr schweigsam. Doch ein erhöhtes Wohlgefühl vibrierte in ihr. Das Blut klopfte ihr mit stärkerem Pulsschlag in den Adern, es schimmerte rötlicher, gesunder durch die feine Haut der Wangen. Ihr Gang hatte etwas Freies, Leichtes, sie trug den Kopf stolzer und die braunen Haarlöckchen flatterten keck um die Schläfe – um die kleinen heißen Ohren. Wenn das Mädchen irgend eine gleichgültige Antwort geben sollte, lächelte sie den Fragenden mit einem schönen frohen Ausdruck an. Jugend und Leben sprachen beweglich aus ihren feuchtglänzenden Augen.
*
… Nein – das war ja nicht möglich Herr von Lutz konnte sich nicht in dunkler Nacht aus himmlischen Höhen zu ihr niedersenken, wie Amor die bebende Psyche fand … Auf der Treppe, die zu Woszenskis Wohnung führte, machte Agathe es sich mit inniger Heiterkeit klar, dass Lutz dieselben Stufen emporsteigen müsse, wenn er sie wiedersehen wolle. Dabei beschlich sie die erste bange Frage, ob das je geschehen würde.
*
Das Gedächtnis für diese Zeit ihres Lebens war später fast in ihr erloschen. Sie hatte keine Erinnerung mehr, wann das trunkene Glück sich in Verwunderung, wann die Verwunderung sich zu Angst und die Angst zu dumpfem, quälendem Kummer sich wandelte.
Es geschah alles nicht so, wie sie erwartet hatte. Er kam nicht. Doch sie mussten sich ja wiederfinden. Er wartete wohl auf eine Begegnung, die ihm der Zufall bringen sollte.
Zweifel an dem Eindruck, den sie empfangen hatte, kamen Agathe nicht.
Sie liebte ihn.
Allmählich begann sie zu ahnen, dass Liebe für gewisse Naturen nicht Glück, sondern Leiden ist, und wenn sie nicht zum Höhepunkte gesunden Lebens führt, zur Krankheit wird, an der die Jugend zu Tode welkt.
*
In einem Konzert sah Agathe ihn unerwartet dicht vor sich sitzen. Sie hatte ihn nicht einmal gleich erkannt; darüber war sie sehr erschrocken.
Er trug den Kopf ein wenig geneigt. Zuweilen wandte er ihn mit der Anmut, die gerade diese Bewegung bei ihm auszeichnete, zu der Dame an seiner Seite und sprach ein leises Wort.
Agathe wartete in erstickender Spannung, ob er sich aus seinem Stuhl umdrehen und ob sein Blick dann auf sie fallen werde. Er tat es nicht. Er schien sehr hingenommen von dem leisen, aber lebhaften Gespräch, das er in den Pausen mit seiner Nachbarin führte.
Ein ungemein zierliches kleines Wesen war sie und trug ein schwarzes Kleid mit winzigen Perlen bestickt, die leicht glitzerten, sobald sie sich bewegte. Dazu ein braunes Hütchen mit weißem Krepp.
In der Form ihres Kopfes lag eine gewisse Ähnlichkeit mit der des Malers, und auch in der Färbung ihrer Haut, die nichts von dem rosigen Anhauch eines Blondinen-Teints besaß, sondern an den matten Ton des Elfenbeins erinnerte.
Aber Lutz hatte ein richtiges Märchenprinzenprofil – und sie zeigte am Ende des Konzertes Agathe ein drolliges Näschen und einen breiten Mund.
Nun erkannte Agathe sie. Es war die Schauspielerin, die sie vor ein paar Tagen in einer Knabenrolle bewundert hatte. Ihre affektierte Grazie war die einer kleinen Rokokofigur aus einem Fächer, dessen Farben schon ein wenig verblasst sind.
Frau von Woszenska hatte keinen Platz neben Agathe bekommen und saß mehrere Reihen weiter nach vorn. Als Agathe beim Hinausgehen nur noch durch einige Personen von ihr getrennt war, sah sie, wie Lutz zu ihr trat, um sie zu begrüßen. Sein feines nervöses Gesicht nahm einen liebenswürdigen Ausdruck von Güte, ja von Ehrfurcht an. Während er der Schauspielerin folgte, bemerkte er auch Agathe und lüftete noch einmal leicht den Hut. Er lächelte, seine Augen waren träumerisch, die Erinnerung der Musik lag noch darin.
»Ist Fräulein Daniel mit Herrn von Lutz verwandt?« fragte Agathe Frau von Woszenska.
»Nein – ich weiß nichts davon – ich glaube durchaus nicht … Warum?«
»Weil sie sich ähnlich sehen.«
»Ja – Du hast recht! Das ist doch närrisch! Sie ist seine Freundin. Ein gescheidtes Frauenzimmer!«
*
Woszenski zeichnete Agathe mehrere Male als Studie zu seiner Novize. Lutz habe ihn auf den Gedanken gebracht – sie habe so fromme Augen …
Er seufzte viel bei der Arbeit, durchwühlte sein Haar und seinen wirren Bart, starrte über die Brille hinweg und unter ihr hervor.
»So ein weiches Köpfchen, wo noch nichts drin ist – das ist sein – aber schwer – schwer.«
Ihre helle rosige Farbe passte ihm auch nicht in den Ton des Bildes.
Dann ließ er es plötzlich ganz, ohne einen Grund dafür anzugeben. Holten die Damen ihn aus dem Atelier, so fanden sie ihn, versunken in Grübeleien, vor seinem Werke sitzend. Mariechen machte ein ernstes, sorgenvolles Gesicht.
Abends erzählte er ihnen die tollsten Entwürfe zu neuen Arbeiten. Oder er beriet mit seiner Frau, was er malen würde, wenn er das Talent zum Geldverdienen hätte, was er nicht besaß.
»Mohren gehen – die gehen immer … Jäger mit Hunden werden auch gern gekauft.«
Frau von Woszenska bekam eines ihrer Bilder von der Münchener Ausstellung zurück. »Das Zeug will sich ja keiner in die Stube hängen – na – es war ’mal so ’ne Idee«, sagte sie philosophisch, indem sie es auspackte. Ein Turmfenster, das in dem Beschauer den Eindruck von schwindelnder Höhe, von Erdenferne und Himmelsnähe erweckte. Im Hintergrunde die Umrisse der großen Kirchenglocke. Und ein Kind blickt im Bogen des Fensters, den Kopf auf das runde dicke Ärmchen gelegt, ruhig hinab. Über ihm, an einem derben Haken, hängt eine tote Gans, auf ihrem flaumigen, mit der größten künstlerischen Delikatesse behandelten Gefieder glänzen still die letzten Sonnenstrahlen.
»– Tante Mariechen«, fragte Agathe, »wolltest Du damit sagen, dass ein vollkommener Friede nur durch eine Gans und ein Kind dargestellt werden kann?«
Frau von Woszenska lachte. »So kluge Bemerkungen musst Du den Hässlichen überlassen, dazu bist Du viel zu hübsch«, antwortete sie erfreut.
Agathe wurde es viel leichter, ihre Gedanken Woszenskis auszusprechen als ihren Eltern. In der unsicher tastenden Zagheit ihrer Empfindungen verwirrte sie schon die Ahnung eines Widerspruchs. Zu Hause war sie noch immer von Pädagogik umgeben. Hatte Frau Woszenska eine abweichende Ansicht, dann stellte sie sie als eine menschliche Anschauung einer anderen gegenüber. Und Kas war noch feinfühliger als seine Frau. Wo sie Philisterhaftigkeiten bemerkte, wurde ihr ganzes Gesicht gleich grausamer Hohn, auch wenn sie kein Wort sprach.
Nun geschah das seltsame, dass Agathe unter ihrem angelernten Geschmack etwas in sich fand, das damit gar nicht zusammenhing, das selbstständig, wenn auch sehr bescheiden und ängstlich, ein ihr selbst nur halb bewusstes Dasein geführt hatte. Sie bemerkte mit frohem Erstaunen, dass ihr Widerwille gegen die Langeweile, Gleichförmigkeit und Enge der gesellschaftlichen Sitten ihres Kreises, ja gegen die Grundsätze ihrer eigenen Eltern von Woszenskis völlig geteilt wurde.
Vieles, was ihr Vater als absurd und manieriert verdammte, stand hier in hohen Ehren.
So hatte Agathe ganz aus eigene Hand entdeckt, dass es einen großen Künstler gab, der Böcklin hieß, und dessen Bilder jedes Mal Sehnsucht und Glück in ihr weckten. Mit unbehaglichem Schweigen, als verleugne sie etwas Heiliges, hatte sie Walters und Eugenies Witze über ihn angehört. Die Tränen schossen ihr in die Augen, als sie Woszenski zum ersten Mal seinen Namen nennen hörte und er, was sie dunkel empfunden, mit geistreichem Verständnis pries. Ihr Wesen streckte sich gleichsam und wuchs und breitete sich aus in diesen Wochen.
Aber am meisten lernte sie doch von Lutz. Wie er war, und was er liebte, und wovon er bewegt wurde, suchte sie listig und mühsam zu erfahren. Es dünkte sie, als käme sie ihm auf eine geheimnisvolle Weise näher, indem sie ihn verstehen lernte.
Ihrem ersten Geliebten verdankte Agathe den Naturrausch, der sie bei jedem Sonnenuntergang in mystische Extasen versetzte – das Verständnis für die großen Konturen der Dinge und die schwärmende Begeisterung für eine weit, weit von allem Erdenweh entfernt wohnende Freiheit.
Der Don Juan, der sie durch seine Ironie verletzte, und den sie bis auf wenige Stellen nicht leiden mochte, hatte ihr dennoch den Blick für die Lächerlichkeit der Konvention geschärft.
Von ihrem zweiten Geliebten erlauschte sie nun den raffinierten Genuss an den Melodien der Farben, an ihren fernsten Abtönungen, und der Wirkung von Licht und Schatten – an den seltsamen Beziehungen zwischen Farbe und Seelenstimmung.
Adrian Lutz bedeutete ihr: in einem weiten Dunkel mit den beängstigenden Umrissen ungeheurer, unbestimmter Gestalten ein schmaler weißer Lichtstreif – eine zartleuchtende grünblasse Waldorchis.
Aus drei Radierungen und ein Paar Landschaftsstudien, die Woszenski von Lutz besaß und sehr hoch hielt, bildete Agathe sich eine Geschmacksrichtung: Modernste französische Schule mit etwas nervöser Romantik, die der Künstler aus dem ihm Eigenen hinzugetan.
Das war ein fremdes, scharfes Gewürz in ihrer bisherigen Nahrung. Ob der Regierungsrat Heidling gerade diese beiden Männer zu Erziehern seines Kindes gewählt haben würde?
Vorsichtige Eltern pflegen sich wohl einen Plan für die Bildung ihrer Töchter zu entwerfen. Aber die heimlichen Einflüsse, die am stärksten auf einen jungen Frauengeist wirken – die können sie nicht berechnen.
*
Einmal noch während ihres Aufenthaltes bei Woszenskis sah Agathe Lutz von weitem in einer menschenleeren Straße. Sie war dort auf und nieder gegangen, um die Zeit zu erwarten, wo sie ihm zu begegnen hoffte. Es war das erste Mal, dass sie so etwas tat, und sie konnte es auch nicht wiederholen – es zerriss sie zu sehr.
Er kam, die Zigarette zwischen den Lippen, aus seinem Atelier, traf auf den Postboten und nahm ihm einen Brief ab. Mit seinen hastigen Bewegungen riss er den Umschlag auf und schritt lesend ihr näher. Agathe ging langsam an ihm vorüber, ohne dass er sie bemerkte. Er blickte in die Höhe, sein bewegtes Gesicht strahlte vor Freude über die Nachricht, die er soeben empfangen hatte. Da fühlte sie tief, dass er mitten in einem reichen Dasein voll mannigfacher Erlebnisse stand – und sie hatte keinen Anteil daran – ihr war es ganz fremd.
Als fünf Wochen verflossen waren, reiste sie nach Haus zurück.