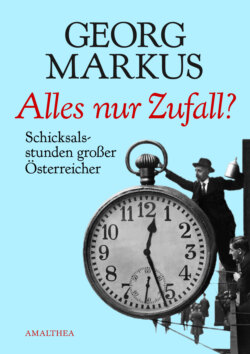Читать книгу Alles nur Zufall? - Georg Markus - Страница 16
»SCHREIBEN S’ MIR EINE TYPE«
ОглавлениеHans Moser wird entdeckt, 31. Dezember 1922
Hans Moser, eigentlich Hans Julier * 6. 8. 1880 Wien, † 19. 6. 1964 Wien. Volksschauspieler. 1925 von Max Reinhardt an das Theater in der Josefstadt und nach Berlin geholt. 200 Filme u. a. Burgtheater (1936), Hallo Dienstmann! (1952).
42 Jahre musste dieser Schauspieler alt werden, ehe man von ihm Notiz nahm. Mehr als zwei Jahrzehnte war er auf böhmischen Schmierenbühnen aufgetreten, als jugendlicher Liebhaber mit Chor- und Statisterieverpflichtung, musste Kulissen schieben und Theaterzettel austragen. Meist in schmutzigen Gasthaussälen, in denen es als »Gage« ein nicht einmal besonders schmackhaftes Abendessen gab. Kein Direktor oder Regisseur ließ ihn sein, wofür er geboren war: ein Komödiant von Gottes Gnaden.
Er selbst wusste, was er konnte. Sein Traum war es, sein komisches Talent in Solonummern zeigen zu können, so wie sie den berühmten Kollegen der damals populären Wiener Varieté- und Kabarettbühnen auf den Leib geschrieben wurden. Aber niemand würde einem unbekannten Schmierendarsteller aus der Provinz eine solche Nummer schreiben.
1922 hat er endlich wieder einmal ein Engagement in Wien. Es ist nichts von Bedeutung, Hans Moser spielt im Varieté Reklame auf der Praterstraße in dem Einakter Nachtasyl eine kleine Rolle.
Doch er weiß, dass dieses Engagement seine vielleicht letzte Gelegenheit sein könnte. Und er nützt sie. Im Ensemble des Varietés befindet sich eine junge Soubrette namens Friedl Weiss, die jeden Abend nach der Vorstellung vom berühmten Librettisten Fritz Löhner-Beda – der viele Sketches, aber auch Texte für die Operetten von Franz Lehár schrieb – abgeholt wird. Wie Moser herausfindet, ist die Schauspielerin mit dem angesehenen Schriftsteller verlobt.
Hans Moser wittert seine Chance, wie mir Friedl Weiss fast sechzig Jahre später anvertraute. »Eines Tages klopfte Herr Moser an meine Garderobentür, trat ein und sagte: ›Frau Weiss, ich bin ein armer kleiner Schauspieler, Sie sind doch immer in Begleitung des Herrn Dr. Löhner-Beda. Ich hätte eine Bitte an ihn. Vielleicht könnte er mir eine Soloszene schreiben, das wäre sehr wichtig für mich.‹«
Fritz Löhner-Beda, eigentlich Löwy * 24. 6. 1883 Wildenschwert/Böhmen, † 4. 12. 1942 Auschwitz (ermordet). Kabarettautor, Librettist. Mit Franz Lehár Schöpfer u. a. der Operetten Das Land des Lächelns (1929), Giuditta (1934).
Wie nicht anders zu erwarten, explodiert der stets unter Zeitdruck stehende Löhner-Beda, als er durch seine Verlobte vom Wunsch des unbekannten Schauspielers erfährt: »Immer kümmerst du dich um die anderen, ich komm nicht einmal dazu, dir eine neue Nummer zu schreiben, und das wäre viel wichtiger.«
Moser lässt nicht locker und klopft schon am nächsten Abend wieder an der Garderobentür des Fräulein Weiss. »No, was hat er gesagt, der Herr Doktor?«
»Sehr gut schaut’s nicht aus, Herr Moser. Aber passen S’ auf, wenn ich heut aus dem Theater geh, wird er draußen auf mich warten. Da werde ich Sie ihm vorstellen.«
Gesagt, getan. »Herr Doktor Beda – Hans Moser!«
»Ja, meine Verlobte hat mir von Ihnen erzählt«, stöhnt der Vielbeschäftigte. »Ich soll Ihnen was schreiben. Was hätten S’ denn gern?«
»A Type, Herr Doktor, wenn S’ mir eine Type schreiben könnten, das wär sehr gut, wissen S’, so was Wienerisches.«
»Was für eine Type denn?«
»Ich hab’ mir dacht, einen Garderober oder einen Hausmeister oder so was halt.«
»Also gut, ich werd’s versuchen«, erwidert Löhner-Beda – wohl eher um den Schauspieler loszuwerden. »Kommen S’ halt morgen vor der Vorstellung ins Dobner.«
Pünktlich, wie vereinbart, betritt Moser am nächsten Abend das beliebte Künstlercafé am Naschmarkt. Fritz Löhner-Beda sitzt an seinem Stammtisch, hatte die Vereinbarung aber längst vergessen. Er bittet um Entschuldigung, sperrt sich eine Dreiviertelstunde lang in die Herrentoilette ein – und kommt mit einem fertigen Einakter zurück. Der Titel lautet: Ich bin der Hausmeister vom Siebenerhaus.
Löhner-Beda überlässt Moser die Szene eines »Hausdrachens«, der seine »Macht« gegenüber den Wohnungsmietern ausspielt, ohne dabei die Armut und die Erbärmlichkeit seines eigenen Daseins zu erkennen.
Der Direktor des Varieté Reklame ist sofort begeistert, als er davon erfährt. »Was, ein Sketch vom Löhner-Beda? Schon gekauft, das ist doch klar.«
Die Silvestervorstellung steht unmittelbar bevor, für sie ist die Nummer des berühmten Librettisten ideal. Und wirklich, am 31. Dezember 1922, tritt Hans Moser mit dem Hausmeister vom Siebenerhaus in seiner ersten Solonummer auf.
Endlich, zum ersten Mal in seinem Leben, kann der bisher so gut wie nicht wahrgenommene Schauspieler sein überragendes Talent unter Beweis stellen. Fritz Löhner-Beda sitzt in der Vorstellung und ist hingerissen, als er sieht, was Moser aus seiner Nummer herausholt. Der Librettist lädt für die folgenden Abende Gott und die Welt ins Varieté Reklame, und Moser wird zum Gesprächsthema der Stadt. Man engagiert ihn in andere Unterhaltungsetablissements, in den Simpl, ins Café Lurion, ins Konzertcafé Westminster, ins Chat Noir und ins Rideamus, in denen er mit der einzigartigen Interpretation seiner Solonummer das Publikum begeistert. Begleitet wird er immer von seiner Frau Blanca, mit der er seit 1911 verheiratet ist, die immer an ihn glaubte und ihm auch in den düsteren Stunden der Verzweiflung Mut machte. Eines Abends sitzt die berühmte Komikerin Gisela Werbezirk im Publikum und wünscht sich Moser als Partner für das von Karl Farkas an der Neuen Wiener Bühne inszenierte Lustspiel Frau Lohengrin.
Nach zwei weiteren Nummern, die Löhner-Beda für ihn schreibt – Der Patient und Der Heiratsvermittler – fasst Moser 1923 den Mut, selbst eine Solonummer zu entwickeln. Das Budapester Orpheum auf der Taborstraße hat ihn engagiert, und er will auf der renommierten Kabarettbühne etwas Neues, etwas Besonderes zeigen. Da erinnert sich Moser der Dienstmänner, die er in seiner Kindheit beobachtet hat, wie sie ihrer Kundschaft schwere Koffer, Körbe und Einkaufstaschen nachgetragen und wie sie unter ihrer Last gestöhnt haben. Hans Moser ist am Wiener Naschmarkt aufgewachsen und konnte dort viele Dienstmänner studieren. Jetzt will er einen nörgelnden, viel zu schwachen Kofferträger darstellen. Und die Idee sollte sich als durchschlagender Erfolg erweisen, er spielt die Rolle sein Leben lang.
Und es geht rasant weiter: Robert Stolz sieht Moser als Dienstmann und empfiehlt ihn dem Direktor des Ronacher, der ihn sofort in seine neue Revue Wien gib’ acht! holt. Eduard Sekler, der Regisseur des Programms, erinnerte sich später: »Damals, im Ronacher, hat Moser, als Dienstmann verkleidet, zum ersten Mal genuschelt. Wir inszenierten die Kofferszene, und irgendwie ergab sich diese eigentümliche Sprechweise. Sie sollte ihm zur Eigenart werden. Und da er merkte, dass das dem Publikum gefiel, hat er es eben beibehalten.«
Die dritte Solonummer hat er sich selbst auf den Leib geschrieben: Den »Dienstmann« spielte Hans Moser sein Leben lang.
Einer anderen Version zufolge sei das Nuscheln krankheitsbedingt, durch eine Verkrümmung des Moser’schen Kehlkopfs, entstanden.
Wie auch immer, das Ronacher ist – im Gegensatz zu den bisherigen Kellerbühnen – ein großes Theater. Zeitungskritiken erscheinen, und Anton Kuh schreibt 1924 von dem »bald in Pallenberg-Nähe rückenden Hans Moser«. Dieser spielt inzwischen auch die Solonummer eines Pompfüneberers, die Karl Farkas für ihn verfasst hat: Ein Leichenbestatter soll in der Szene die sterblichen Überreste eines soeben verblichenen Mannes abholen, er irrt sich aber im Stockwerk und gerät statt zu der erwarteten Trauergemeinde in eine ausgelassene Hochzeitsgesellschaft. Die Besucher des Festes halten den Leichenbestatter für einen kostümierten Witzbold, der sich wiederum sehr wundert, im Falle einer derart traurigen Angelegenheit auf eine so beschwingte Runde zu stoßen.
Eines Abends kommt kein Geringerer als Charlie Chaplin, auf Kurzbesuch in Wien, ins Ronacher. Chaplin ist begeistert und kauft Farkas die Rechte der Verwechslungsszene ab, weil er sie in Amerika verfilmen will. Er hat es – aus Respekt vor Mosers Leistung – nie getan.
Die verschenkten Jahre, die Auftritte mit Chor- und Statisterieverpflichtung, des Kulissenschiebens und Zettelaustragens sind endgültig vorbei. Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Das Theater an der Wien steigt in der »Silbernen Operettenära« zu neuer Blüte auf. Direktor Hubert Marischka holt Moser als »Dritten-Akt-Komiker« für die Uraufführung von Emmerich Kálmáns Gräfin Mariza und überträgt ihm von da an eine Traumrolle nach der anderen. Als Moser in Bruno Granichstaedtens Operette Der Orlow als Billeteur brilliert, kommt Max Reinhardt ins Theater an der Wien, um ihn zu sehen – und sofort zu engagieren.
Von einem Tag zum anderen steht er, der kurz zuvor noch der »Schmiere« angehörte, in der allerersten Reihe der besten Darsteller im deutschsprachigen Raum. Moser wird zu einem der Lieblingsschauspieler Max Reinhardts, er gibt ihm die Rollen, für die nur er geschaffen war: in Berlin, in Wien, bei den Salzburger Festspielen. Auf der Leinwand allerdings kann er sich erst durchsetzen, als die Technik den Tonfilm zulässt. Ab Mitte der dreißiger Jahre zählt Moser dann aber zu den meist beschäftigten und bestbezahlten Filmstars. Er dreht 150 Filme, oft so trivialen Inhalts, dass sie ohne Mosers Mitwirkung unvorstellbar wären. Doch sein Auftreten adelt die banalste Handlung, lässt den Unsinn, der da verbreitet wird, vergessen.
Er selbst hat immer von seinem Talent gewusst, wie er viel später – 1926, bereits als berühmter Mann – in einem Interview feststellte: »Eines möchte ich schon sagen: Das, was ich heute kann, habe ich vor zwanzig Jahren schon gekonnt. Um kein Haar war ich damals anders als heute, ganz gewiss nicht.«
Moser ist bereits 53, als er 1933 in dem Willi-Forst-Film Leise flehen meine Lieder einen kleinen Pfandleiher so überwältigend menschlich darstellt, dass er in einer Zeitung zum ersten Mal als »Volksschauspieler« bezeichnet wird.
Ein großer Menschendarsteller hat seine Chance zu nützen gewusst. Eine kleine Szene als Hausmeister, die auf der Herrentoilette des Café Dobner entstanden ist, hat ihn dorthin gebracht.