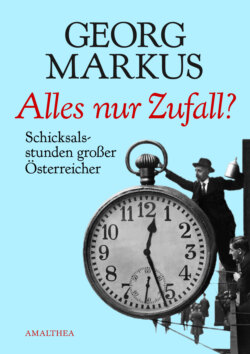Читать книгу Alles nur Zufall? - Georg Markus - Страница 18
»BITTE TRETEN SIE ZUR SEITE!«
ОглавлениеEgon Friedells Sprung aus dem Fenster, 16. März 1938
Egon Friedell * 21. 1. 1878 Wien, † 16. 3. 1938 Wien (Selbstmord). Veröffentlicht u. a. Die Kulturgeschichte der Neuzeit, drei Bände (1927–1931).
Es gab nichts, worüber sich Egon Friedell nicht lustig gemacht hätte. Auch der Selbstmord – und zwar sein eigener – war Teil einer Satire, die er zehn Jahre vor dem tödlichen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung verfasst hatte. »Egon Friedell«, schrieb er im April 1928, »hat gestern in seiner Wohnung einen Selbstmordversuch unternommen. Wir erfahren hierüber folgende Details: In seiner letzten Rolle, der Titelfigur in Geraldys Ihr Mann, in der er, wie wir ausdrücklich hervorheben, keineswegs unzulänglicher war, als in allen bisherigen, wurde er von der Presse wieder gefeiert. Schon nach den ersten Kritiken zeigte er ein an ihm ganz ungewohntes einsilbiges Wesen, und als das 6 Uhr-Blatt schrieb, er sei eine unvergessliche Gestalt auf der deutschen Bühne, verfiel er in tiefe Schwermut. In untröstlichem Tone erklärte er seinen Freunden gegenüber, dass er an die Aufrichtigkeit der Presse nicht mehr glauben könne und den künstlerischen Boden unter seinen Füßen wanken fühle«. Da Freunde das Äußerste befürchteten, sei Friedells Freundin, Frau Lina Loos, in die Wohnung gekommen: »Der Eintretenden bot sich ein schrecklicher Anblick. Friedell lag neben einer vollständig geöffneten, halb geleerten Flasche Abzugsbier in bewusstlosem Zustand unter Symptomen schwerer Alkoholvergiftung. Er wurde ins Spital gebracht, wo es gelang, ihm das Gift auszupumpen. Wie wir hören, soll er schon im Sommer aus ähnlichen Gründen im Erholungsheim Grundlsee einen Alkoholvergiftungsversuch mit Punschtorte gemacht haben.«*
Das also war der Nachruf, den er quasi als Vorruf geschrieben hat. Im März 1938 ist der Gedanke an Selbstmord kein Spaß mehr. Der Junggeselle und bisher stets gut gelaunte Schauspieler, Kabarettist, Schriftsteller und Philosoph spricht in den Tagen, ehe er den Gedanken wahr macht, immer wieder über die Möglichkeit, seinem Leben angesichts der Bedrohung durch den Einmarsch der Nationalsozialisten selbst ein Ende zu setzen. Er versichert, dass die Möglichkeit der Emigration für ihn nicht infrage komme, da die geringste Veränderung der Umwelt – eine Reise etwa – für ihn ein schier unlösbares Problem darstelle. Die Schriftstellerin Dorothea Zeemann, die in den letzten Lebenstagen des jüdischen Universalgelehrten mehrmals in seiner Wohnung in der Währinger Gentzgasse Nr. 7 erscheint, versucht, wie sie in ihrer Autobiografie erklärt, Friedell von dem Gedanken abzubringen, indem sie den Historiker in ihm aufrüttelt: »Es sollte dich interessieren, neugierig solltest du sein, wie es weitergeht.«
Die letzten Tage und Nächte des Philosophen, Historikers, Schauspielers und Kabarettisten Egon Friedell
Darauf Friedell, niedergeschlagen: »Ich weiß es aber schon, ich weiß es genau.«
Den Vorabend seines Todes verbringt Friedell mit Herma Kotab in seinem Arbeitszimmer. Ihre Mutter Hermine Schimann, Friedells langjährige Haushälterin, die ihm längst zur Freundin und Vertrauten geworden ist, hat sich, müde von den letzten, endlos durchdiskutierten Nächten, zu Bett begeben. Herma versucht den »lachenden Philosophen«, wie er ob seines scheinbar unerschütterlichen Humors genannt wurde, von seinem Gedanken an Selbstmord abzubringen. Friedell geht in seiner Wohnung auf und ab und erwidert, dass er auf dieser Welt nichts mehr zu sagen und daher auch nichts mehr zu suchen habe. Erst gegen 5.30 Uhr kann Herma ihn überreden, schlafen zu gehen.
Friedell hat seit dem »Anschluss« vor vier Tagen viel geraucht und getrunken, aber fast nichts gegessen. Endlich nimmt er an diesem 16. März 1938 zu Mittag etwas Suppe zu sich. Sein engster Freund Alfred Polgar, der seine Emigration in die Schweiz vorbereitet, kommt und versucht Friedell von der Möglichkeit der Flucht zu überzeugen. Am Abend sind wieder Dorothea Zeemann, weiters der Dichter Franz Theodor Csokor und der Theaterkritiker Walther Schneider bei ihm. Schneider wird sich nach dem Krieg im Vorwort eines Friedell-Buches erinnern, dass dieser nicht unvorbereitet in den Tod ging: »Mit dem Gedanken eines Selbstmordes machte er sich in den letzten Tagen seines Lebens vertraut und er verhehlte seine Absicht nicht. Er sprach ohne Sentimentalität und Bedrückung von ihr.« Die Freunde gehen an diesem, Friedells letztem Abend früher als gewöhnlich.
Kurz nach 22 Uhr, Friedell ist bereits in seinen Hausmantel gehüllt und will sich zum Schlafengehen fertigmachen, läutet es an der Tür. Herma Kotab öffnet. Zwei Burschen in SA-Uniform fragen: »Wohnt da der Jud Friedell?«
Herma: »Wenn Sie Herrn Dr. Friedell meinen, der wohnt hier.«
Einer der Männer zieht ein Papier aus der Tasche. »Wir holen ihn«, sagt er, »es liegt eine Anzeige vor.«
»Eine Anzeige?«
»Er hat vom Balkon aus auf eine Hakenkreuzfahne geschossen.« Die Anschuldigung ist natürlich eine Lüge – Friedell besitzt gar keine Schusswaffe. Durch das Gespräch an seiner Wohnungstür aufgeschreckt, erscheint Friedell, von der Bibliothek kommend, im Vorzimmer. Als er die SA-Männer sieht, verlangt er eine Erklärung. In diesem Moment eilt Franz Kotab – Hermas Ehemann, von einer Kinovorstellung kommend – die Treppe herauf. Die beiden Männer drehen sich einen Augenblick lang um.
Egon Friedell wusste, im Gegensatz zu vielen anderen, was jetzt, nach dem »Anschluss« an Hitler-Deutschland, auf jemanden wie ihn zukommen würde. Er hatte Wolfgang Langhoffs Buch Die Moorsoldaten gelesen, in dem der deutsche Schauspieler und Regisseur die Haftbedingungen unter den Nazi-Schergen beschreibt. Langhoff wurde nach dem Brand des Berliner Reichstags Ende Februar 1933 festgenommen und verbrachte mehr als ein Jahr in Haft im KZ Börgermoor. Sein Bericht, der mit großer Eindringlichkeit das mörderische System des Konzentrationslagers und die menschliche Erniedrigung der Häftlinge beschreibt, ist bereits 1935 in der Schweiz erschienen.
Das alles ist Friedell also bekannt. Er nützt daher den Augenblick, in dem die beiden SA-Männer sich im Stiegenhaus von ihm abwenden. Friedell läuft durch die Bibliothek in sein Schlafzimmer und öffnet das Fenster mit Blick in die Semperstraße. In diesem Moment betritt eine Frau aus dem benachbarten Haus Gentzgasse Nr. 2 die Straße. Sie sieht, wie sie später erklären wird, Friedells mächtige Figur auf dem Fensterbrett stehen. Und eine Hausbewohnerin namens Zeller, die die Semperstraße gerade überqueren will, hört, wie Friedell vorbeikommenden Passanten durch das geöffnete Fenster zuruft: »Bitte treten Sie zur Seite!« Und in derselben Sekunde springt er. Herma, die ihm in das Schlafzimmer nachgefolgt ist, schaut aus dem Fenster in die Tiefe. Im fahlen Licht erblickt sie Friedells Körper auf dem Trottoir liegend.
Franz Kotab und die SA-Männer laufen die drei Stockwerke hinunter und tragen Friedells überraschenderweise kaum entstellten Leichnam ins Haus. »Sein totes Antlitz«, schreibt Walther Schneider, der Friedell am nächsten Tag in der Leichenhalle sieht, »zeigte den etwas spöttischen Ausdruck eines Schauspielers, der seine Maske abgelegt hatte. Einem Kopf aus der Antike ähnlich, welcher seine letzte Arbeit* gewidmet war und die dem Antlitz ihren letzten Widerschein gab. Es war, als seine Zeit fast abgelaufen war und die rohe Gewalt der Außenwelt im Begriffe stand, von seiner Person Besitz zu ergreifen.«
Der Notarzt wird gerufen, bald danach trifft auch Friedells Hausarzt und Freund Dr. Rudolf Pollak ein. Beide untersuchen den Leichnam und Pollak versucht die einem Nervenzusammenbruch nahe Herma Kotab damit zu beruhigen, dass der Tod mit großer Wahrscheinlichkeit schon im Sturz durch Herzversagen eingetreten sei. Dann wird der Verstorbene in die Leichenhalle des jüdischen Friedhofs am nahen Währinger Park gebracht. Tags darauf wird nach einer Verfügung Friedells ein Herzstich vorgenommen. Er litt immer unter der Angst, man würde ihn scheintot begraben.
Eine Traueranzeige geht in Druck: »Vom tiefsten Schmerz gebeugt, geben die Unterzeichnenden allen teilnehmenden Freunden die traurige Nachricht von dem Hinscheiden ihres innigstgeliebten, unvergesslichen Onkels und Schwagers, Dr. phil. Egon Friedell, welcher Mittwoch, den 16. März 1938, im 61. Jahre, aus dem Leben geschieden ist.« Als Hinterbliebene sind seine Schwägerin, sein Neffe, Hermine Schimann sowie Herma und Franz Kotab genannt.
Am 21. März wird Friedell im evangelischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs bestattet. Die Trauergemeinde des vor ein paar Tagen noch von so vielen verehrten und geliebten Künstlers besteht aus einer Handvoll Menschen, die meisten Freunde sind bereits verhaftet oder auf der Flucht, andere wagen es nicht, das Begräbnis eines Juden zu besuchen.
Friedells Tod wird in Paris, in London und in New York gemeldet, in den Wiener Zeitungen nicht. Zwei Tage nach dem Begräbnis wird der Totenschein ausgestellt: Friedel mit einem »l«, steht da lapidar, »Selbstmord durch Fenstersturz«.
* Der »Nachruf« auf sich selbst wurde als Manuskript in Friedells Nachlass gefunden. Der Text blieb zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht.
* Der erste Teil von Friedells »Kulturgeschichte des Altertums« war 1936 erschienen, der zweite Teil stand vor der Fertigstellung.