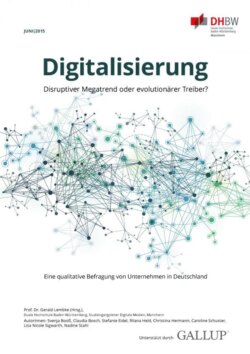Читать книгу Digitalisierung im deutschen Mittelstand - Gerald Lembke - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Forschungsdesign
2.1 Forschungsdesign – Entwicklung eines Denkrahmens
Ziel der Studie ist es, mittels der qualitativen, leitfadengestützten Befragung ausgewählter Experten festzustellen, wie sich die Digitalisierung auf Unternehmen in Deutschland auswirkt. Darüber hinaus soll überprüft werden, ob und aus welchen Gründen die Digitalisierung innerhalb verschiedener Branchen zu evolutionären (erhaltenden) oder disruptiven (ablösenden) Technologien, Innovationen bzw. Prozessen führt.
Entsprechend lauten die übergeordneten Forschungsfragen:
Wie wirkt sich der Megatrend Digitalisierung auf deutsche Unternehmen aus?
Führt die Digitalisierung zu evolutionären oder disruptiven Technologien, Innovationen bzw. Prozessen – und warum?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein eigener Denkrahmen entwickelt. Dieser beschreibt die Beziehung zwischen dem Megatrend der Digitalisierung und verschiedenen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die innerhalb dieses Rahmens auftreten. Die Autorinnen sprechen hier von den acht Trendsäulen der Digitalisierung: Big Data, Cloud Computing, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Gamification, Mobile Payment, Sharing Economy und Social Business (siehe hierzu Abb. 1).
Dieses Vorgehen sichert ein einheitliches Verständnis der einzelnen Trends und erlaubt es, grundsätzliche Hypothesen über die Auswirkungen der Digitalisierung im deutschen Unternehmertum zu formulieren (zu den einzelnen Trendsäulen der Digitalisierung siehe Kap. 3).
Abbildung 1: Die Trendsäulen der Digitalisierung
Quelle: Eigene Darstellung
Unter dem Begriff Trend ist grundsätzlich „eine Veränderungsbewegung oder ein Wandlungsprozess“ (Horx Zukunftsinstitut GmbH 2010, S. 1) zu verstehen, der in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft entstehen kann. Ausgangspunkt eines jeden Trends ist ein langfristiger Megatrend, aus dem sich einzelne Technologietrends und daraus wiederum Gesellschaftstrends entwickeln. Megatrends zeichnen sich zum einen durch ihre lange Dauer von mindestens 30 Jahren aus, zum anderen revolutionieren sie beinahe alle Lebens- und Verhaltensbereiche wie bspw. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik (vgl. ebd. S. 2).
Ausgehend von diesem Verständnis handelt es sich bei der Digitalisierung um einen Megatrend, mit dem u. a. neuartige Kommunikationsformen, Informationsverarbeitung in Echtzeit, neue Geschäftsmodelle sowie ein computer- und internetgestütztes Leben einhergehen (vgl. Jens Hansen Consulting GmbH 2015). Schaal bezeichnet die durch die digitale Revolution ausgelösten medialen Veränderungen als eine „Serie von Innovationsentwicklungen“ (2010, S. 109). Der revolutionäre Charakter der Digitalisierung erfordert demnach Anpassungen und Restrukturierungen innerhalb der verschiedenen Ebenen der Unternehmensführung und stellt somit besondere Anforderungen an das (Innovations-)Management (vgl. ebd. S. 113). Dieses Grundverständnis zum Megatrend der Digitalisierung zielt auf die erste Forschungsfrage ab.
Die Wissenschaft verweist im Rahmen diverser umwälzender Veränderungen auf die Theorie der disruptiven Innovation (auch: Durchbruchinnovation, zerstörerische Innovation) nach Clayton Christensen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der sich ursprünglich aus einer Branchennische heraus im Zeitablauf zu einem dominierenden Treiber entwickelt, der ganze Marktstrukturen verändert oder gar zerstört (vgl. Christensen/Matzler 2013, S. 1-7, 16f.; Fleig 2013; Buhse 2012, S. 241).
Disruptive Innovationen stammen häufig von kleinen und jungen Unternehmen: Eine neue Technologie bzw. Methode oder auch ein neuartiges Geschäftsmodell können nach diesem Verständnis bereits bestehende, etablierte Unternehmen und Produkte vollständig verdrängen.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei evolutionären Technologien um Innovationen, die eine Leistungsverbesserung bei bestehenden Produkten oder Dienstleistungen entlang der existierenden Wertschöpfungskette bewirken (vgl. Fleig 2013; Christensen/Matzler 2013, S. 6f.).
Mithilfe der Studie soll untersucht werden, warum manche Trendsäulen der Digitalisierung Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle disrumpieren, während andere eine evolutionäre Entwicklung bewirken – damit wird der zweiten Forschungsfrage Rechnung getragen.
Ausgehend von den beiden Forschungsfragen wird eine Leitthese formuliert, die den konzeptionellen Rahmen für die Ausgestaltung der Untersuchung bildet:
Der Megatrend der Digitalisierung hat disruptive Auswirkungen auf die Unternehmen in Deutschland, ihre Strategien und Geschäftsmodelle.
Auf Basis der Leitthese wird ein Thesengerüst aufgebaut, in dem für jede Trendsäule der Digitalisierung jeweils eine Hypothese sowie mehrere untergeordnete Thesen gebildet werden (siehe hierzu Abb. 2).
Abbildung 2: Thesengerüst im Rahmen des Forschungsdesigns
Quelle: Eigene Darstellung
Die Hypothesen der einzelnen Säulen (2. Ebene) operationalisieren die übergeordnete Leitthese, sodass die Untersuchung einzelner Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmen möglich wird. Jede Hypothese drückt aus, ob hinter einer Trendsäule eine disruptive oder evolutionäre Wirkung vermutet wird.
Die untergeordneten säulenspezifischen Thesen (3. Ebene) basieren auf einer, der Studie vorangestellten, Inhaltsanalyse aktueller, zukunftsorientierter Literatur. Sie dienen als Grundlage für die Formulierung spezifischer Fragen für den Interview-Leitfaden. Durch dieses Vorgehen wird gewährleistet, dass aktuelle Trends sowie unterschiedliche Facetten der Digitalisierung bei der Befragung berücksichtigt werden.
Das gesamte Thesengerüst ermöglicht die systematische Überprüfung der übergeordneten Leitthese: Über die Beantwortung der Fragen, die aus den säulenspezifischen Thesen hervorgehen, lassen sich die Hypothesen pro Säule verifizieren bzw. falsifizieren. Deren Überprüfung lässt letztlich die Validierung der Leitthese zu.