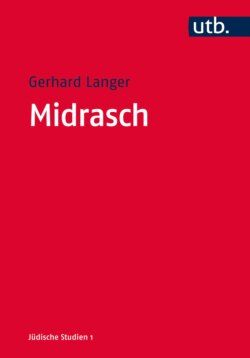Читать книгу Midrasch - Gerhard Langer - Страница 9
5. Midraschdefinitionen jüngerer Zeit
ОглавлениеIn der Forschung der letzten Jahrzehnte findet sich eine ganze Reihe von Interpretationen und DefinitionenInterpretationen und Definitionen von Midrasch, die nicht selten als Widerschein wissenschaftlicher Zeitströmungen zu lesen sind (vgl. den Überblick bei Bakhos, Matters; Grohmann, Aneignung, S. 107–129). In der Vielzahl der Definitionen ist zu bemerken, dass manche sich stärker auf die literarische Struktur, andere mehr auf die aktualisierende Funktion, nicht selten gepaart mit der Bedeutung für die religiös-kulturelle Entwicklung des Judentums konzentrieren. Im Folgenden seien einige Ansätze kurz beschrieben. Gewisse Übereinstimmung herrscht in der Funktion des Midrasch für die Gemeinde und die GottesbeziehungFunktion des Midrasch für die Gemeinde und die Gottesbeziehung. Diese wurde bereits von Renée Bloch (Midrash) oder Roger Le Déaut (A-propos) betont. Auch Addison Wright (Literary Genre) hob die Bedeutung von Midrasch als religiöse Schrift hervor. Großen Einfluss übte Isaak HeinemannIsaak Heinemann (Darche ha-Aggada) mit seiner maßgeblich betonten Funktion der Haggada als „schöpferische Geschichtsschreibung“ und „schöpferische Philologie“ aus. Daran orientiert formuliert Ithamar GruenwaldIthamar Gruenwald, dass Midrasch den Versuch darstelle, „Schrift als die normative Konstante des Judentums zu behaupten“ (Midrash, S. 6), über Brüche und Krisen hinweg |13|und als intellektuelle Herausforderung, die Mut und religiöse Sensibilität verlangt. In seinem Bemühen, die „mentale Haltung oder Disposition“ zu beschreiben, die er mit dem Stichwort „midrashic condition“ verbindet, greift er auf Heinemanns Konzept zurück und spricht davon, dass nicht der bloße Akt des Verstehens zähle, sondern die Schaffung von Bedeutung, die mit den Bibelversen verbunden sei. Gruenwald gesteht den Midraschautoren großen Spielraum in der Macht über den Text zu, die jedoch durch die Tradition beschränkt sei, die auf die göttliche Inspiration der Schrift und grundlegende moralische Haltungen sowie die Bedeutung des Kultes Wert lege.
Uneinigkeit herrscht darüber, ob Midrasch eher Ein literarisches Genre oder eine Methode des Textzugangesein literarisches Genre oder eine Methode des Textzuganges ist. Addison WrightAddison Wrights Definition geht von einem literarischen Genre aus, das aktualisierende Bedeutung hat. Schrifttext und Kommentar müssen dabei getrennt sein:
Als Name einer literarischen Gattung bezeichnet das Wort Midrasch eine Komposition, die einen Schrifttext der Vergangenheit verstehbar, gebrauchsfähig und relevant für die religiösen Bedürfnisse einer späteren Generation zu machen sucht. Es ist so eine Literatur über eine Literatur […]. Ein Midrasch ist immer explizit oder implizit in den Kontext des biblischen Texts gestellt, den er kommentiert. (Literary Genre, S. 143)
Midrasch ist demnach Auslegung von Schrift um der Schrift willen. Das Genre Midrasch beschränkt sich nach Wright aber nicht nur auf jüdische Texte, sondern kann beispielsweise auch auf pagane ägyptische Prophetentexte mit ähnlicher Struktur angewendet werden. Auch christliche Rezeption der hebräischen Bibel lässt er als Midrasch gelten. Andere Schriften, die Text und Kommentar aus seiner Sicht zu wenig trennen, schließt er jedoch vom Genre Midrasch aus.
Lieve TeugelsLieve Teugels diskutiert in ihrem Buch Bible and Midrash: The Story of „The Wooing of Rebekah“ (Gen. 24) (vgl. auch ihren Beitrag Midrash in the Bible) Ansätze von Addison Wright, Robert Le Déaut, Daniel Boyarin, Michael Fishbane, Jacob Neusner und Gary Porton und stützt sich auf die formanalytische Definition Arnold GoldbergArnold Goldbergs, die sie übernimmt und erweitert. Goldberg hatte in mehreren Aufsätzen unterstrichen, dass der Begriff Midrasch ausschließlich für die rabbinische Literatur zu verwenden sei und von seiner Form bestimmt werden müsse. Demnach ist Midrasch immer Erläuterung des zitierten Bibeltextes, des Lemmas (Lemma der Offenbarungsschrift). Der Midraschsatz besteht aus Lemma, der Operation und dem Ergebnis (Dictum), schematisch „L“ „on“ → „D“ oder „D“ ← „on“ „L“. Im Midraschschriften vorkommende Formen wie Maschal oder Maʿase (dazu mehr unter VI) |14|sind kein Midrasch, wohl aber tritt Midrasch in Mischna oder den Talmudim auf.
Teugels diskutiert auch die kritischen Ergänzungen Goldbergs durch Philip Alexanders Hinweis auf die „Methoden“ (Midrash and the Gospels) und sieht neben den formalen Kriterien für Midrasch ein Alleinstellungsmerkmal in der Mündlichkeit der Überlieferung und der Annahme der göttlichen Offenbarung. Midrasch ist ihrer Definition nach beschränkt auf „rabbinische Interpretation von Schrift, welche die lemmatische Form trägt“„rabbinische Interpretation von Schrift, welche die lemmatische Form trägt“ (Bible and Midrash, S. 168).
Und weiter:
Nach der Diskussion über die Natur des rabbinischen Midrasch möchte ich die Verwendung des Begriffes „Midrasch“ für jegliche Literatur außerhalb des rabbinischen Korpus zu verhindern suchen. Mein Hauptgrund besteht darin, dass es besser ist, gleichwertige aber unterschiedliche Dinge zu vergleichen, als sie alle auf einen Haufen zu werfen und damit zu enden, dass man nichts mehr zum Vergleichen hat. Wenn wir Bibelauslegung innerhalb der Schrift (innerbiblische Exegese), die Auslegung des Alten Testaments im Neuen Testament, die Bibelauslegung in Qumran, in der Literatur des Zweiten Tempels, bei Philo etc., all diese unterschiedlichen Arten von Bibelauslegung getrennt betrachten, haben wir etwas zu vergleichen. Wenn wir alle diese Formen der Bibelauslegung „Midrasch“ nennen, machen wir die Dinge unklar. (Bible and Midrash, S. 169)
Dieses pragmatische Argument hat einiges für sich und wurde z.B. 2006 vom „international research project for the study of the Rewritten Bible“ übernommen. Erkki Koskenniemi und Pekka Lindqvist halten im ersten Band der akademischen Reihe Studies in Rewritten BibleStudies in Rewritten Bible fest,
dass das Wort Midrasch für frühe jüdische Exegese verwendet oder besser auf rabbinische Exegese beschränkt werden soll, dabei z.B. der kompakten Definition von Lieve Teugels folgend. (S. 18)
Die Goldbergschülerin Rivka UlmerRivka Ulmer hat 2006 in einem Beitrag mit dem Titel The Boundaries of the Rabbinic Genre Midrash ebenfalls jegliche Verwendung des Begriffes Midrasch außerhalb des rabbinischen Kontextes abgelehnt. Midraschim seien „nachbiblisch und auf den biblischen Text […] bezogen, bedienen sich typischerweise namentlich genannter Ausleger (der Rabbinen) und spezifischer Auslegungsregeln (der Middot)“ (Boundaries, S. 63). Ulmer sieht Midrasch vor allem als Ausdruck der rabbinischen Theologie und weniger als exegetische Methode. Midrasch als „literarisches Genre“ ist für sie durch die soziale Gruppe, die es schafft, definiert. Mittelalterlicher „Midrasch“ sei durch eine Schwächung der Form gekennzeichnet. Ulmer betont die Voraussetzungen des Midrasch. Die Gegenwart der Rabbinen bestimmt den Kontext der Schrift, |15|auch wenn die Bedeutung der Schrift noch viele weitere Möglichkeiten beinhalten mag.
Teugels oder Ulmers Definition von Midrasch ist klar und eng umrissen: Da er durch die Hermeneutik und die Theologie der Rabbinen bestimmt ist, kann es keine außerrabbinischen Midraschim geben.
Gegenüber einem Verständnis von Midrasch als literarischem (rabbinischem) Genre wurde in verschiedenen Ansätzen dieser stärker als Eine Methode des Textzugangeseine Methode des Textzuganges begriffen. Deutlich haben dies Avigdor Shinan und Yair Zakovitch so zu beschreiben versucht:
Midrasch ist eine Methode des Textzugangs – abgeleitet aus einer religiösen Weltsicht und durch verschiedene Erfordernisse motiviert (historische, moralische, literarische etc.) –, die es ermöglicht und ermutigt, viele und sogar sich widersprechende Bedeutungen im Text zu entdecken, während die Intention des Autors oder der Autoren sich als schwer fassbar erweist. (Midrash, S. 258)
In diesem Zusammenhang sind die 1983 in der Zeitschrift Prooftexts erstmals erschienenen Two Introductions to MidrashTwo Introductions to Midrash von James KugelJames Kugel zu nennen. Er versteht Midrasch als „ein interpretatives Verfahren, einen Weg, einen heiligen Text zu lesen“ (Two Introductions, S. 91). Damit definiert er Midrasch als eine Hermeneutik, die er sowohl in den Targumim, dem qumranischen Genesis Apokryphon als auch dem mittelalterlichen Sefer ha-Jaschar wiederfindet, in Predigten, Gebeten und Gedichten, und natürlich im rabbinischen Midrasch, in Mischna und Gemara, „denn im Grunde ist Midrasch nichts Geringeres als der Grundstein des rabbinischen Judentums, und dabei so divers wie die rabbinische Kreativität selbst“ (S. 92). Kugel erkennt selbst, dass die weite Deutung von Midrasch als „Recherche, welche die Schrift interpretiert und in allen Arten von Kontexten Ausdruck findet“ (S. 92), zu breit angelegt ist, und widmet sich danach dem konkreten Vorgehen. Dazu gehöre die Erklärung von Problemen in den biblischen Versen, genauer in einzelnen Worten des biblischen Verses, etwas, das später Boyarin mit dem „filling of gaps“ bezeichnen wird. Nach Kugel ist Midrasch am Vers, nicht an größeren biblischen Einheiten orientiert, wobei der Kontext der Auslegung die ganze Schrift, der Kanon, ist, „eine Situation vergleichbar bestimmten politischen Organisationen, in denen es keine eigenen Staaten, Provinzen oder ähnliches gibt, sondern nur das Dorf und das Königreich“ (S. 93). Diese Interpretationen einzelner Verse seien unabhängig von größeren Einheiten zirkuliert, ähnlich wie moderne Witze, „und wie Witze wurden sie überliefert, modifiziert und verbessert, als sie […] durch das Lernen mit dem Bibeltext selbst überliefert wurden“ (S. 95).
|16|Daniel BoyarinDaniel Boyarins 1990 erschienene Studie Intertextuality and the Reading of MidrashIntertextuality and the Reading of Midrash greift Kugels Analyse positiv auf und ist deutlich von der Literaturtheorie der Zeit und ihren Proponenten wie Roland Barthes, Julia Kristeva oder Mikhail Bakhtin bzw. von der Intertextualitätskonzeption von Michael Riffaterre beeinflusst. Im Zentrum steht die Schrift als ein Dokument, das auf vielfältige Weise (polyvalent) ausgelegt werden kann und ausgelegt wurde. Im ersten Kapitel mit dem Titel Toward a New Theory of Midrash kritisiert Boyarin Heinemanns Ansatz der kreativen Geschichtsschreibung und will Midrasch
zuallererst als Lesen verstehen, als Hermeneutik, als in der Interaktion der rabbinischen Leser mit einem heterogenen und schwierigen Text begründet, der für sie sowohl normativ als auch göttlichen Ursprungs war. (Intertextuality, S. 5)
Boyarin richtet sich hier gegen eine Position der Auslegung von Midrasch, die dessen hermeneutisches Grundanliegen zuallererst und vorrangig als Reaktion auf zeitgenössische Probleme und Zustände versteht.
Auch Jacob NeusnerJacob Neusner, der in seinen zahlreichen Publikationen immer wieder auch die Bedeutung des Midrasch thematisiert (Funktion, Struktur, Theologie etc.), was in diesem Buch nur ansatzhaft aufgezeigt und ihm damit auch nur in Teilen gerecht werden kann, neigt in seiner Deutung zu einem Verständnis, wonach Midrasch „einem Zweck dient, der nicht durch die Schrift, sondern durch den Glauben bestimmt ist, der sich in Entwicklung befindet und dabei ist, sich zu artikulieren“ (Midrash: An Introduction, S. xi). Für den Midrasch forme die Schrift ein „dictionary“, das zahlreiche Möglichkeiten der Auslegung biete oder eine Reihe von Farben, die für ein Gemälde zur Verfügung stehen.
Nach Boyarin ist Midrasch demgegenüber in erster Linie einmal als „Lesen eines Textes“ ernst zu nehmen, was er näher als „Interaktion der rabbinischen Leser mit einem heterogenen und schwierigen Text“ bestimmt. Midrasch setzt die literarische Aktivität als Reflexivität und Interpretation, die innerhalb der Bibel beginnt, fort und vergegenwärtigt die biblische Vergangenheit. Die Texte reflektieren also die historischen Entstehungsbedingungen einerseits, wie sie andererseits auch auf diese selbst zurückwirken. Zentrales Stichwort der Midraschanalyse Boyarins ist hier „Intertextualität“„Intertextualität“, deren Kennzeichen, ganz im Kontext postmoderner Literaturtheorie, von der bewussten und unbewussten Zitation vorhandener Texte und Diskurse bestimmt ist. Biblische Texte, und um sie geht es ja im Midrasch, werden aufeinander bezogen, stehen im beständigen Dialog. Die Rabbinen haben die Welt durch die Brille |17|der Bibel betrachtet, genauer gesagt durch „ihre ideologisch gefärbte Brille“ (Intertextuality, S. 15), denn kulturelle Codes bestimmen, bewusst oder unbewusst, die Erzeugung wie das Verstehen von Texten. Die intertextuelle Lesepraxis der Rabbinen baut auf innerbiblischer Lesepraxis auf. Der Bereich der Interpretation ist der biblische Kanon, in dessen Licht eine einzelne Stelle interpretiert wird. Daher ist Midrasch im Grunde „radikales intertextuelles Lesen des Kanons“ (S. 16), wobei die sich beim Lesen ergebenden Fragen, die so genannten gaps, eine zentrale Rolle spielen, welche nun gefüllt werden. Im Prinzip kann Midrasch daher als intertextuelles – also textlich dialogisches – Erklären von Unklarheiten, Lücken, offenen FragenErklären von Unklarheiten, Lücken, offenen Fragen, also der gaps verstanden werden.
Es wird etwas später noch zu zeigen sein, dass schon innerbiblisch eine große schöpferische Freiheit bestand, vorhandenes Traditionsgut weiterzuentwickeln und neuen Bedingungen anzupassen. Und es wird gezeigt werden, dass die rabbinischen Midraschim sehr wohl ein Gespür für die (Lösung der) im Bibeltext inhärenten Problemstellungen hatten. In den halachischen Midraschim (dazu mehr unter IX) zeigten sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen im Blick auf die Verwendung von außerbiblischer Halacha. Doch bleibt auch hier grundsätzlich zu betonen, dass das Ziel am Ende die Übereinstimmung mit der biblischen Botschaft ist.
Eine der bis heute am häufigsten zitierten Definitionen von Midrasch ist die von Gary PortonGary Porton aus seinem wichtigen Aufsatz Defining Midrash, die nach einem Bekenntnis zu einer notwendigen Klärung der „literarischen Aspekte“ folgt. Midrasch sei demnach
eine Literaturgattung, mündlich oder schriftlich, die in direkter Beziehung zu einem festgelegten, kanonischen Text steht, der vom Midraschist und seiner Hörerschaft als autoritatives und geoffenbartes Wort von Gott betrachtet wird, und in der dieser kanonische Text explizit zitiert oder klar auf ihn hingewiesen wird (S. 62; deutsch in: Midrasch: Die Rabbinen und die Hebräische Bibel, S. 134).
Vielfach wurde die Unschärfe und Unklarheit dieses Ansatzes kritisiert, vor allem in Bezug auf den Begriff „kanonisch“ und den expliziten Bezug auf die Einstellung der Leserinnen und Leser/Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann man diese erfragen? Unabhängig davon eröffnet Porton eine relativ weite und offene Deutung, die auch Targumim, Rewritten Bible (Liber Antiquitatum Biblicarum, Genesis Apokryphon, Jubiläenbuch etc.) sowie die Pescharim von Qumran umfasst, auch wenn diese sich nach Porton in einer Reihe von Punkten von den rabbinischen Midraschim unterscheiden. In Definitions of Midrash hat er 2005 gleich zu Beginn des Artikels die Definition etwas geschärft:
|18|Rabbinischer Midrasch ist eine von den Rabbinen verfasste/zusammengestellte (composed) mündliche oder schriftliche Literatur, die ihren Ausgangspunkt in einem fixierten kanonischen biblischen Text hat. Im Midrasch wird dieser Originaltext, der als geoffenbartes Wort Gottes durch den Midraschisten und sein Publikum angesehen wird, explizit zitiert oder deutlich darauf angespielt. In der wissenschaftlichen Literatur, wie im Judentum selbst, wird der Begriff Midrasch auf drei verschiedene Arten verwendet: 1) bezogen auf eine einzelne exegetische Perikope […], 2) um die rabbinische Methode der Bibelauslegung zu beschreiben […] und 3) um die Zusammenstellungen der rabbinischen exegetischen Darlegungen zu bezeichnen, die in der Spätantike produziert wurden. (Definitions, S. 520)
Nach Porton besteht das Hauptanliegen des Midrasch, als eine von mehreren intellektuellen Auseinandersetzungen der Rabbinen mit der Schrift, darin, die enge Verbindung zwischen der rabbinischen Welt und der Welt der Tora darzulegen. Dazu kommt:
Die Rabbinen näherten sich der Tora mit all ihren intellektuellen und imaginativen Kräften an. Die Tora war ihr heiligstes Gut, und sie waren die Gestalter, Erhalter und Leiter dieser Kultur. Wenn die Tora auf das gesamte Leben einer Person Einfluss nimmt, dann sollten die Rabbinen fähig sein, sich ihr mit all ihrem Sein, mit ihren intellektuellen und rationalen Fähigkeiten wie auch mit ihrer imaginativen und spielerischen Seite anzunähern. Nur Midrasch legt Zeugnis von den gesamten intellektuellen Möglichkeiten des Verstandes und der Vorstellungskraft der Rabbinen ab. Je vertrauter ein Gelehrter mit der Tora wurde, der ultimativen Quelle seiner Heiligkeit, umso mehr Autorität und Status erhielt er innerhalb der rabbinischen Klasse und letztlich unter der jüdischen Bevölkerung. Fähig zu sein, der schriftlichen Tora neue Bedeutungen zu entlocken, oder die Möglichkeit zu haben, ihre explizite und implizite Bedeutung zu erläutern, erhöhte einen Rabbi unter seinen Kollegen. Midraschische Befähigung bestätigte und unterstützte den Anspruch des Rabbis, ein Rabbi zu sein. Seine Fähigkeit, mit der heiligen schriftlichen Tora zu arbeiten, kennzeichnete ihn als heiligen Mann. (Definitions, S. 526–527)
In Anbetracht dieser Forschungsgeschichte und der Definitionsversuche empfiehlt es sich, zwischen Midrasch/Midraschim als Textsorte/Schrift/Dokument und Midrasch als hermeneutischem Verfahren und auch Genre zu unterscheiden und dabei die Trägergruppe im Auge zu behalten. Auf der Basis der eben dargelegten Definitionsversuche und grundlegenden Beobachtungen zum Midrasch ist die Frage „Was ist Midrasch?“ in der Folge ausführlicher zu beantworten.