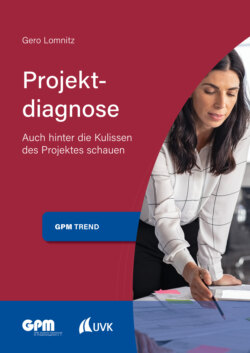Читать книгу Projektdiagnose - Gero Lomnitz - Страница 15
Оглавление3 Auftragsklärung
3.1 Initiierung – Vorgeschichte der Diagnose verstehen
Die Arbeit der Diagnostiker:innen beginnt normalerweise vor dem offiziellen Start der Diagnose. Schon im Vorfeld können wichtige Informationen über die Hintergründe der Diagnose, die Erwartungen und Interessen der Beteiligten gesammelt werden. Versuchen Sie sich ein möglichst genaues Bild über den Entstehungsprozess zu machen. Warum soll eine Diagnose durchgeführt werden, wer verspricht sich was davon? Wer ist am Diskussionsprozess beteiligt? Kontextklärung spielt eine große Rolle, dazu gehört auch zu erfahren, warum das Management gerade Sie als mögliche Diagnostiker:in ausgewählt hat. Ist es Ihr guter Ruf? Schätzt man Sie, weil Sie die Probleme gründlich erfassen und deutlich kommunizieren? Traut man es Ihnen vor allem deshalb zu, weil Sie ein Projektmanagement Zertifikat erworben haben? Sind sie empfohlen worden, wenn ja, von wem? Nutzen Sie, falls möglich, Gespräche mit der Projektleitung, den Projektmitarbeiter:innen, dem Sponsor bzw. der Sponsorin des Projektes und mit Linienmanager:innen, um sich einen ersten Eindruck über die Situation des Projektes und die Erwartungen an die Diagnose zu verschaffen. Der Kontakt mit dem Linienmanagement darf nicht unterschätzt werden, denn sie können in unterschiedlicher Weise in das Projekt involviert sein, sei es als Ressourcenmanager:in, als interne Lieferant:innen für das Projekt oder weil ihre Organisationseinheiten vom Projektverlauf oder den Projektergebnissen betroffen sind. Das gilt vor allem bei Restrukturierungs- oder Prozessoptimierungsprojekten. Wie auch immer, Führungskräfte können die Diagnose fördern, aber auch blockieren.
Es gibt unterschiedliche Anlässe und Initiator:innen für Projektdiagnosen. Je besser Sie den Anlass und die Akteure kennen, desto besser kann die Auftragsklärung gelingen. Nach meiner Erfahrung gibt es drei typische Gründe, warum eine Diagnose durchgeführt werden soll:
Die Auftraggeber:innen des Projektes sind mit den Zwischenergebnissen nicht zufrieden, weil die geplanten Meilensteine nicht erreicht werden. Wiederholt hören sie Klagen über die schlechte Zusammenarbeit im Projektteam, über unklare Zuständigkeiten oder über die mangelnde Unterstützung von Linienmanager:innen. Sie versprechen sich von der Diagnose zuverlässige Informationen über die Ursachen der Probleme mit konkreten Empfehlungen.
Im Steering Committee bestehen seit geraumer Zeit unterschiedliche Meinungen über die Ergebnisse und den Verlauf des Projektes. Die Bereichsleiterin R&D (Research & Development) ist mit dem Projektverlauf im Großen und Ganzen zufrieden, während ihre Kollegen aus dem Marketing und der Produktion immer wieder auf die Schwachstellen im Projektmanagement hinweisen. Dabei wird mit dem Finger auf fehlende Abstimmungen, schlechte Planung und mangelnde Verbindlichkeit der Projektbeteiligten hingewiesen, wobei sich die Kritik vornehmlich auf das R&D Management bezieht. Dagegen sieht die Bereichsleiterin R&D die Ursachen vor allem beim Marketing, weil die Projektziele immer wieder geändert werden. Die Diskussion ist geprägt von Schuldzuweisungen und Unterstellungen. Die Geschäftsleitung hat entschieden, diese Problematik mit Hilfe einer Diagnose nachhaltig in den Griff zu bekommen, zumal ähnliche Diskussionen auch in anderen Projekten aufgetreten sind.
Interessenkonflikte zwischen Abteilungen und widersprüchliche Entscheidungen von Führungskräften erschweren die Arbeit des Projektteams erheblich. Projektmitarbeiter:innen stehen im Spannungsfeld zwischen Mitarbeit im Projektteam und den Vorgaben ihrer Linienmanager:innen. Der Projektleitung ist es nicht gelungen, diese Probleme im Team zu lösen und auch Gespräche mit Führungskräften haben nichts gebracht. Die Projektleitung hat die Situation mit dem Head of Project Portfolio Management und dem eigenem Linienmanagement besprochen mit dem Ergebnis, den Projektsponsor von der Notwendigkeit einer Projektdiagnose zu überzeugen.
3.1.1 Worauf sollten Diagnostiker:innen im Vorfeld achten?
Einfache Fragen können Ihnen helfen, die Ausgangssituation der Projektdiagnose besser zu verstehen.
Warum wird eine Projektdiagnose erwogen? Befindet sich das Projekt in einer besonderen Schieflage oder gibt es andere Gründe?
Sollen fachliche, technische Probleme untersucht werden oder geht es primär um die Analyse des Projektmanagements, wie die Zusammenarbeit im Team, Klarheit der Ziele, schlechte Planung oder um die Entscheidungsprozesse im Steering Committee? Projektdiagnostiker:innen sollten frühzeitig die Erwartungen der Beteiligten erfassen und einordnen. Dadurch wird die eigentliche Auftragsklärung erleichtert.
Gibt es Themen, die besonders hervorgehoben werden? Werden diese nur von einer Person genannt oder von mehreren? Stammen sie aus nur einer Organisationseinheit oder aus verschiedenen?
Gibt es Themen, die man nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt? Wozu werden Ihnen diese Themen mitgeteilt? Möglicherweise möchte man Sie in eine bestimmte Richtung lenken oder zum Bündnispartner machen. Nehmen Sie solche Aussagen aufmerksam wahr, doch verlieren Sie nicht Ihre Neutralität.
Gab es bereits Maßnahmen, um die Situation des Projektes zu verbessern? Wenn ja, warum führten sie nicht zum Erfolg?
Wer ist Initiator:in der Diagnose? Welchen Einfluss haben diese Personen?
Welche Akteure aus welchen Organisationseinheiten sind an der Entscheidung beteiligt, ob eine Projektdiagnose durchgeführt werden soll?
Welche Organisationseinheiten und Personen sind nicht einbezogen? Besteht kein Interesse an der Diagnose oder werden sie gezielt ausgegrenzt?
Wird die Meinung der Projektleitung zur Diagnose gehört oder wird über ihren Kopf hinweg entschieden? Wenn ja, warum?
Sind die Projektbeteiligten, insbesondere die Projektleitung und das Projektteam darüber informiert, dass über eine Diagnose nachgedacht wird?
Achten Sie in ihren Gesprächen nicht nur auf den Inhalt, sondern auch darauf, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Halten die Gesprächspartner:innen eine Diagnose überhaupt für notwendig oder stehen sie dieser Idee eher ablehnend gegenüber? Ironie, Schuldzuweisungen, zweifelndes Kopfschütteln oder negative Kommentare über das Projekt, die Projektleitung oder den Sponsor können Ihnen wertvolle Hinweise liefern. Nehmen Sie solche Informationen aufmerksam wahr, denn sie können Ihnen für die Auftragsklärung und auch im weiteren Verlauf der Arbeit wertvolle Dienste leisten. Machen Sie sich zeitnah Notizen. Im Kern geht es dabei um die Frage, wer die Diagnose unterstützen bzw. blockieren kann.