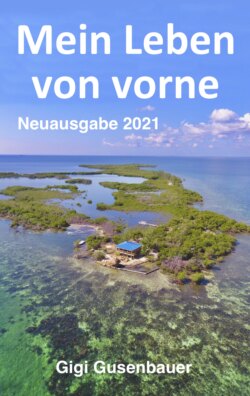Читать книгу Mein Leben von vorne - Gigi Gusenbauer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 LEA, MEIN STERN AM FIRMAMENT Rückblick 1984
ОглавлениеBis ich dreizehn Jahre alt war, hatte ich eine unglaublich schöne und perfekte Kindheit. Aufgewachsen in dem idyllischen kleinen Vorort am südlichen Rande Wiens, der Südstadt. Eine Insel für Kinder. Keine Straßen innerhalb der Siedlung, nur eine Verbindungsstraße, die wie ein Kreis im Inneren der Ortsgrenze verlief. Egal wo man sich aufhielt, es gab immer nur eine einzige Straße mit beruhigtem Verkehr zu überqueren. Für uns Kinder war der ganze Ort ein Spielplatz. Mit ebenso vielen Grünflächen wie Wohnflächen, Feldern am Rand und sogar das Areal vor der modernen Kirche war ein richtiger Abenteuer-Spielplatz. Wenn ich das jetzt so niederschreibe, beschleicht mich ein interessanter Gedanke: „eine Insel für Kinder“. Das war nicht bewusst so formuliert, es war völlig unbewusst geschrieben. Und ich fühlte mich dort vollkommen sicher. Gibt es diesbezüglich eine tiefere Bedeutung für meine Flucht auf eine Insel, die mir gar nicht klar war?
Meine Mutter hatte, kurz bevor ich geboren wurde, ihre Sportkarriere beendet. Sie war Olympionikin, Weltrekordhalterin in der Leichtathletik und jeder kannte sie. Die Südstadt war zudem Heimat vieler Top-Sportler. Für mich war es ganz normal, dass die Freunde meiner Eltern zu der Weltelite des Spitzensportes gehörten. Die Olympiaanlage der Südstadt war daher mein zweiter Spielplatz und ich begann von meinen ersten Schritten an, sämtliche Sportarten zu erlernen. Die Volksschule in der Südstadt liebte ich ebenfalls, alle meine Klassenkameraden waren von Windeljahren an meine Freunde. Wir kannten uns wie Familienmitglieder und gingen in dem jeweiligen Zuhause des anderen ein und aus.
Als ich dann zehn Jahre alt wurde, war es vorbei mit der Volksschule. Vorbei mit dem beschützen Leben innerhalb unserer Siedlungsgrenze. Vorbei mit dem Überqueren einer einzigen Straße und hinaus in die wilde und gefährliche Welt. Veränderungen waren schon damals nicht mein Ding. Ich hasste es, wenn sich irgendetwas ändern musste. Als meine Eltern das Sofa im Wohnzimmer umstellten, war ich tagelang betrübt, denn es gefiel mir so, wie es vorher war. Auch wenn sich nach dem Umstellen mehr Platz bot, aber das Sofa war vorher mit Sicherheit tausendmal kuscheliger. Man kann sich also vorstellen, was eine neue Schule für mich bedeutete. Nicht mehr eine einzige Lehrerin, sondern einen Lehrer für jedes Fach. Neue Schulkameraden, von denen ich kaum jemanden kannte. Zum Glück hatte ich ein paar Freunde aus der Volksschule in meiner neuen Klasse. Wir hatten uns bemüht, zusammen zu bleiben. Es stand fest, uns würde nie etwas trennen, wir waren eine eingeschworene Truppe seit unserer Krabbelzeit.
Ich lernte also, wie ich mit dem Fahrrad von der Südstadt bis nach Mödling fahren konnte. Dennoch hatte ich unendlich viel Angst. Aber noch viel mehr Angst, als um mich, machte ich mir um meine Mutter, denn sie war stets besorgt um mich. Handys gab es damals noch nicht, und so rief ich sie am ersten Schultag von einer Telefonzelle aus an, um ihr mitzuteilen, dass ich gut in der Schule angekommen war. Die neue Schule war angsteinflößend. So groß, so unendlich viele Kinder und junge Erwachsene. Aber ich konnte es nicht ändern, weglaufen ging nicht, ich musste da durch. Vor meinem ersten Schultag hatte ich mehrere Nächte Albträume, meine Klasse nicht zu finden. In meinem Traum kam ich immer zu spät, alle Kinder blickten mich an und lachten mich aus. Bereits als Kind musste ich sehr schnell weinen. Alles war mir peinlich, alles war mir unangenehm, „nur nicht auffallen“ war in meinem Blut gespeichert. Und eine fast schon schädliche Demut vor jedem anderen. Obwohl meine Mutter so eine berühmte Sportlerin war, war sie ebenfalls die Demut in Person. Das hatte ich entweder geerbt oder durch Nachahmen des Verhaltens übernommen. Jedenfalls war ich programmiert, dass alle anderen wichtiger waren, als ich. Und dass ich, so gut es ging, den anderen alles recht machen sollte, um keine Konflikte zu erzeugen. Niemand sollte auf mich böse sein.
Überraschenderweise war ich entgegen meinen schlimmen Träumen nicht zu spät für den Empfang in der neuen Schule. Auch heute noch bin ich eher dreißig Minuten zu früh an einem Treffpunkt, als auch nur eine Sekunde zu spät. Das wiederum dürfte von meinem Großvater stammen, er war genauso. Es gab einen großen Sammelplatz in der neuen Schule, dem Bundesrealgymnasium Bachgasse in Mödling. Die Lehrer nannten es Aula, für mich klang das wie eine Wortmischung aus Aua und Eule. In der Aula gab es dann viele Lehrer mit Schildern, wo die jeweilige zugehörige Klasse gekennzeichnet war. Ich musste in die Klasse 1C und fand den Lehrer mit dem entsprechenden Schild, aber ich hatte noch immer Angst, dass mir ein Fehler unterlaufen sein könnte. Was, wenn ich mich in der Liste vertan habe? Und dann in der falschen Klasse sitze? Und alle mich auslachen? Ich würde vermutlich weinend nach Hause laufen und nie wieder in diese Schule zurückwollen. Ich folgte also dem Lehrer mit dem Schild 1C und neben mir gingen einige Schüler, die auch ziemlich verängstigt aussahen. Andere wiederum schienen absolut nicht beeindruckt zu sein, was da auf uns zukommen würde und sahen super cool aus. Dennoch, offensichtlich war ich nicht der einzige, dem der Umstieg in eine neue Schule etwas Angst bereitete.
In der Klasse angekommen, nahmen wir dann alle einen Platz ein, natürlich setzte ich mich neben meinen besten Freund. Dann begann der Lehrer alle Namen vorzulesen und jeder Anwesende musste sich melden. Erneut hatte ich Schweißausbrüche, ob der Lehrer hoffentlich meinen Namen auf der Liste hat. Und man nannte die Lehrer ja auch nicht mehr Lehrer, sondern Professor. Mein Klassenvorstand hieß Professor Pichler und war mein neuer Mathematik-Lehrer. Zu meiner allergrößten Erleichterung las er meinen Namen vor. Ich hatte auch bisher nur eine Frau als Lehrerin, aber Professor Pichler war mir von Anfang an sehr sympathisch. Er hatte eine recht hohe Stimme und einen lustigen Schnauzbart. Und er war unglaublich nett zu uns allen. Ich glaube, in den folgenden Jahren hatte ich kein einziges Problem mit ihm, ich mochte ihn sehr und hatte mich immer bemüht, alle Hausaufgaben korrekt zu machen. Zumindest in Mathematik. Als Professor Pichler die Namen aller Schüler vorlas, wurden wir gebeten, uns die jeweiligen Schüler anzusehen, die beim Aufrufen ihrer Namen die Anwesenheit bestätigten. Wir sollten auf diese Weise die Namen unserer neuen Klassenkameraden kennenlernen. Jeder hatte einen kleinen Pappkarton vor sich, den wir zu Stehkärtchen formten und unsere Namen darauf schrieben.
Ich sah also, wie man uns gebeten hatte, jeden an, der sich meldete. So viele neue Gesichter. Dicke, dünne, lustig aussehende, schräg aussehende, und dann plötzlich etwas, was für mich neu in meinem Leben war. Bumm, zack, direkt ins Herz. Ein Engel. Ein unfassbar süßer, schöner, wundervoller Engel. Innerhalb einer Sekunde war ich verliebt. Zum ersten Mal. Ich kannte das nicht. Ich hatte wohl keine wahrnehmbare Atmung mehr, war gleichzeitig hyperventilierend und begann wie verrückt zu schwitzen. Mein Blut pulsierte kochend durch die Adern, mein Kopf summte und vibrierte vor Aufregung und zugleich war mir richtig schlecht aufgrund all dieser körperlichen und psychischen Reaktionen.
Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Buben und Mädchen miteinander „Schlimmes“ anstellen können, aber von dieser Sekunde an war mir klar, was Liebe auf den ersten Blick ist. Und was es bedeutet, mit dem einen und einzigartigsten Menschen sein Leben verbringen zu wollen. Mit zehn Jahren. Nach einer Sekunde Blickkontakt. Mein Engel hatte den wunderschönsten Namen des Universums, Lea. Zumindest von jetzt an war es der schönste Name. Sie war so unendlich süß. Blonde Haare, ein freches Grinsen, blaue Augen, offensichtlich auch Sportlerin und so schön, dass kein Disney-Film mit seinen Prinzessinnen mithalten konnte. Von nun an wollte ich nur noch in der Schule sein. Das nach Hause gehen bereitete mir einen fürchterlichen Abschiedsschmerz und ich konnte es kaum erwarten, am nächsten Tag wieder in der Klasse zu sein. Wann immer Lea krank war, war mein Herz gebrochen und der Tag ruiniert.
Bereits kurz nach dem Kennenlernen am ersten Schultag überreichte mir eine Freundin von Lea in deren „Auftrag“ einen Liebesbrief mit den poetischen Worten: „Zunge zeigen tut man nicht, und das heißt ich liebe Dich“. Diese Worte waren für mich mit meinen zehn Jahren Goethe und Shakespeare, verwirrten mich aber auch. Ich wusste nicht, ob dies nun eine Aufforderung sein soll, Lea die Zunge zu zeigen, um ihr damit zu signalisieren, dass ich auch in sie verliebt bin, oder war genau das Gegenteil gefragt, denn es hieß ja „tut man nicht“. Dieses bösartige Rätsel beschäftigte mich den ganzen Schultag bis zum Verlassen der Schule. In der Garderobe, wo wir alle brav unsere Schulsandalen gegen die Straßenschuhe zurücktauschten, traute ich mich dann, ihr in ebenso Shakespeare-artiger Poesie meine Liebe zu gestehen. Aus meinem Hals kratze sich ein verlegenes „ich Dich auch“ mit ungefähr null Komma null null zwei Sekunden Blickkontakt, was sich dennoch wie eine Ewigkeit anfühlte.
Und das war es. Meine große Liebe und es geschah all die darauffolgenden Jahre nichts mehr. Ich himmelte Lea an, ich vergötterte sie, aber ich traute mich in keiner Weise, dem Mädchen meiner Träume näher zu kommen. Maximal in kindischen Rangeleien, um sie berühren zu können, um dann davon die ganze Nacht zu träumen. Denn ich war ein Spätzünder und hatte keine Ahnung von Sex, auch in den darauffolgenden zwei Jahren nicht. Dennoch, damals glaubte ich noch an Gott, und jede Nacht betete ich dafür, Lea später heiraten zu dürfen. Da ich mir mit der ganzen Gottes-Kiste aber nicht so hundertprozentig sicher war, nutzte ich auch andere Gelegenheiten: Sternschnuppen, zerbrochene Spiegel, die Uhrzeit elf Uhr elf, Autokennzeichen mit gleichen Zahlen und Ähnlichem. Ich ließ wirklich keine Gelegenheit aus, meinen sehnlichsten Wunsch an das Universum zu richten.
Aus heutiger Sicht bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob das Ganze pathologisch war oder einfach wirklich nur eine dieser wenigen Fälle, wo man von unsterblicher Liebe sprechen kann. Auch in den folgenden Jahren handelten meine Träume von diesem Mädchen, stets jugendfrei, aber schon mit den Actionszenen meiner Lieblingsserien gespickt. Ich sprang für Lea aus fahrenden Autos, aus Zügen, aus Flugzeugen, ich ließ mich für sie erschießen, köpfen und ertränken. Ja, ich weiß, das alles klingt nicht besonders gesund, aber jede Nacht war für mich eine einzige Heldensaga, in der der Held die Prinzessin rettet und im Notfall auch sein Leben für sie gibt. Man kann den Grad dieser unschuldigen Liebe nicht anders beschreiben, es war so pur und echt, wie Liebe nur sein kann. Die Schmuddelhefte meiner Freunde waren für mich zu diesem Zeitpunkt noch abstoßend. Das waren für mich alles ekelhafte alte Frauen, meine Lea war eben ein Engel. Was ich noch nicht wusste, wie sich das Leben mit einem Schlag ändern kann. Ich hatte so eine unbelastete Kindheit, alles schien perfekt. Lea machte mein Leben perfekt, obwohl nie etwas zwischen uns passierte.