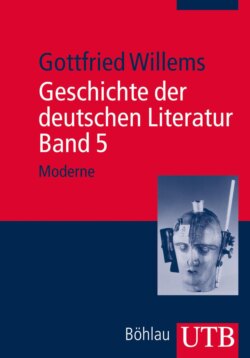Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 5 - Gottfried Willems - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Aufbruch in die Moderne
2.1 Programmatischer Modernismus
2.1.2 Kritik am Epigonentum
ОглавлениеDeutschland im Bann der Modernisierung
Daß sich die Generation, die in den achtziger, neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Bühne der Literatur betrat, einem solchen programmatischen Modernismus verschrieb, ist unschwer zu verstehen. Deutschland erlebte im letzten Drittel des Jahrhunderts, in den sogenannten Gründerjahren, einen Modernisierungsschub, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte; damals sprach man freilich noch nicht von Modernisierung, sondern von Fortschritt. Die Wissenschaften entwickelten sich auf eine Weise, die es ihnen erlaubte, mit einer ständig wachsenden Zahl von Entdeckungen und Erkenntnissen aufzuwarten und von ihnen aus an das Zeichnen eines neuen Welt- und Menschenbilds zu gehen. Zugleich schufen sie mit ihren Neuerungen die Grundlage für eine Ingenieurskunst, die auf breiter Front den Übergang zur technisch-industriellen Produktionsweise ins Werk setzte und damit nicht nur der Arbeitswelt, sondern sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein neues Gesicht gab. Ja es bildeten sich nun völlig neue Lebensräume heran, so zum Beispiel die Welt der modernen Großstadt. Und das Verkehrs- und Kommunikationswesen wuchs in eine Dimension hinein, die über den gewohnten Lebensräumen den Horizont der Globalisierung aufgehen ließ. Die ganze Welt schien eine andere zu werden, nur die Kunst schien so weitermachen zu wollen wie bisher, schien sich weiterhin in den Bahnen bewegen zu wollen, die ihr durch die Traditionen der abendländischen Kunst vorgezeichnet waren. [<<45]
Literatur zwischen Klassik und Moderne
Zwar gab es seit den fünfziger Jahren schon eine Literatur, die sich zum Realismus bekannte, und das war eine Literatur, die sich bewußt in der Gegenwart, auf dem Boden der modernen Welt angesiedelt hatte. Doch hatte man deshalb nicht aufgehört, auf die Goethezeit zurückzublicken, ja in gewisser Weise war deren Literatur präsenter denn je, galt sie inzwischen doch allgemein als klassisch, und das heißt: als unübertreffliches, in alle Zukunft unentbehrliches Vorbild aller wahren Kunst. Das aber bedeutete, daß das literarische Leben auch zu Zeiten des Realismus noch immer im Bann der abendländischen Kunsttradition stand. Die Literatur der Goethezeit hatte sich ja wesentlich in der Auseinandersetzung mit dieser Tradition entwickelt, hatte insbesondere noch immer auf den Dialog mit der Antike gesetzt; wer sich an ihr orientierte, blieb mithin ein Gefangener der Überlieferung.
Auch den Realisten selbst war es nicht wirklich gelungen, aus dem Bannkreis der Tradition herauszutreten, denn auch sie begriffen sich noch immer als „Epigonen“ der „Goetheschen Kunstperiode“ (Heine), als Nachgeborene, die den großen Vorgängern nicht das Wasser reichen könnten. Und das hatte zur Folge – so sahen es jedenfalls die Modernen – daß sie immerzu auf Kompromisse zwischen den Anforderungen der Gegenwart und der überkommenen Kunstübung ausgingen, Kompromisse, die, wie den Modernen schien, der Literatur nicht recht bekommen waren, faule Kompromisse, die es weder erlaubt hatten, der modernen Welt schonungslos ins Auge zu sehen, noch die Schönheit der alten Kunst wiederzubringen, so daß Wahrheit und Schönheit gleichermaßen auf der Strecke geblieben waren.
Abrechnung mit den „Epigonen“
Wenn sich die Modernen der ersten Stunde auch in vielem, fast in allem uneins waren – denn die einen gingen auf einen Naturalismus, die anderen auf einen Symbolismus aus – in einem stimmten sie überein: mit dem „furchtbaren Epigonenschweif der Antike“ (M. G. Conrad) sollte ein- für allemal Schluß sein (MM 143). Und Epigonen waren für sie fast alle Autoren der älteren Generation, einschließlich der Realisten – nicht völlig zu Unrecht, insofern sich die Realisten, wie angedeutet, als Epigonen der „Goetheschen Kunstperiode“ gesehen hatten und diese Selbsteinschätzung in ihren Werken ihre Spuren hinterlassen hatte, doch auch nicht ganz zu Recht, da sie sich sehr viel entschiedener und gründlicher auf die modernen Verhältnisse eingelassen hatten, als die Modernen wahrhaben wollten. Entschlossene [<<46] Revolutionäre pflegen sich freilich nicht lange mit derartigen Differenzierungen aufzuhalten.
„Epigonen“
Und richtend wird es euch entgegendröhnen:
„Verfluchte Schar von Gegenwartsverächtern!
Gewandelt seid ihr zwischen den Geschlechtern,
Den Vätern fremd und fremd den eignen Söhnen;
Ihr schwanktet kläglich zwischen den Verfechtern
Von neuen Farben, neuen eignen Tönen,
Von neuem Zweifeln, Suchen, Lachen, Stöhnen,
Und zwischen des Ererbten starren Wächtern.
In Unverstehen seid ihr hingegangen
Durch aller Stürme heilig großes Grauen,
Durch aller Farben glühend starkes Prangen
In taubem Hören und in blindem Schauen:
All Eines ist der Anfang und das Ende,
Und wo du stehst, dort ist die Zeitenwende!“ (HGW 1, 119)
Als Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) 1891, in dem gleichen Jahr, in dem Bierbaum mit seinem Prolog vor das Münchner Künstlerfest trat, dieses Gedicht schrieb, war er gerade einmal siebzehn Jahre alt – ein Wunderkind der modernen Literatur wie vor ihm etwa auch Rimbaud. Wie diesem erlaubte es ihm seine Jugend, besonders energisch mit der Vätergeneration abzurechnen. Wenn er deren Literatur als epigonal brandmarkt, so zielt damit auch er auf das Kompromißlerische ihrer Kunst, darauf, daß sie sich nicht zwischen dem „Ererbten“ und „eignen Tönen“ hätten entscheiden können und daß sie deshalb zwischen beiden Seiten auf eine Weise herumlaviert hätten, mit der sie weder der Kunst der Vergangenheit noch den Anforderungen der Gegenwart gerecht geworden wären, ja letztlich nicht mehr zum Ausdruck gebracht hätten, als daß sie beides nicht wirklich begriffen, beidem mit gleich großem „Unverstehen“ gegenübergestanden hätten. [<<47]
Demgegenüber fordert er eine Kunst, die sich klarmacht, daß sie an einer „Zeitenwende“ steht, und sich zu einem Ort gestaltet, an dem die Konflikte dieser „Zeitenwende“ ausgetragen werden, an dem ebensowohl das von den „Stürmen“ der Zeit ausgelöste „heilig große Grauen“ wie das „glühend starke Prangen“ der „neuen Farben“, ebensowohl das Bedrohliche wie das Faszinierende der neuen Zeit zur Geltung kommen. Mit dem halbherzigen Lavieren zwischen Altem und Neuem soll ein für allemal Schluß sein.
Von diesem Standpunkt aus muß sich freilich auch Hofmannsthals Gedicht kritische Fragen gefallen lassen. Es bedient sich der Form des Sonetts, also einer überkommenen Form, ja der Form, die der Inbegriff des Traditionellen in der Lyrik ist. Und überdies bewegt es sich dabei innerhalb des thematischen Spektrums, das durch die Tradition vorgezeichnet ist; denn spätestens seit der Romantik galt das Sonett als eine Form, die besonders geeignet für die Gestaltung kunst- und literaturtheoretischer Inhalte sei, und um eine Standortbestimmung von Kunst und Literatur geht es ja auch bei Hofmannsthal. Hat er seinen neuen Wein also nicht in einen alten Schlauch gegossen, so wie Bierbaum den seinen in dem Münchner Festprolog? Immerhin hebt sich die Form des Sonetts vorteilhaft von der seriellen Liedproduktion der Epigonen ab. Zudem ist sie inzwischen zum Ausgangspunkt einer eigenen Tradition der Moderne geworden, ist sie doch eine Lieblingsform von Baudelaire und seiner Schule gewesen. Wie immer man Hofmannsthals Griff zum Sonett deuten mag – so oder so wird deutlich, daß es gar nicht so einfach war, mit der Überlieferung zu brechen und den Salto mortale aus der abendländischen Kunsttradition in eine voraussetzungslose Gegenwart zu vollführen, jedenfalls nicht so leicht, wie es hochgemute Modernisierungsprogramme scheinen ließen.
Vom Epigonentum zu „neuen eignen Tönen“
Das vordringliche Anliegen der ersten Generation von modernen Autoren ist es, dem Epigonentum mit seinen faulen Kompromissen zwischen dem Alten und dem Neuen zu entkommen, und dies um so mehr, als die meisten von ihnen selbst als Epigonen, ja als Epigonen von Epigonen begonnen haben. Das gilt etwa auch für den Autor, der mit dem Skandalerfolg seines Dramas „Vor Sonnenaufgang“ 1889 dem Naturalismus in Deutschland zum Durchbruch verhalf, und mit ihm der modernen Literatur überhaupt, für Gerhart Hauptmann [<<48] (1862–1946),17 und es gilt für ihn sogar in besonderem Maße. Seine Anfänge zeigen ihn nicht nur als einen von vielen im „Epigonenschweif der Antike“; mit dem Drama „Germanen und Römer“ (1881/82) und dem Epos „Promethidenlos“ (1885) präsentiert er sich als ein Autor, der so sehr den Traditionen von Klassik und Romantik verhaftet ist, daß er selbst noch von den Errungenschaften des Realismus unberührt geblieben ist.
Höhe- und Wendepunkt dieses durch und durch epigonalen Start ups ist ein Studienaufenthalt in Rom, dem Mekka des Klassizismus, in den Jahren 1884/85. Hauptmann, der es zunächst sowohl mit der Bildenden Kunst als auch mit der Literatur versucht hat, hofft, auf dem „klassischen Boden“ (Goethe) Roms entscheidende Schritte in seiner Entwicklung als Bildhauer tun zu können. Nach seinem eigenen Zeugnis hat er die meiste Zeit mit der Arbeit an einer monumentalen Plastik zugebracht, die Arminius gewidmet war, jenem Mustergermanen des altrömischen Historikers Tacitus, dem die nationalromantische Bewegung die Rolle eines ersten deutschen Nationalhelden zugewiesen hatte. Als die zentnerschwere Statue über Hauptmann zusammenbricht, weil er in seinem idealischen Schwung den Gesetzen der Schwerkraft nicht die gebührende Beachtung geschenkt hat – ein Malheur, das einem Dichter nicht passieren kann – kommt es zur Krise. An deren Ende stehen Überlegungen, die Hauptmann in „Das Abenteuer meiner Jugend“ (1937) im Rückblick wie folgt rekonstruiert hat:
Man wird sich erinnern, wie man mich bedrängt hatte mit der Prophezeiung eines rettungslosen Epigonentums. Hatte doch der famose Gervinus gesagt, das Kapitel der Poesie in Deutschland sei durch Goethe ganz und gar abgeschlossen. Diesen Irrwahn, der meinen Weg wie eine Mauer versperren wollte, hinwegzuräumen, mühte mein Geist sich Tag und Nacht. Ich sah wohl das Epigonentum, sah alle die unfruchtbaren Nachahmer und grübelte nach über die Ursachen ihrer Unfruchtbarkeit. War ich nicht auch auf dem besten Wege dazu? [<<49]
Da leuchtete mir am Himmel ein Pünktchen auf wie ein Stern. Wenn du ein alter Mann geworden bist, und du hast ein Leben lang den großen Dichtern und ihren Höhenprodukten nachgestrebt, so wirst du vielleicht einmal etwas ganz von ihnen Verschiedenes, etwas unmittelbar Erdnahes hervorbringen.
Weiter im Anschluß hieran, also dieser verstiegenen Hoffnung verbunden, kam es mir vor, als ob alle Epigonen und auch wir den Boden unter den Füßen verloren hätten. Die Dichtwerke reihten sich horizontal, meinethalben wie Perlen an einem Faden sich reihen. Eine vertikale Ausdehnung hatten sie nicht. Bildlich gesprochen: sie hingen und saugten einander aus wie Vampire, statt wie Bäume getrennt zu stehen und Nahrung mit einem gesunden Wurzelsystem aus der Erde zu trinken.
Wie steht es mit dir nun? fragte ich mich.
Auch du bist ins Himmelblaue entrückt und hast höchstens einige kurze Luftwurzeln. Ob sie die Erde jemals erreichen und gar in sie eindringen können, weißt du nicht.
Jetzt aber hatte ich plötzlich die Kühnheit, nach allem Profanen, Humus- und Düngerartigen um mich zu greifen, das ich bisher nicht gesehen, weil ich es nicht für würdig erachtet hatte, in Bereiche der Dichtkunst einzugehen. Und abermals wie im Blitz erkannte ich meine weite und tiefe Lebensverwurzelung und daß es ebendieselbe sei, aus der mein Dichten sich nähren könne. (…)
So und nicht anders verlief der innere Zauber, der mich zu einem gesunden, verwurzelten Baum machte.
Und als ich „Die Macht der Finsternis“ von Leo Tolstoi gelesen hatte, erkannte ich den Mann, der im Bodenständigen dort begonnen, womit ich nach langsam gewonnener Meisterschaft im Alter aufhören wollte.
Und wie man eine Statue, die auf dem Kopf steht, auf die Füße stellt, so war es mir klar, daß ich mit der Scholle und ihren Produkten sogleich mein Werk beginnen müsse, statt im Alter es zu vollenden.
Was ging das Geschwätz vom Naturalismus mich an? Aus Erde ist ja der Mensch gemacht, und es gibt keine Dichtung, ebensowenig wie eine Blüte und Frucht, sie sauge denn ihre Kraft aus der Erde!
Dieser Gedanke stand kaum gefestigt in mir, als ich aus einem Borger, ja Bettler, ein recht wohlsituierter Gutsbesitzer geworden war.18 [<<50]
Die Wende kommt mit der Einsicht in den epigonalen Charakter der eigenen Versuche und der Kultur, die zu solchen Versuchen verleitet hat, kommt mit dem Begreifen dessen, was Epigonentum heißt. Die Basis des Epigonentums ist ein Kult des Klassischen, hier der zur Deutschen Klassik verklärten „Goetheschen Kunstperiode“, der sich dank der Arbeit von Literarhistorikern wie Georg Gottfried Gervinus (1805–1871) bis zum „Irrwahn“ gesteigert hat, der nämlich dazu geführt hat, daß sich die Literatur ganz in ihre eigene Überlieferung eingeschlossen und gegen die Lebenswirklichkeit um sie herum abgeschottet hat, daß sie diese Lebenswirklichkeit, die doch das einzige ist, wovonher ein Autor auf originelle, persönliche Weise produktiv werden kann, als „profan“ und „der Dichtkunst unwürdig“ abgetan hat, um nur noch mit dem Erbe der Klassik, mit Angelesenem und Anempfundenen, „Erborgtem“ und „Erbetteltem“ zu wirtschaften. In dem Moment, in dem der Autor erkennt, daß er mit der eigenen Lebenswirklichkeit einen Stoff in Händen hält, der sehr wohl „der Dichtkunst würdig“ ist, weil er alles in sich begreift, was Menschenleben und Menschenschicksal ausmacht, und der es überdies so in sich begreift, daß es ihm unmittelbar, auf lebendige, die Sinne und das Gefühl ansprechende Weise zugänglich ist – in eben diesem Moment ist der Bann gebrochen.
Hauptmann faßt die Sphäre, mit der seine literarische Arbeit über dem Innewerden seiner „tiefen Lebensverwurzelung“ in Fühlung gekommen ist, in Wendungen wie „Boden“, „Erde“ und „Scholle“, „Humus“ und „Dünger“, doch ist das, wie er eigens hervorhebt, nur „bildlich gesprochen“. Er zielt damit keineswegs auf die Natur und das Landleben, sondern auf die Lebenswelt des modernen Menschen, auf die Realitäten des modernen Lebens. Daran lassen die Werke, die auf die Wende folgen, keinen Zweifel. Das erste Ergebnis der Neuorientierung ist das schon erwähnte „soziale Drama“ „Vor Sonnenaufgang“, und das führt auf einen zentralen Schauplatz der industriellen Revolution in Deutschland, einen, den Hauptmann aus eigener Anschauung kennt, in das schlesische Kohlerevier; es führt mithin an einen Brennpunkt des sozialen Wandels, in Worten Bierbaums: in die „Düsternisse sozialer Not“.
Bekenntnis zur neuen Zeit
Klarer als in Hauptmanns Bericht spricht sich die Ausrichtung der neuen Literatur auf die „zivilisatorischen Realitäten“ der Moderne in den programmatischen Äußerungen des Autors aus, dem Hauptmann [<<51] „Vor Sonnenaufgang“ gewidmet hat, bei Arno Holz (1863–1929), etwa in dem poetologisch-programmatischen Gedicht „Zum Eingang“, mit dem Holz sein „Buch der Zeit“ (1886) eröffnet. Das Ziel, „unter allen Epigonen (…) der allerletzte“ zu sein, das gleich in der ersten Strophe formuliert wird, rückt auch bei Holz in eben dem Moment in greifbare Nähe, in dem er sich seiner „tiefen Lebensverwurzelung“ in der modernen Welt bewußt wird, in dem er nämlich erkennt, daß es einzig die „junge Zeit“ ist, die ihn zum Dichten animiert, auch wenn es eine „Zeit aus Blut und Eisen“ ist. Aber auch so, ja gerade so spricht sie seine Sinne und sein Herz an, setzt sie seine Phantasie in Gang – etwas, das die Epigonen von Klassik und Romantik für unmöglich gehalten haben.
Mir schwillt die Brust, mir schlägt das Herz
und mir ins Auge schießt der Tropfen,
hör ich dein Hämmern und dein Klopfen
auf Stahl und Eisen, Stein und Erz.
Die poetische Welt der Epigonen hingegen, all die Verse
(v)on Wein und Wandern, Stern und Mond,
vom „Rauschebächlein“, vom „Blauveilchen“,
von „Küßmichmal“ und „Warteinweilchen“,
von Liebe, „die auf Wolken thront“(,)
lassen ihn kalt. Nicht nur, daß sie von den Hot Spots des modernen Lebens wegführen, man hört ihnen auch an, daß sie nicht authentisch sind, daß es sich bei ihnen um „längst ergossene Ergüsse“ handelt, um „alte taube Nüsse“ und „aufgewärmten Sauerkohl“.
Nein, mitten nur im Volksgewühl,
beim Ausblick auf die großen Städte,
beim Klang der Telegraphendrähte
ergießt ins Wort sich mein Gefühl.
Dann glaubt mein Ohr, es hört den Tritt
von vorwärts rückenden Kolonnen, [<<52]
und eine Schlacht seh ich gewonnen,
wie sie kein Feldherr noch erstritt (…)
– die große Schlacht des Fortschritts.
Denn süß klingt mir die Melodie
aus diesen zukunftsschwangern Tönen;
die Hämmer senken sich und dröhnen:
Schau her, auch dies ist Poesie!
Sie kehrt nicht nur auf ihrem Gang
in Wälder ein und Wirtshausstuben,
sie steigt auch in die Kohlengruben
und setzt sich auf die Hobelbank.
Auch harft sie nicht als Abendwind
nur in zerbröckelten Ruinen,
sie treibt auch singend die Maschinen
und pocht und hämmert, näht und spinnt.
Sie schaukelt sich als schwanker Kahn
im blauen, schilfumkränzten Weiher,
sie schlingt den Dampf ums Haupt als Schleier
und saust dahin als Eisenbahn.
Von nie geahnter Kraft geschwellt,
verwarf sie ihre alten Krücken,
sie mauert Tunnels, zimmert Brücken
und pfeift als Dampfschiff um die Welt.
Ja, Wunder tut sie ohne Zahl,
sie lindert jegliches Verhängnis,
sie setzt den Fuß selbst ins Gefängnis
und speist die Armut im Spital.
Wohl wars der Himmel, der sie schuf,
doch heimisch ward sie längst auf Erden; [<<53]
drauf immer heimischer zu werden,
ist ihr ureigenster Beruf.19
Die neue Zeit ist keineswegs „der Dichtkunst unwürdig“, wie die Epigonen meinen – im Gegenteil: sie ist voll von Poesie, ja sie ist selbst Poesie im ursprünglichen Wortsinn, ist ein einziges großes „poiein“, ein Schaffen und Machen, über dem sich die menschliche Kreativität auf eine Weise zur Geltung bringt und Spielräume erobert wie nie zuvor. Der Traum der Poeten geht weiter, denn die neue Zeit „träumt“ wie sie „von unentdeckten Welten“, und wie sie tut sie alles dafür, um Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Mit ihrem „Hämmern“ und „Klopfen“ erzeugt sie eine Musik, läßt sie „Melodien“ und Rhythmen erklingen, die die Sinne unmittelbar in ihren Bann ziehen und „das Herz durchlohen“, die den ganzen Menschen ergreifen und in eine Dynamik hineinreißen, die ihn ebensowohl rund um den Globus führen wie ihm die Kraft verleihen kann, den Fortschritt in die „Düsternisse“ von Gefängnissen und Armenhäusern zu tragen.
„Alte und neue Wunder“
Auf solche Weise tritt Holz der seinerzeit nicht nur unter Epigonen verbreiteten Vorstellung von der „Entzauberung der Welt“ (Max Weber) durch die moderne Wissenschaft und Technik entgegen. Schon den Brüdern Edmond (1822–1896) und Jules de Goncourt (1830–1870), die ebensowohl zu den Stammvätern des Naturalismus wie zu denen des Symbolismus zählen, war über dem Studium des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe (1809–1849) der Gedanke gekommen, die „Literatur des 20. Jahrhunderts“ werde eine Literatur sein, in der „das wissenschaftliche Wunderbare“ den Ton angebe.20 Der Welt droht in der neuen Zeit keineswegs eine Entzauberung; vielmehr wird sie erleben, daß den „alten Wundern“ „neue Wunder“ an die Seite treten – so gelegentlich auch schon der deutsche Realist Wilhelm Raabe21 – Wunder, die nicht im „Himmel“ geboren werden, sondern „auf Erden“, und deren Darstellung dafür sorgen wird, daß die Poesie „auf Erden [<<54] immer heimischer“ wird. Denn die moderne Dichtung soll natürlich eine säkulare sein, eine, die mit dem epigonalen Bezug zu Klassik und Romantik noch die letzte Verbindung zum „Himmel“, zu Mythos und Religion gekappt hat.
So energisch sich Arno Holz aber auch der „alten Krücken“ entledigt und so begeistert er sich der „jungen Zeit“ in die Arme wirft – modern ist sein Gedicht noch nicht, ja es steckt mit seinen liedhaften Strophen noch tiefer in der Überlieferung fest als die Gedichte von Bierbaum und Hofmannsthal. So ist er denn auch bald zu der Überzeugung gelangt, daß ein Moderner keine Lieder mehr schreiben könne – insofern bezeichnet der Untertitel des „Buchs der Zeit“, „Lieder eines Modernen“, nur eine Durchgangsstation in seinem Entwicklungsgang – und hat andere als liedhafte, eben wirklich neue, moderne Töne angeschlagen. Das Ergebnis ist der „Phantasus“ von 1898/99.