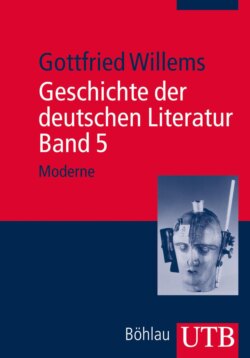Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 5 - Gottfried Willems - Страница 12
2 Aufbruch in die Moderne
2.1 Programmatischer Modernismus
2.1.3 Das Programm der Modernen
ОглавлениеWie sieht nun das Programm des programmatischen Modernismus im einzelnen aus? Was läßt sich in den Debatten der ersten Generation von Modernen an Vorstellungen und Forderungen ausmachen, die die verschiedenen Gruppen und Grüppchen über alle Differenzen hinweg verbinden? Bei der Antwort mag uns ein weiteres poetologisches Gedicht aus der Frühzeit der Moderne helfen.
Modern
Modern! Modern! Was will das Wort denn sagen,
Das heut von Mund zu Mund geschäftig fliegt,
Mit lautem Weckruf stört das Wohlbehagen,
Das träg an der Gewohnheit Kette liegt?
Was will es uns für neue Botschaft bringen,
Was ist der Sinn, was ist des Pudels Kern?
Was will dies kühne, kampfesfreud’ge Ringen?
Was ist modern?
Modern ist jener Drang zur Neugestaltung,
Der rücksichtslos die alten Formen sprengt, [<<55]
Und allem feind ist, was in der Entfaltung
Des starken Geistes freie Tat beengt.
Modern ist jener Trieb, der eigenwüchsig
Dem Bann der Überlief’rung widersteht
Und sich nicht beugt in frommem Kinderglauben
Dem Götzenzauber der Autorität.
Modern ist jener schönste aller Züge
In unsrer Zeit freiblickendem Gesicht,
Der Zug, aus dem der Ekel vor der Lüge,
Aus dem die Liebe zu der Wahrheit spricht;
Der alle Täuschung haßt und überwindet
Der Schmeichelschönheit himmelblauen Dunst, –
Der nur die Schönheit in der Wahrheit findet,
Wahrheit im Leben, Wahrheit in der Kunst. (MM 133–134)
Auch das sind Verse aus dem Umkreis der Münchner „Gesellschaft für modernes Leben“; der Autor ist einer ihrer frühen Vorsitzenden, ein Theaterautor und Kritiker namens Julius Schaumberger (1858–1924). Wie bei Arno Holz und Bierbaum fungiert der Begriff „modern“ bei ihm zunächst und vor allem als ein „Weckruf“, mit dem die Zeitgenossen dem Trott der „Gewohnheit“ entrissen werden sollen, und wie dort wird diesem „Weckruf“ dadurch Nachdruck verliehen, daß ein schroffer Gegensatz zwischen dem Erbe der Vergangenheit und den Erfordernissen der Gegenwart aufgemacht wird.
Der „Bann der Überlieferung“
Die eine Seite bezeichnet das, was Schaumberger den „Bann der Überlieferung“ nennt, bezeichnet „Vergangenes“, das nicht vergehen will, das auch die Gegenwart bestimmen, sich auch dieser gegenüber mit „Autorität“ zur Geltung bringen will. Sein wichtigster Verbündeter ist die „Gewohnheit“. Sie macht aus der „Überlieferung“ einen Gegenstand des „Wohlbehagens“; als etwas Altbekanntes, Vertrautes erspart sie den Menschen ebensowohl das unangenehme Gefühl der Verunsicherung wie die unbequeme Anstrengung des Umdenkens, die mit dem Aufkommen von Neuem verbunden sind, und das pflegen sie eben mit „Wohlbehagen“ zu quittieren.
In Kunst und Literatur manifestiert sich der „Bann der Überlieferung“ vor allem in der „Autorität“ der „alten Formen“. Bierbaum nennt [<<56] diese Formen „klassisch“ und „hellenisch“ und ordnet sie damit dem „Epigonenschweif der Antike“ zu. Zugleich macht er deutlich, daß sie ihre Pflege durch die „Formelnschule“ der Epigonen zu „papiernen“ „Phrasenhülsen“ hat erstarren lassen, die zu nicht mehr taugen, als – in Worten Schaumbergers – „der Schmeichelschönheit himmelblauen Dunst“ zu erzeugen, als einen „schönen Schein“ zu unterhalten, der zwar dem Bedürfnis nach „Wohlbehagen“ entgegenkommt, bei dem aber die „Wahrheit“ auf der Strecke bleibt, der letztlich nichts anderes ist als „Schminke“, „Täuschung“ und „Lüge“.
Ein „Drang zur Neugestaltung“
Dem wird ein „Drang zur Neugestaltung“ gegenübergestellt, der den „Bann der Überlieferung“ zu brechen sucht und überhaupt aller „Autorität“ den Kredit aufkündigt. Nicht „Gewohnheit“ und „Konvention“, sondern das Ungewöhnliche, Unkonventionelle soll nun die Sache von Kunst und Literatur sein, was immer darüber aus dem Bedürfnis des Publikums nach „Wohlbehagen“ werden mag. Das heißt vor allem, daß die „alten Formen“ „gesprengt“ werden sollen, auch bestens beleumdete und bewährte Formen, ja gerade sie; daß neue, „eigenwüchsige“ Formen geschaffen werden sollen, Formen, die allein dem „Heute“, allein der Lebenswirklichkeit des modernen Menschen verpflichtet wären. Was an neuen Werken entsteht, soll – so das Bild von Hauptmann – wie ein Baum „getrennt stehen“ und einzig „Kraft aus der Erde“ dieser Lebenswirklichkeit „saugen“, soll nicht mehr nach dem Himmel der klassischen Kunst schielen, soll in jeder Hinsicht selbständig, eben „eigenwüchsig“, autochthon sein.
Dabei soll auch auf jene Erwartung keine Rücksicht mehr genommen werden, die in der Vergangenheit mehr als alles andere den Zugang zur Kunst bestimmt hat: die Erwartung, im Kunstwerk etwas Schönem zu begegnen. Schönheit soll, wenn überhaupt, dann nur noch dort zur Darstellung kommen, wo es das Streben nach Wahrheit zuläßt. Hier wird der Bruch mit dem „Epigonenschweif der Antike“ besonders deutlich. Die Griechen und alle, die sich an ihren Begriffen von Kunst orientierten, huldigten dem Gedanken der Kalokagathie, der Vorstellung, daß alles Wahre schön und alles Schöne wahr sei. In der Moderne wird das Verhältnis von Schönheit und Wahrheit mehr und mehr ein prekäres; der „schöne Schein“ der Kunst steht nun immer schon in dem Verdacht, „Täuschung“ und „Lüge“ zu sein und nichts anderem zu dienen als der Anbiederung beim Publikum, als der „Schmeichelei“ [<<57] und dem Erzeugen eines dickbramsigen, indolenten „Wohlbehagens“. Das bedeutet freilich nicht, daß man sich ein für allemal von dem Ziel verabschiedet hätte, „dem Schönen das Wahre (zu) versöhnen“; die Frage nach der Schönheit bleibt offen, aber sie bezeichnet nun eben ein Problem.
„Elan vital“
Bei der Entwicklung dieser Vorstellungen bedienen sich die Modernen einer Sprache, die überall das Dynamische ihrer Bestrebungen hervorkehrt. Da wird von dem Willen zur „Neugestaltung“ als von einem „Drang“ und einem „Sprengen“ von „Formen“ gesprochen, da ist von „Kampf“, „Begeisterung“ und „Wagemut“ die Rede, von einem „auferstehungsgewaltigen“ „Schwellen“, „Aufbrechen“ und „Herausdrängen“, „Rauschen“ und „Brausen“, von „Hämmern“ und „Klopfen“, „Treiben“ und „Sausen“. Es soll nun um ein dichterisches Wort gehen, das als Wort bereits die Züge einer „Tat“ hätte, das die „freie Tat“ eines „starken Geistes“ wäre. In solchen Wendungen kommt zum Ausdruck, daß sich die neue Kunst durchaus als ein dynamisches Unternehmen verstanden wissen will, als ein Schauplatz dessen, was der zeitgenössische französische Philosoph Henri Bergson (1859–1941) den „élan vital“ nennt, als ein Ort, wo sich mit der Kreativität des Menschen die schöpferische Kraft des Lebens überhaupt entfaltet, wie sie sich in einer drängenden, treibenden Bewegung äußert, die unentwegt alte Formen zerbricht und neue Formen aus sich entläßt und die durch nichts zum Stillstand zu bringen ist. Die neue Kunst will in diesem Sinne vor allem eine lebendige Kunst, und das heißt für sie zugleich: eine junge Kunst sein.