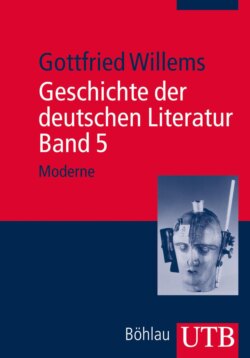Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 5 - Gottfried Willems - Страница 16
3 Naturalismus und Symbolismus
3.1 Literatur und Großstadt
ОглавлениеZentren der Moderne im deutschen Sprachraum
Wir sind aus Riesenstädten, in der City, nur in ihr, schwärmen und klagen die Musen. (GBP 465)
Die moderne Kunst ist die Kunst der modernen Großstadt. Wie sich ihre ersten Anfänge der urbanen Kultur der großen Stadt Paris verdanken, so hat sie sich von Metropole zu Metropole fortgepflanzt. Im deutschen Sprachraum sind es zunächst die großstädtischen Zentren Berlin, München und Wien, in denen sie Fuß faßt, später auch nicht ganz so große Großstädte wie Dresden, Düsseldorf und Köln, Frankfurt und Zürich. Die Zeit, in der Provinzstädte, kleine Residenzen und Universitätsstädte wie Weimar, Jena und Heidelberg den Ton in Sachen Literatur angeben konnten wie noch in der Goethezeit, scheint ein für allemal vorbei.
Es gibt allerdings eine Ausnahme: das Bauhaus,41 jenes Zwischending zwischen Kunstgewerbeschule und Kunstakademie, das so ungemein bedeutsam für die Bildende Kunst, insbesondere für die Architektur und das Design der Moderne geworden ist; es ist zunächst in Weimar, später in Dessau angesiedelt. Und natürlich werden kleine Landstädte wie Céret in Südfrankreich und Murnau in Bayern immer einmal wieder zum Schauplatz der Sommerfrische von Künstlern, und damit zeitweilig zu Zentren des künstlerischen Lebens, doch ist ihre Bedeutung nur selten über die einer Dependance bestimmter großstädtischer Avantgardezirkel hinausgewachsen.
Zur Geschichte des Verhältnisses von Literatur und Großstadt
Nun sind Kunst und Literatur eigentlich immer schon in den großen Städten zuhause gewesen, schon in der Antike. Hier kommt am ehesten die kritische Masse von Wissen und Können zusammen, finden sich am ehesten die Talentschmieden, die Netzwerke, die Märkte und das Publikum, deren es bedarf, um eine Kunst von Rang entstehen zu lassen. So war die größte Stadt des antiken Griechenland, Athen, zugleich der wichtigste Standort seiner Kunst und Literatur. Ähnliches gilt von Alexandria und der Literatur des Hellenismus, von Rom und der Kunst der alten Römer und von dem „neuen Rom“ [<<89] Konstantinopel und der byzantinischen Kunst. Überall hier war die größte Stadt zugleich der wichtigste Schauplatz des künstlerisch-literarischen Lebens.
Das änderte sich allerdings im Übergang von der Antike zum Mittelalter. Denn im gesamten Mittelalter und bis weit in die Frühe Neuzeit hinein gab es im europäischen Kulturraum keine Stadt vom Format des antiken Rom mehr – Rom selbst war von einer Millionenstadt auf weniger als 50.000 Seelen geschrumpft – und so mußten nun die großen Fürstenhöfe, später auch die eine oder andere Universitätsstadt und mittelgroße Stadtrepublik der Kunst die Metropole als Standort und Lebensraum ersetzen. Als aber die Modernisierung die europäischen Städte wieder in die Dimension von „Riesenstädten“ hineinwachsen ließ, kehrten Kunst und Literatur mit aller Selbstverständlichkeit in sie zurück – eine Entwicklung, die nicht vor dem 18. Jahrhundert begann und die zunächst auch nur London und Paris betraf, die beiden Städte, die bis 1800 immerhin schon die Größe von 960.000 bzw. 650.000 Einwohnern erreichten.
Diese Rückkehr in die Großstadt ist freilich zunächst nur eine äußerliche, eine Rückkehr nur mit dem Körper des künstlerisch-literarischen Lebens, nicht auch mit dessen Seele. Denn mit der Seele suchten Kunst und Literatur im 18. Jahrhundert die Natur; nur da meinten sie noch des Wahren-Guten-Schönen habhaft werden zu können, wie es nach wie vor ihr oberstes Ziel war. In der großen Stadt erblickten sie einen Raum der Naturferne, ja den Ort, an dem sich der Mensch weiter von der Natur entfernt hätte als irgendwo sonst, einen Raum mehr oder weniger vollkommener Unnatur, und das hieß für sie: einen Ort, an dem sich Lüge, moralische Verkommenheit und Häßlichkeit breitmachen können. So schien sie durchaus kein guter Boden für eine Kunst des Wahren-Guten-Schönen zu sein, schien sie allenfalls als negatives Gegenbild zur „freien Natur“ zu taugen. Als typisch mag hier ein Autor des 18. Jahrhunderts wie Rousseau gelten. Zwar war es die urbane Literaturszene von Paris, in der er seine Karriere als Autor startete und von wo die Erfolgsgeschichte seiner Werke ausging, doch hat er in diesen Werken ein Bild von der großen Stadt Paris gezeichnet, in dem er sie zum Inbegriff unnatürlicher, „entfremdeter“ Verhältnisse, ja zu einem absoluten Tiefpunkt in der Geschichte der Zivilisation stilisierte. [<<90]
Dieses Bild tat auch in Deutschland seine Wirkung, einem Land, das noch lange keine Metropole vom Format eines London oder Paris aufzuweisen hatte. Zumal die Romantik machte es sich zueigen, und sie schrieb es auf eine Weise fest, die ihm eine Wirkung durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sicherte. Die Deutschen hatten also bereits eine fertige Vorstellung von der modernen Großstadt, noch bevor es in Deutschland eine Stadt gab, die diesen Namen verdiente, bevor die großstädtische Lebenswelt für sie zu einer realen Erfahrung geworden war.
Das romantische Bild der Großstadt
Als Beispiel für das romantische Bild der Großstadt sei hier der Roman „Ahnung und Gegenwart“ (1815) von Joseph von Eichendorff angeführt. Da wird zweimal ein Blick auf eine große Stadt geworfen, nur ein Seitenblick zwar, aber einer, der es an Deutlichkeit nicht fehlen läßt. Die Stadt bleibt ohne Namen, wird nur „die Residenz“ genannt; Eichendorff mag dabei an das ihm wohlbekannte Wien gedacht haben, die Residenz zunächst der deutschen, dann der österreichischen Kaiser, die um 1815 gerade einmal 250.000 Einwohner hatte, also noch nicht von besonders furchteinflößender Größe war. Wir hören zunächst die Stimme des Helden Friedrich, der mit ansehen muß, wie sich die geliebte Rosa allein in die große Stadt aufmacht, und sodann die des Erzählers, der Friedrichs Sicht der Dinge nachdrücklich bestätigt und weiter ausführt.
„Siehst du dort“, sagte Friedrich, „die dunklen Türme der Residenz? Sie stehen wie Leichensteine des versunkenen Tages. Anders sind die Menschen dort, unter welche Rosa nun kommt; treue Sitte, Frömmigkeit und Einfalt gilt nicht unter ihnen. Ich möchte sie lieber tot, als so wiedersehn. Ist mir doch, als stiege sie, wie eine Todesbraut, in ein flimmernd aufgeschmücktes, großes Grab, und wir wendeten uns treulos von ihr und ließen sie gehen.“42
Wohl ist der Weltmarkt der großen Städte eine rechte Schule des Ernstes für bessere beschauliche Gemüter, als der getreueste Spiegel ihrer Zeit. [<<91] Da haben sie den alten, gewaltigen Strom in ihre Maschinen und Räder aufgefangen, daß er nur immer schneller und schneller fließe, bis er gar abfließt, da breitet denn das arme Fabrikenleben in dem ausgetrockneten Bette seine hochmütigen Teppiche aus, deren inwendige Kehrseite ekle, kahle, farblose Fäden sind, verschämt hängen dazwischen wenige Bilder in uralter Schönheit verstaubt, die niemand betrachtet, das Gemeinste und das Größte(,) heftig aneinandergeworfen, wird hier zu Wort und Schlag, die Schwäche wird dreist durch den Haufen, das Hohe ficht allein. Friedrich sah zum ersten Male so recht in den großen Spiegel, da schnitt ihm ein unbeschreiblicher Jammer durch die Brust, und die Schönheit und Hoheit und das heilige Recht, daß sie so allein waren, und wie er sich selber in dem Spiegel so winzig und verloren in dem Ganzen erblickte, schien es ihm herrlich, sich selber vergessend, dem Ganzen treulich zu helfen mit Geist, Mund und Arm.43
Immerhin, schon hier wird der Großstadt zuerkannt, was ihre Bedeutung für die moderne Literatur begründen wird: daß sie „der getreueste Spiegel ihrer Zeit“ ist, doch geschieht dies ausschließlich insofern, als in ihr all das in geballter Form zu erfahren sein soll, was die neue Zeit an Negativem über die Menschen gebracht hat. Als Sitz des modernen Fabriken- und Maschinenwesens soll die Großstadt der Ort sein, wo dem Strom des Lebens das Leben und den Menschen der Schönheitssinn ausgetrieben wird, wo sich lebendige in mechanische Prozesse auflösen und man sich an das „Ekle“, „Kahle“ und „Farblose“ gewöhnt. Mit dem Schönheitssinn soll zugleich der Sinn für das Wahre und Gute ins Wanken geraten, sollen sich „Gemeinheit“ und „Schwäche“ breit machen und dank des großen „Haufens“ auf eine Weise die Oberhand gewinnen, die die wenigen, in denen noch die „Hoheit“ und das „heilige Recht“ leben, zu einem Leben in Einsamkeit verdammt. In der großen Stadt ist für den Romantiker Eichendorff alle „Poesie des Herzens“ am Ende, dominiert „Prosa“ die Verhältnisse, und so entfernt er sie so rasch wie möglich wieder aus dem Fokus der Darstellung. Ihre Bedeutung erschöpft sich bei ihm darin, eine äußerste Herausforderung des „wahren poetischen Sinnes“ zu sein. [<<92]