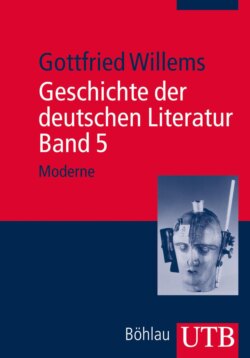Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 5 - Gottfried Willems - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Aufbruch in die Moderne
2.3 Der „Konflikt der modernen Kultur“ und die Idee einer Postmoderne
ОглавлениеDie innere Grenze des programmatischen Modernismus
Den „Bann der Überlieferung“ abzuschütteln, um einem „Drang zur Neugestaltung“ Luft zu verschaffen, „Autoritäten“ den Kredit aufzukündigen, „Gewohnheiten“ und „Konventionen“ aufzubrechen, die Erwartung ästhetischen „Wohlbehagens“ nach Kräften zu düpieren, jedwede „Schmeichelschönheit“ als „Täuschung“ zu entlarven, „Formen zu sprengen“, um „Eigenwüchsiges“ an den Tag zu bringen, Neues, das einer unmittelbaren Berührung mit der „Erde“, der „Natur“, dem „Leben“ entspringt, das Kunstwerk als „freie Tat“ des „starken Geists“, als lebendige, dynamische Aktion – das alles sind Forderungen, die nicht nur für die erste Generation der Modernen gelten. Bis auf den heutigen Tag bilden sie das Grundgerüst der Programme, die im Namen einer modernen Kunst und Literatur formuliert werden, bezeichnen sie den eisernen Bestand des theoretischen Werkzeugkastens, mit dem an der Kultur der Moderne gearbeitet wird, mit dem etwa die Literaturkritik ihre Diskurse bestreitet. Jede Generation, jeder neu sich formierende Zirkel von Avantgardisten und jeder Debütant, der auf sich hielt, hat den programmatischen Modernismus noch einmal neu für sich entdeckt und damit dafür gesorgt, daß er präsent blieb.
Darin bezeugt sich nicht nur, welches Potential die Konzepte hatten, die von der ersten Generation der Modernen entwickelt worden waren, und wie durchschlagend ihre Wirkung war; es zeigt sich darin auch ihre innere Grenze. Offenbar war nichts von dem, was die ersten Modernen an Neuem geschaffen hatten, so neu, daß die, die nach ihnen kamen, nicht Gelegenheit gehabt hätten, ihm gegenüber erneut nach Modernität zu rufen. Was immer eine Gruppe von Avantgardisten ins Werk setzte, war, so radikal sie sich auch geben mochten, letztlich [<<71] doch nicht so modern, daß es eine nächste Generation nicht gleich wieder als veraltet hätte empfinden können, daß sie in ihm nicht wieder eine Überlieferung mit der Aura des Etablierten und Autoritativen hätte erblicken können, gegen die mit einem neuerlichen Brechen von Konventionen und Sprengen von Formen vorzugehen gewesen wäre. In eben diesem Sinne wandte sich zum Beispiel die Avantgarde von 1910, der Expressionismus, gegen Naturalismus, Symbolismus und Jugendstil, und wandte sich die Avantgarde von 1920, der Dadaismus, gegen den Expressionismus. Keine Avantgarde war offenbar so avanciert, daß nach ihr nicht eine neue Avantgarde hätte aufstehen können. Nichts Modernes schien je modern genug, schien sich auf Dauer als modern behaupten zu können.
Die Steigerungslogik der Moderne
Nun sind in der Moderne natürlich nicht nur Kunst und Literatur, sondern alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens auf solche Weise in Bewegung; überall heißt modern zu sein nach kurzer Zeit schon wieder etwas anderes. Die neue Mobilität der Kunst entspringt ja zunächst nichts anderem als dem Versuch, sich dadurch zu einer modernen Kunst zu gestalten, daß sie sich auf die Dynamik um sie herum einläßt und sie nach Kräften in sich hineinnimmt. Doch das allein reicht wohl noch nicht aus, um die dichte Abfolge immer neuer Avantgarden zu erklären. So rasch und durchgreifend verändern sich die Lebensverhältnisse auch in der Moderne nicht, daß eine Kunst, die up to date sein will, sich in jedem Jahrzehnt noch einmal neu zu erfinden hätte.
Der Grund für das Auftreten immer neuer Avantgarden dürfte nicht so sehr in den realen Prozessen des Wandels um die Kunst herum als vielmehr in dem Konzept von Modernisierung zu suchen sein, dem sie sich als moderne Kunst verschrieben hat. Es bedeutet nichts weniger, als daß jeder Künstler, der modern heißen will, seine Vorgänger an Modernität zu überbieten hat, daß er über das, was diese bei der Auseinandersetzung mit der modernen Welt bereits an Thematisierungen und formalen Möglichkeiten erarbeitet haben, wieder hinausgehen muß. Wenn jede künstlerische Leistung, die die Zeitgenossen überzeugt und beeindruckt, das Zeug dazu hat, eine Nachfolge zu begründen, also eine Tradition zu stiften, einen neuen „Bann der Überlieferung“ aufzurichten, dann kann eine Kunst, die auf Modernität aus ist, sich nur dadurch treu bleiben, daß sie jeden [<<72] Ansatz zu einem solchen „Bann“ sogleich wieder zunichte macht. So kommt es, daß das, was die Werke eines Künstlers von denen seiner Vorgänger unterscheidet, daß die „Differenzqualität“ – ein Begriff des Russischen Formalismus, einer Schule der Literaturtheorie, die eng mit der russischen Avantgarde der zwanziger Jahre verbunden ist – in der Moderne weithin zu einem letzten Kriterium in allen Belangen der Kunst wird.
Die Forderung der Modernität als Leerintention
Hier zeigt sich, daß der moderne, der aus der Relation antik – modern herausgelöste, absolute Begriff von Modernität nur eine „Leerintention“ (Edmund Husserl) ist, die von sich aus keinen konkreten Inhalt mit sich führt, die immer wieder neu zu füllen ist und sich mit keiner Füllung auf Dauer verbindet, ja jeder einmal vorgenommenen Füllung alsbald wieder entledigt. Modern zu sein heißt nicht, ein für allemal für dieses und gegen jenes zu sein, sondern immer wieder für etwas anderes einzutreten.
Das haben bereits die ersten Modernen gesehen. Es ist ihnen nicht zuletzt über einem Streit bewußt geworden, der in der Münchner „Gesellschaft für modernes Leben“ entbrannte, kaum daß sie gegründet war. Er entzündete sich an einer Frage, die im katholischen München nicht ausbleiben konnte, an der Frage, ob man als Katholik modern und als Moderner katholisch sein könne, ob Modernität nicht Atheismus und Materialismus mit einbegreife. Das Ergebnis war die Einsicht, daß eine „Präcisierung der,Moderne‘ (…) unvereinbar (…) mit dem Wesen derselben“ (MM 132–133) sei, daß also jede Festlegung des Begriffs „modern“ auf Vorstellungen wie Atheismus und Materialismus seiner Verfälschung gleichkäme. Das aber heißt nichts anderes, als daß er als eine Leerintention zu begreifen und zu handhaben sei.
In die gleiche Richtung zielt Michael Georg Conrad, wenn er erklärt, der Kampf der Modernen sei nicht als Eintreten für ein „Ideal“, ein „Prinzip“ oder ein „Dogma“ und „Einspinnen in eine Autorität“ zu verstehen, sondern als eine Bewegung „auf der Linie des aufsteigenden Lebens“. Unter dem Titel der Moderne soll es um eine Haltung gehen, die sich dem gegenüber, was das „aufsteigende Leben“, was Evolution und Fortschritt an Neuem bringen, nicht hinter irgendwelchen „Idealen“, „Prinzipien“, „Dogmen“ und „Autoritäten“ verschanzt, sondern ihm mit rückhaltloser Offenheit begegnet – offen und in Bewegung zu sein und zu bleiben wird zu einem obersten Wert. [<<73]
Solche Feier der Offenheit läßt den Verdacht aufkommen, daß der Begriff der Modernität, auf den der programmatische Modernismus die Kunst verpflichtet, letztlich nichts anderes sei als der Hebel einer Modernisierungsdynamik, die sich zum Selbstzweck geworden ist, die allen Analysen und Programmen, die ihr angedient werden, immer schon voraus ist. Was immer sich die Zeitgenossen an Theorien in Sachen Moderne einfallen lassen – daß die Modernisierung weitergeht, steht vorab schon fest. Da kann es nicht ausbleiben, daß die Haltung der Offenheit in den Rang einer obersten Tugend aufsteigt; nur sie scheint davor bewahren zu können, daß man irgendwann unter die Räder der Modernisierungsmaschine gerät.
Offenheit ist freilich nicht die Lösung aller Probleme; sie schafft auch wieder neue. Die Bedeutung der Offenheit liegt ja darin, daß sie es erlaubt, sich auf Neues einzulassen, und sich einlassen heißt ergreifen und festhalten und nicht gleich wieder fahrenlassen, heißt also, sich zumindest zeitweise von der Offenheit verabschieden. Eine Leerintention wie der Begriff der Modernität kann nur dadurch zur Wirkung gelangen, daß sie mit bestimmten Inhalten wie Atheismus und Materialismus gefüllt wird und daß für die Worte, Taten und Werke, in denen diese Inhalte entfaltet werden, Geltung beansprucht wird. Gelten wollen heißt aber, der Modernisierungsdynamik nicht gleich wieder weichen wollen, ja ein solcher Geltungsanspruch konstituiert sich in der Moderne recht eigentlich in dem Widerstand, den er der Modernisierungsdynamik entgegensetzt. Von ihm aus gesehen erscheint das Modernisierungsgebot mithin als ein „Prinzip“, das ihm das Leben schwermacht, nimmt es die Züge eben der „Ideale“ und „Autoritäten“ an, mit denen eigentlich Schluß sein soll, begründet es ein neues „Dogma“: den Dogmatismus der Offenheit. Die Leerintention „modern“ und ihre jeweiligen Füllungen geraten notwendig in einen Konflikt, in dem sie einander wechselseitig als dogmatische Fixierung erfahren.
Der „Konflikt der modernen Kultur“
Der Philosoph und Soziologe Georg Simmel (1858–1918)31 hat diesen Konflikt, den er den „Konflikt der modernen Kultur“ nennt, bereits 1918 einer eingehenden Analyse unterzogen. Dabei hat er ihn, wie bei [<<74] einem Jünger Nietzsches und Verfechter des Vitalismus nicht anders zu erwarten – und das war Simmel in seinen letzten Jahren – auf einen Konflikt des Lebens zurückgeführt. Leben heißt schöpferisch sein; das Leben kann sich aber nur dadurch in seiner schöpferischen Lebendigkeit bewähren, daß es Formen schafft, Werke, die in eben dem Maße, in dem sie Gestalt annehmen, aufhören lebendig zu sein, die nämlich im Moment der Fertigstellung in eine feste Form auskristallisieren. Damit treten sie dem Leben, das es geschaffen hat, als etwas gegenüber, dem es gerade sein Eigenstes, seine Lebendigkeit, nicht hat mitteilen können, so daß es sie um seiner Selbsterhaltung willen wieder zerbrechen und sich zu neuen Formen aufmachen muß, wohl wissend, daß diese auch nicht lebendiger sein werden als ihre Vorgänger.
Das Problem ist also früh schon gesehen worden; ob aber die Analyse zureicht, die ihm Simmel hat angedeihen lassen, darf wohl bezweifelt werden. Wenn es wirklich auf einen Konflikt des Lebens überhaupt zurückzuführen wäre, dann wäre zu fragen, was an ihm das spezifisch Moderne sein sollte; dann hätte es sich eigentlich zu allen Zeiten zeigen müssen, und wenn das nicht oder nicht in der gleichen Weise wie in der Moderne der Fall gewesen sein sollte, dann müßte hier etwas hinzugetreten sein, das es allererst hätte virulent werden lassen, ein Moment, das nicht im Leben, das überhaupt nicht in den natürlichen Voraussetzungen der kulturellen Entwicklung, sondern in dieser selbst zu suchen wäre. Da wäre dann zunächst und vor allem an die Modernisierungsdynamik zu denken, wie sie alles einmal Geschaffene, alle Formen und Strukturen und alle Traditionen und Konventionen, die diese am Leben erhalten, unter den Generalverdacht des Überlebten stellt, aber auch an einen Lebensbegriff, wie ihn Simmel gebraucht, einen, der sich an die Modernisierungsdynamik angepaßt hat und demgemäß nur den Schaffensprozeß selbst als lebendig anerkennt und alles Geschaffene als tot abqualifiziert.
Das kann man natürlich auch anders sehen, und man kann es durchaus auch als engagierter Moderner. So hat etwa die amerikanische Autorin Gertrude Stein (1874–1946), eine zentrale Figur des Avantgardismus, erklärt: „Life is tradition and human nature“,32 Leben ist [<<75] Tradition und menschliche Natur. Der Satz findet sich bezeichnenderweise in dem Werk, in dem sie die Summe ihrer künstlerischen Erfahrungen zieht, in dem späten experimentellen Text „Paris, France“ (1940). Für Stein gehört das kulturelle Erbe genauso zum Leben wie die Natur. Traditionen und Konventionen ermöglichen Leben, indem sie es auf eine feste Grundlage stellen und ihm mit dem, was sie ihm an Stoffen und Formen zuführen, zu tun geben, und sie stimulieren und befruchten es selbst dort und gerade dort, wo es sich an ihnen reibt; ohne die selbstverständliche Gegenwart des kulturellen Erbes kein schöpferisches Leben, auch nicht in der Moderne.33
Von einer solchen Sicht der Dinge sind die ersten Modernen freilich noch weit entfernt; der Historismus und der epigonale Kunstbetrieb des ausgehenden 19. Jahrhunderts lasten zu schwer auf ihnen, als daß sie dem Phänomen der Traditionsbildung etwas Positives abgewinnen könnten. So entfaltet sich die moderne Kunst und Literatur in einem konfliktgeladenen Wechselspiel zwischen dem Versuch, der Vision einer neuen Kunst mit dem Aufbringen neuer Themen und Formen Leben einzuhauchen, und einem Dogmatismus der Offenheit, der solche „Präzisierung der Moderne“ wegen der Gefahr einer neuerlichen Traditionsbildung mit „Prinzipien“, „Idealen“, „Dogmen“ und „Autoritäten“ sogleich wieder kassiert.
Die Idee einer Postmoderne
Die Möglichkeit der dogmatischen Verfestigung eines bestimmten Begriffs von moderner Kunst ist allerdings erst in dem Moment zu einer realen Gefahr für das Ringen um Offenheit geworden, in dem man begann, von der Moderne als Epoche zu reden. Denn da mußte man dann in der Tat versuchen, ein „Ideal“ moderner Kunst zu konstruieren, nämlich „Prinzipien“ herauszuarbeiten und dogmatisch festzuschreiben, die sie von der Kunst früherer Epochen unterscheiden würden; da wurden allgemeine Aussagen wie die unumgänglich, die moderne Literatur tendiere zu Atheismus und Materialismus, bevorzuge Formen wie Freie Rhythmen, Fragment und Montage, usw. Und wirklich hat man bereits kurz nach der Jahrhundertwende begonnen, von [<<76] den Jahren seit 1885 als einer eigenen, besonderen Epoche zu sprechen. So hat zum Beispiel der Berliner Schriftsteller und Literaturkritiker Samuel Lublinski (1868–1910) schon 1904 eine vielbeachtete „Bilanz der Moderne“ vorgelegt, um ihr 1909 gar eine Schrift folgen zu lassen, der er den Titel „Der Ausgang der Moderne“ gab.
Wo man aber von der Moderne als einer Angelegenheit handelt, die wie einen Beginn, so auch einen „Ausgang“ hätte und von der sich eine „Bilanz“ aufmachen ließe, da ist die Idee einer „Postmoderne“ nicht mehr fern. In der Tat lassen sich die beiden Schriften von Lublinski als ein früher Anlauf zu einer Theorie der Postmoderne begreifen, auch wenn er das Wort „postmodern“ noch nicht kennt und mit seinen Versuchen womöglich nicht besonders weit gekommen ist.
Hier wie überall, wo man sich an einer solchen Theorie versucht, ist die zentrale Frage, was der Gegenwart an Entwicklungen zugesprochen wird, die es erlauben, ihr einen Ort jenseits der Moderne zuzuweisen. Soll es das Abrücken von einem dogmatisch verfestigten, in einem bestimmten Epochenbild festgeschriebenen Begriff von Moderne und die Erneuerung des Dogmatismus der Offenheit sein, oder aber umgekehrt die Abkehr von dem Dogmatismus der Offenheit und Wiedergewinnung eines produktiven Verhältnisses zu den Traditionen von Kunst und Kultur und zu dem Institut der Traditionsbildung überhaupt? Streng genommen, müßte es sich eigentlich um ein Drittes handeln: um die Überwindung des „Konflikts der modernen Kultur“, des zum Automatismus erstarrten Hin und Her zwischen der dogmatischen Verfestigung neuer Formen und ihrer nicht minder dogmatischen Wiederauflösung – wie immer dies im einzelnen zu denken sein mag.
Erneuerung des Avantgardismus
Lublinski tritt für die zweite Option ein; er meint, in der Literatur der Zeitgenossen ein Erlahmen des Pathos der Innovation und eine neue Offenheit für das kulturelle Erbe, auch für das klassische Erbe, wahrnehmen zu können. Doch damit irrte er sich. Denn in dem gleichen Jahr 1909, in dem er seinen „Ausgang der Moderne“ vorlegte, trat F. T. Marinetti in Paris mit dem „Manifest des Futurismus“ an die Öffentlichkeit, das zur Initialzündung für eine ganze Reihe von neuen Avantgarden wurde, und gründete Kurt Hiller (1888–1972) in Berlin den „Neuen Club“, in dem die ersten Expressionisten zusammenfanden. Hier wie dort wurden die Forderungen der ersten Modernen [<<77] nicht einfach nur erneuert, sondern auf eine Weise zugespitzt, die ihnen eine besonders große Durchschlagskraft verschaffte, so daß das kulturelle Leben nun heftiger aufgemischt wurde als je zuvor. Damit hatte sich die Idee der Postmoderne fürs erste erledigt; der Avantgardismus ging in eine neue Runde.
Die Erste Moderne wird zur „klassischen Moderne“
Damit die Vorstellung von einer Postmoderne wirklich Fuß fassen und zu einem Kristallisationspunkt des Nachdenkens über die Moderne werden konnte, mußte die Welt erst sehr viel mehr an Avantgarden erlebt und an moderner Kunst und Literatur gesehen haben und mußte sich deren Wahrnehmung in ganz anderem Maße zum Bild einer Epoche verdichtet haben als zu Zeiten Lublinskis. So dauerte es bis in die sechziger, siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts, bis sich ein Postmoderne-Diskurs etablieren konnte.34 Wie sehr sich die Vorstellung von der Moderne als einer Epoche bis dahin verfestigt hatte, ist vor allem daran zu erkennen, daß man inzwischen begonnen hatte, von der Kunst und Literatur der ersten Dezennien des Jahrhunderts als von der „klassischen Moderne“ zu sprechen.
Das Prädikat klassisch zeigt an, auf welche Weise sich der Blick auf sie verändert hatte. Hier wie überall verweist es auf ein Zugleich von Distanz und Nähe. Einerseits konnte man die Kunst der Ersten Moderne nicht mehr als Kunst der Gegenwart empfinden, schaute man auf sie als etwas in geschichtliche Ferne Gerücktes, historisch Gewordenes zurück, und dies um so mehr, als eine dezidiert moderne Kunst und Literatur in der Zeit des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs fast völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden war, es inzwischen also wirklich so etwas wie einen „Ausgang der Moderne“ gegeben hatte. Andererseits fühlte man sich ihr aber auch wieder nahe, näher jedenfalls als der Kunst der Jahre 1933–1945; nicht umsonst hatte man sich nach dem Zweiten Weltkrieg darangemacht, „eine ähnliche Stilaufbruchsbewegung wie 1910–1920“ auf den Weg zu bringen, eine „Phase II“ der Moderne (G. Benn),35 eine Zweite Moderne, für die die Erste Moderne das klassische Vorbild war. [<<78]
Und so waren Autoren wie Gerhart Hauptmann und Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Franz Kafka und Robert Musil zu „Klassikern der Moderne“ geworden, zu „Autoritäten“, von deren Werken aus sich „Prinzipien“ einer modernen Literatur entwickeln ließen, ein „Ideal“ moderner Kunst, das sich als „Dogma“ handhaben ließ. Als Beispiel für solche dogmatischen Anstrengungen sei hier nur „Die Struktur der modernen Lyrik“ (1956) von Hugo Friedrich genannt, ein Werk, das für mehr als ein Jahrzehnt das Vademecum aller Jünger der Moderne war.
Wir wollen nicht überhören, daß in der Wendung „klassische Moderne“ zwei Begriffe zusammengebracht werden, die eigentlich nicht zusammenpassen. „Modern“ meint aktuell, „klassisch“ meint zeitlos. Den „Klassikern der Moderne“ soll es also gelungen sein, Werke zu schaffen, die zugleich aktuell und zeitlos wären. Das aber heißt nichts weniger, als daß in ihnen der „Konflikt der modernen Kultur“ gelöst wäre. In ihnen soll man Bildern des modernen Lebens begegnen können, die auch viele Jahrzehnte nach ihrer Entstehung noch nichts von ihrer Aktualität verloren hätten, denen die Modernisierungsdynamik mithin nichts hätte anhaben können. Sie sollen den Prozeß der Modernisierung zugleich repräsentieren und transzendieren, sollen sich in der Auseinandersetzung mit ihm, gerade mit ihm und nur mit ihm, einen Ort erobert haben, an dem sie selbst seiner Dynamik überhoben wären.
Die „Aporien des Avantgardismus“
Was immer von einer solchen Sicht der „Ersten Moderne“ zu halten sein mag – jedenfalls wurde der Begriff der „klassischen Moderne“ in den sechziger, siebziger Jahren zu gängiger Münze. Das war der Schlußstein in der Entwicklung, in der sich die Vorstellung von der Moderne als einer Epoche mit einem fest umrissenen, besonderen Profil heranbildete, ein letzter Schritt, der die Idee einer Postmoderne erneut und nunmehr mit besonderem Nachdruck auf den Plan rief. Die Diskussion, die sich an ihm entzündete, war wesentlich dadurch gekennzeichnet, daß man nun nicht mehr nur gegenüber den Vorstellungen auf Abstand ging, mit denen der Begriff der Moderne als Epochenbegriff dogmatisch gefüllt worden war, sondern auch gegenüber den Mitteln, mit denen der programmatische Modernismus solche dogmatische Verfestigung wieder aufzulösen pflegte.
Und in der Tat: wen sollte es nach einem Jahrhundert moderner Kunst und Literatur noch hinter dem Ofen hervorlocken, wen [<<79] provozieren oder animieren, beunruhigen oder beflügeln, wenn es zum x-ten Mal gegen den „Bann der Überlieferung“ geht und „Autoritäten“ ausgehebelt, „Konventionen“ aufgebrochen und „Formen gesprengt“ werden! Nichts klingt in den Ohren der Zeitgenossen vertrauter als dies, an nichts hat man sich so gründlich gewöhnen können. Insofern ist inzwischen nichts so wohlfeil, nichts weniger originell und riskant, als den programmatischen Modernismus der „Ersten Moderne“ noch einmal aufs Tapet zu bringen. Mit der Tradition zu brechen ist zu einem Ritual geworden, hat selbst die Gestalt einer Tradition angenommen, die eines Traditionsbruchs würdig wäre.
Botho Strauß: „Die Fehler des Kopisten“
So lautet jedenfalls die Diagnose, die Botho Strauß (geb. 1944) in „Die Fehler des Kopisten“ (1997) der Kultur der Gegenwart stellt. Strauß gehört zu den Autoren, die besonders gerne genannt worden sind, wo man nach deutschen Beispielen für eine postmoderne Literatur suchte. Bei „Die Fehler des Kopisten“ handelt es sich um ein zeitdiagnostisches Journal, das irgendwo zwischen Autobiographie, Essay und Prosagedicht angesiedelt ist, eine Form, wie man sie auch von Peter Handke (geb. 1942), etwa von dessen „Journal“ „Das Gewicht der Welt“ (1977) her kennt. Für Strauß ist das Brechen mit Traditionen und Sprengen von Formen in den Händen der Zweiten Moderne zu einem „Schredder“ geworden, in dem alles, was an neuen Möglichkeiten erprobt wird, sogleich wieder verschrottet wird, so daß sich kein künstlerischer Impuls mehr entfalten und kein Projekt mehr reifen kann. Anders als in der „klassischen Moderne“ bezeichnet es in der Zweiten Moderne keine „ästhetische Revolution“ mehr, nurmehr noch „den Ersatz einer eintönigen, sich immer wieder auffrischenden Pubertät der Kunst“. Aus dem „Reich der Jugend“, das Nietzsche gefordert hatte, ist „Jugendlichkeit als Zwangskultur“ geworden.
Tanz auf den Deponien der verbrauchten, weggeworfenen Güter, Anbetung von shredder-Türmen, nichts wird schneller historisch als Jugendzeiten in der Kunst. Die Nachkriegsperiode wird einmal als die Epoche in die Geschichte eingehen, die zwar die ewige Jugend nicht, dafür aber die ewige Jugendlichkeit als Zwangskultur erfand. Undenkbar, daß in ihr, wie in der klassischen Moderne, ein Künstler seinen Weg (wie T. S. Eliot) von Waste Land zu Four Quartets, (wie Igor Strawinsky) vom Sacre zu [<<80] Apollon Musagète hätte nehmen können. Das Neuklassische im Wandel eines Werks, das man gegen die wilden Anfänge gerne herabsetzt … und doch sieht man daran, wie sich ein Künstler bewegt und bewegen muß, sobald sein schöpferischer Spielraum die Kunstgeschichte wird und er seine Jugend nicht konservieren will. Es ist der natürliche Weg – wir haben es vergessen in einer Periode, die keine ästhetische Revolution kannte, wie es die Moderne war, sondern nur den Ersatz einer eintönigen, sich immer wieder auffrischenden Pubertät der Kunst. Sie behindert den Wandel durch Kunstgeschichte und erschwert es dem späten Werk, seren (heiter) und unberechenbar zu werden.
Das im Alter zunehmende Individuum wird in einer überalterten Gesellschaft eher eine Seltenheit sein. Ein perverser Konservativismus hält darauf, daß den Achtzigjährigen unverändert dasselbe bewegt wie den Fünfunddreißigjährigen.36
Von solchen Beobachtungen und Überlegungen aus entwickelt Strauß selbst wieder Sympathie für das Epigonentum, das die Bête noir der ersten Modernen war, für jene Haltung, in der die alten Römer dem Vorbild der Griechen folgten.
Wieviel mehr die Alten wußten und vermochten! (Und die Alten sind für uns die Heroen des beginnenden Zwanzigsten Jahrhunderts.) Diese empfindliche Achtung für die Überlegenheit der ‚Klassiker‘, wie sie in ‚römischen‘ Perioden immer wieder die Nachgeborenen ankam, scheint heute gänzlich verschwunden. Jeder hält sich für eigenartig und souverän genug, um von den Alten nur zu nehmen, was er für gewisse ironische Zwecke gebrauchen kann. (…) Seit Hitler, seit der Ära der „Bewältigungsproblematik“ sind katachronistische (unhistorische) Überheblichkeit oder Nonchalance beinahe das einzige Talent, mit dem der Gegenwartskünstler der Geschichte begegnet. Wie man aber aus unserer Zeit auf eine frühere herabschauen kann, das möchte mir einer begreiflich machen. Auch darin zeigt sich das Konservative einer Epoche der Jugendlichkeit, die zur Ideologie erstarrte.37 [<<81]
So bestreitet Strauß schließlich sogar, daß es sich bei dem Prozeß der Modernisierung wirklich um einen Prozeß, um einen „Strom“ und nicht bloß um eine Ansammlung von „Pfützen“ und „Lachen“ handeln würde. Eine Dynamik, die die Jugend nicht mehr erwachsen werden und kein Projekt mehr reifen läßt, die jeden Ansatz zu einer künstlerischen Entwicklung sogleich wieder dem Schredder der Aktualität überantwortet, ist keine, ist in Wahrheit „rasender Stillstand“ (Paul Virilio), „Kristallisation“ (Arnold Gehlen).
Angenommen gegen alle vorherrschenden Eindrücke, die moderne Welt sei eine übertrieben langanhaltende und träge Periode, eine eher statische Zeit, wo ein dichtes und doch begrenztes Spiel mit wechselnden Motiven immer weiter gespielt und nie durch ein wesentlich anderes ersetzt wird … seit hundert Jahren die gleichen Reflexionen der Befindlichkeit, noch mal Philister, Reichtum und ennui und immer noch die Gebote der Immoral nach Göttersturz, „nach Nietzsche“ ein volles Jahrhundert lang … dann tritt auf einmal das Dilatorische, das erweiterte Warten, der Aufschub in allem als das tiefere Zeitmaß hervor aus den vordergründigen Beschleunigungen.
Komödie des Epochenschwindels. Als habe sich etwas geändert. Als säßen wir nicht ein wie eh und je in unserer historischen Ausnüchterungszelle. Als würden wir nicht als hinfällige Agnostiker, Greise der Unreife und der Ratlosigkeit das Jahrtausend wechseln.
Das Geistige scheint wie die Pfütze auf den Schlammwegen, wenn die Sonne darauf fällt. Es wird sich aus den glänzenden Lachen kein Strom bilden.38
Diesem Zustand der „Kristallisation“ wird die Kunst nur entkommen können, wenn sie aus dem Bannkreis des Dogmatismus der Offenheit heraustritt und sich neuerlich Rechenschaft von der Bedeutung gibt, die Traditionen und Konventionen, Autoritäten, Dogmen und Formen für das kulturelle Leben haben, wenn sie erkennt, daß das schöpferische Leben ebensowohl auf Prozessen der Traditionsbildung wie auf der menschlichen Natur beruht, daß „life is tradition and human nature“. [<<82]
Von solchen Überlegungen waren die ersten Modernen noch weit entfernt. Sie konnten ja auch noch nicht wissen, daß sich ihr programmatischer Modernismus einmal genauso zu einem „Bann der Überlieferung“ auswachsen würde wie Klassizismus, Romantizismus und Realismus, hatten noch nicht erleben müssen, wie sich Kunst und Literatur darüber in den „Konflikt der modernen Kultur“, die „Aporien des Avantgardismus“ (Hans Magnus Enzensberger) verstrickten. Für sie standen ganz andere Fragen im Vordergrund, vor allem die, ob es ihnen gelingen würde, eine Formensprache zu schaffen, die den Erwartungen an eine wahrhaft moderne Literatur genügen könnte. [<<83]
15 Hans Robert Jauß: Literarische Tradition und gegenwärtiges Bewußtsein der Modernität. In: ders.: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt 1970, S. 11–66. – Hans Ulrich Gumbrecht: Modern, Modernität, Moderne. In: Otto Brunner u. a. (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 4. 2. Aufl. Stuttgart 1997, S. 93–131.
16 Arthur Rimbaud: Une saison en enfer (Eine Zeit in der Hölle). In: ders.: Sämtliche Dichtungen. Französisch und Deutsch. Reinbek 1963, S. 204–245, hier S. 242.
17 Peter Sprengel: Gerhart Hauptmann. Epoche, Werk, Wirkung. München 1984.
18 Gerhart Hauptmann: Das Abenteuer meiner Jugend. Frankfurt Berlin 1993, S. 716–718.
19 Arno Holz: Zum Eingang. In: ders.: Das Werk. Hrsg. v. Hans W. Fischer. Bd. 1. Berlin 1924, S. 3–12.
20 Edmond und Jules de Goncourt: Tagebücher. Frankfurt 1983, S. 54.
21 Wilhelm Raabe: Pfisters Mühle. Frankfurt 1985, S. 9.
22 Dominik Jost: Literarischer Jugendstil. 2. Aufl. Stuttgart 1980.
23 Winfried Speitkamp: Jugend in der Neuzeit. Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Göttingen 1998.
24 Sigrid Bias-Engels: Zwischen Wandervogel und Wissenschaft. Zur Geschichte von Jugendbewegung und Studentenschaft 1896–1920. Köln 1988.
25 Friedrich Theodor Vischer: Ästhetik. 3 Teile. Reutlingen Stuttgart 1846–1857. Teil 3, S. 1305.
26 Henning Ottmann (Hrsg.): Nietzsche-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart Weimar 2000.
27 Bruno Hillebrand (Hrsg.): Nietzsche und die deutsche Literatur. 2 Bde. Tübingen 1978. – Steven E. Aschheim: Nietzsche und die Deutschen. Karriere eines Kults. Stuttgart Weimar 1996. – Hans Ester, Meinert Evers (Hrsg.): Zur Wirkung Nietzsches. Würzburg 2001.
28 Johannes Mahr: Michael Georg Conrad. Ein Gesellschaftskritiker des deutschen Naturalismus. Markbreit 1986. – Gerhard Stumpf: Michael Georg Conrad. Ideenwelt, Kunstprogrammatik, literarisches Werk. Frankfurt u. a. 1986.
29 Agnes Strieder: „Die Gesellschaft“. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Zeitschrift der frühen Naturalisten. Frankfurt u. a. 1985.
30 Michael Georg Conrad: Jugend! In: Hillebrand (Anm. 27). Bd. 1, S. 99.
31 Werner Jung: Georg Simmel zur Einführung. Hamburg 1990. – Matthias Junge: Georg Simmel kompakt. Bielefeld 2009.
32 Gertrude Stein: Paris France. New York London 1940, S. 8.
33 Gottfried Willems: „Frei um zivilisiert zu sein und zu sein“. Das Verhältnis von moderner Kunst und Zivilisationskritik im Licht von Gertrude Steins „Paris Frankreich“. Erlangen Jena 1996.
34 Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Moderne. 2. Aufl. Weinheim 1988.
35 Gottfried Benn: Briefe an F. W. Oelze. Hrsg. v. Harald Steinhagen u. Jürgen Schröder. Bd. 2. Wiesbaden 1979, S. 225.
36 Botho Strauß: Die Fehler des Kopisten. München Wien 1997, S. 95.
37 Ebenda, S. 97.
38 Ebenda, S. 104–105.