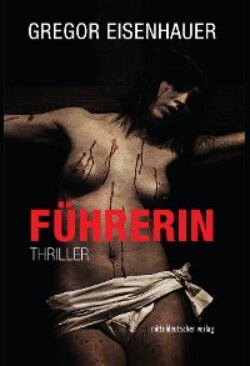Читать книгу Führerin - Gregor Eisenhauer - Страница 11
Donnerstag, 8. März, 13 Uhr
von Hausens Villa im Grunewald
ОглавлениеLudwig Müller von Hausen war es gewohnt, pünktlich zum Mittagessen daheim zu erscheinen. Von seinem Büro auf dem Kurfürstendamm bis zu seiner kleinen Villa im Grunewald waren es zwanzig Minuten Fahrzeit, die er – ganz gleich wie die Verkehrslage auch war – meist exakt einhielt, denn er kannte alle Schleichwege. Das war seine Art von Zuverlässigkeit. Seine Frau liebte seine festen Angewohnheiten, denn sie gaben ihr die Möglichkeit, ihn zielbewusst zu verletzen, wann immer ihr danach zumute war, und in letzter Zeit war ihr häufig danach zumute.
Als sie von Hausen kennenlernte, siebzehn Jahre war das nun her, da glaubte sie, das große Los gezogen zu haben. Als ob er sie je im Unklaren darüber gelassen hätte, wie er sie und ihresgleichen hasste. Aber sie fand das männlich, damals, diese ostentative Verachtung, die er ihr und ihrem Lebensstil entgegenbrachte. Ihr selbst ging es ja nicht anders. Sie stammte aus einer alten Westberliner Schauspielerfamilie und musste schon mit sechzehn ihre Abende in der Paris Bar verbringen. Ihre Mutter nutzte sie wie einen billigen Köder, um an die Regisseure und Produzenten heranzukommen. «Mein kleine süße Romy», so wurde sie angepriesen von ihr; «Ramona», korrigierte sie dann, «meine Name ist Ramona», aber den Fluch konnte sie damit nicht brechen. Sie hatte Romy Schneiders Lächeln – und eine ähnlich skrupellose Mutter, aber damit endeten auch schon die Gemeinsamkeiten. Sie wollte keine Karriere. Von der ersten Stunde an hasste sie die Film- und Fernsehleute, mit denen ihre Mutter sie bekannt machte. Sie hasste die Kokserei, sie hasste das hohle Lachen, die schlechten Manieren, den auftrumpfenden Narzissmus all dieser Ego-Darsteller. Nur – sie sah keinen Ausweg. Ihr Vater, Boulevardschauspieler der Art, die nicht mehr gebraucht wurde, deklamierte daheim vor dem Spiegel besoffen Monologe aus seiner Glanzzeit in den Achtzigern. Geld hatte er schon lange keins mehr verdient, und die wenigen Rollen der Mutter brachten gerade so viel ein, dass sie die Miete bezahlen konnten, meist jedenfalls. Für die Ernährung der Familie war seit dem sechzehnten Lebensjahr ganz allein sie zuständig. Was anfangs nicht schwerfiel. Die Rollen in den allabendlichen Soaps spielte sie mit einer Routine, die die Regisseure verblüffte, die aber für sie ganz selbstverständlich war. Sie hatte seit ihrer Kindheit eine Rolle gespielt, dagegen war der seifige Quatsch im Fernsehen ein Kinderspiel.
Mit siebzehn drehte sie den ersten abendfüllenden Spielfilm und wurde von einem der Hauptstadtredakteure zum Filmstar erklärt. Aus Dankbarkeit schlief sie mit ihm.
Das war ein Fehler, denn sie machte danach aus dem Abscheu vor seiner Person keinen Hehl. Er war nicht nur ein lausiger Liebhaber gewesen, er erwies sich vor allem als unglaublicher Dummkopf, und das nahm sie ihm persönlich übel, denn es entwertete jedes seiner Komplimente.
Ramona war sich ihrer Talente als Schauspielerin völlig sicher, nur wer sie als Mensch war, das wusste sie nicht. Nun kam dieser Zeitungsschreiber daher, erklärte sie zum Star und redete mit ihr, als wäre sie ein Kunstgeschöpf der Babelsberger Filmstudios.
Er wollte sie als Trophäe, nicht als Gegenüber. Er spürte ihre Verachtung und ließ fortan kein gutes Haar an ihr. Wer einmal zum Opfer der Regenbogenpresse gemacht wurde, erholte sich davon nur sehr schwer. Ihr war es gleichgültig, was die Blätter der Hauptstadt über sie titelten, sie wusste, er hatte die Gerüchte eingespeist in diesen Malstrom der Verleumdungen, in den sie nun geriet. Drogenkonsum war noch das Harmloseste, ein verleugnetes Kind, eine nicht zu therapierende Neigung zur Schizophrenie, pyromanische Attacken; dass sie nicht als Hauptverdächtige für die Autobrände in der Hauptstadt in Gewahrsam genommen wurde, erstaunte sie zuweilen selbst.
«Du musst aus der Schusslinie», befahl ihre Agentin und schickte sie damals vier Wochen nach Amerika, was ihr guttat. Das Elend dort machte sie zur Europäerin. Sie war plötzlich stolz auf ihre alten Heimat, auf das alte Europa. Sie empfand tatsächlich so etwas wie Patriotismus.
«So, und damit diese Journalistenkläffer dir nicht noch mal ans Bein pinkeln, besorgen wir dir einen guten Anwalt.»
So war sie mit Ludwig von Hausen bekannt geworden. Er brachte sie vom Koksen ab, das sie sich in Stresszeiten angewöhnt hatte, ohne dem verfallen zu sein, empfahl ihr eine Therapie, um das schlechte Gewissen ihren Eltern gegenüber zu lindern, und sprach mit ihr von Mensch zu Mensch. Ja, so altmodisch drückte er sich aus: «Mit Ihnen muss man von Mensch zu Mensch reden. Das hat vorher wohl noch niemand getan.» Sie diskutierten über Politik, ganz ernst und frei von Zynismus, er ging mit ihr spazieren, sie segelten auf dem Wannsee, spielten Tennis. Er war so bürgerlich, so erwachsen, sie hätte heulen können vor Glück. Er bot ihr seine Hand, lebenslang, sprach von den drei Kindern, die er sich von ihr wünschte, möglichst bald, und hielt bei ihrem Vater um ihre Hand an.
Es war ganz großes Theater, von allen Beteiligten. Sie glaubte, endlich im Leben angekommen zu sein. Sie wollte es glauben. Jetzt, im Nachhinein, war ihr klar, sie hatte sich vorsätzlich belogen, von Anfang an. Dennoch, dieser Aufbruch damals war so schön gewesen, selbst die Erinnerung daran hatte unter dem Alltag nicht gelitten.
Mit einer Energie, die durchaus mit Leidenschaft zu verwechseln war, wenn man von Menschen keine Ahnung hatte, entwarf von Hausen damals ihr gemeinsames Leben. Sie heirateten kirchlich, im Kloster Chorin, ein ganz kleiner Kreis von Menschen, die ihnen von Herzen alles Gute wünschten. So schien es ihr damals. Die Hochzeitsreise führte nach Siena, und er, der kühle Jurist, machte sie auf so leidenschaftliche Weise mit der Kunst der Toskana vertraut, mit den Bauwerken, den Plastiken, den Gemälden, dass ihr das Herz überging vor Gefühl.
Sie fühlte sich wie eine Prinzessin, die ihr neues Schloss bezog. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass er sie bewusst weich stimmte, auf dass sie schneller für Kinder bereit war. Er wollte ihre Liebe nicht für sich, es ging ihm um Kinder, drei an der Zahl, rasch geboren, deswegen tat er alles, sie romantisch zu stimmen, weich, aufnahmebereit. Er war berechnend auf eine Art, die sie nie für möglich gehalten hatte.
‹Du spinnst›, dachte sie, als ihr das erste Mal der Verdacht kam, dass er gar nicht sie meinte. ‹Du spinnst, er liebt dich, unglaublich aufrichtig altmodisch liebt er dich!›
Aber so war es nicht. Im ersten Jahr konnte sie es verdrängen. Sie wurde schwanger und die Freude über die Schwangerschaft verdrängte die Erinnerung an das körperliche Zusammensein mit ihm. Die zweite und dritte Schwangerschaft folgten rasch darauf. In den ersten fünf Jahren ihres Zusammenseins kam sie kaum einmal zum ruhigen Nachdenken.
Nach dem dritten Kind schlief er nicht mehr mit ihr. Es fiel ihr erst gar nicht auf, dann, als sie nachrechnete, wie lange er nicht mehr in ihr Schlafzimmer gekommen war, hielt sie es für normal. Väter sind zuerst Väter, dann Liebhaber. Aber er sah seine Kinder kaum an, und er sah sie nicht mehr an. Zugegeben, sie hatte keine sonderliche Freude daran gehabt, mit ihm zu schlafen. Es war nicht widerlich gewesen, wie mit dem Journalisten, es war seltsam, mit ihm intim zu sein.
Mit siebzehn war sie noch Jungfrau gewesen, dann entschloss sie sich, dem rasch ein Ende zu machen, und so war es auch gekommen. Es war die Umsetzung eines Entschlusses, mehr nicht. Ihr Freund damals war auch Schauspieler, sie selbst hatte gerade ihren ersten Auftritt in einer Daily Soap, es fiel ihnen beiden nicht schwer, eine glückliche Beziehung zu schauspielern. Aber der Sex war es nicht, er war nicht schön, er war nicht unschön, es war Gymnastik mit Wohlfühlgarantie. Er hatte Affären, sie hatte Affären, das war so verabredet und sicherte den Marktwert, aber keinen Mann hatte sie je mit Liebe berührt, und nie hatte ein Mann ihr Herz zum Beben gebracht. So wünschte sie es sich, ein wenig kitschig. Und auch wieder nicht. Eigentlich hatte sie absolut keine Vorstellung davon, was sie wirklich wollte. Als dann von Hausen in ihr Leben trat, wusste sie, sie wollte ihn. Mit ihm würde sich alles andere von selbst ergeben. Anfangs dachte sie auch wirklich, dieses Verliebtsein im Kopf würde automatisch irgendwann auch ihr Herz erreichen und ihren Körper erwärmen. Das war ein Irrtum. Mit ihm schlafen hieß intim werden. So drückte er sich aus. So gab er sich. Fehlte nur, dass er sich davor und danach in ihrer Gegenwart die Hände wusch. Anfangs schien es ihr nur eine Eigenart, dass er immer mit geschlossenen Augen dalag. Immer schien er an etwas anderes zu denken. An eine andere? Er dachte nichts, wenn er die Augen schloss. Schon gar nicht an eine andere Frau, oder an Männer, Knaben, Mädchen, was auch immer. Er dachte gar nichts. Es war ihm einfach nur zuwider. Aber das wurde ihr erst viel später klar.
Ihre Neugier wich langsam einem immer größer werdenden Groll, nicht gegen ihn, gegen die Liebe im Allgemeinen. Ihr Wille, alles gut machen zu wollen, machte sie blind für seine Reserviertheit. Sie gab sich selbst wie immer die Schuld an allem. Dank ihrer Mutter.
Er hatte von Anfang an Wert auf getrennte Schlafzimmer gelegt, die zwei Kindermädchen taten alles, um die Kinder von ihm fernzuhalten – das war sein ausdrücklicher Bescheid bei ihrer Einstellung gewesen. Und sie selbst – sie war nicht mehr da für ihn, einfach nicht existent. Anfangs tat sie das, was ihre Mutter sie gelehrt hatte. Sie zog sich hübsch an, elegant, verwegen, verrucht, streng – keine Rolle, die sie erprobte, verlockte ihn zum Applaus. Sie schmollte, zog sich zurück, begann ihm Szenen zu machen – nichts. Erst dann, nach Monaten, suchte sie das Gespräch.
«Warum …», sie hatte sich die Worte vorher sehr sorgfältig zurechtgelegt und die einfachsten gewählt, um sich nicht selbst zu verwirren, «warum lieben wir uns nicht mehr?»
Er stand mit dem Rücken zu ihr, am Schreibtisch, in seinem Arbeitszimmer, das einen so schönen Blick auf den Garten bot. Er drehte sich langsam um, elegant gekleidet, wie immer im dunklen Anzug, selbst an einem Samstag, da er nur zur Hause arbeiten musste.
«Was ist, mein Schatz», fragte er sie in sehr freundlichem Ton und sah sie eindringlich an. Es war klar, er hatte ihre Frage gehört, er hatte sie verstanden, er hatte sie sehr gut verstanden, aber er machte nicht die geringsten Anstalten, sie zu beantworten, er machte gute Miene zum bösen Spiel.
Sie war Schauspielerin genug, um ihn vollends zu durchschauen. Er hatte eine Rolle gespielt, er hatte sie gut gespielt, und sie war darauf hereingefallen. Sie hatte ihm vertraut, und sein Blick sagte nicht mehr und nicht weniger als: Spiel weiter! Keine Drohung, die Drohung lag nicht in seinem Blick oder seiner Gebärde, die Drohung stand im Raum, das Haus war die Drohung, alles um sie herum war Drohung, selbst ihre Kinder schienen jetzt zur Bedrohung zu werden, denn sie fesselten sie an diesen Mann, der ihr Unglück wollte. Sie spürte das erste Mal, was sie anfangs für Leidenschaft gehalten hatte, nun in seiner absoluten Reinheit: Sie spürte nur Hass in diesem Mann. Jede Faser war erfüllt davon, er war böse, so böse, dass er jeden anderen täuschen konnte, denn das war unmöglich, dass ein Mensch so ganz und gar böse war.
«Was ist, mein Schatz?» Das war die einzige Perfidie, die er sich erlaubte, ihre Frage zu wiederholen.
«Ach nichts», erwiderte sie, als hätte sie gerade nach seinen Wünschen fürs Abendessen gefragt, «nichts ist.»
Sie ging aus dem Zimmer, ohne die Tür hinter sich zu schließen, eilte in den Garten, umschlang einen Baum und rieb ihre Wange an der Rinde, bis sie Schmerz empfand.
Sie nahm den Kampf an. Mit ihrer Mutter konnte sie über ihre Gefühle nicht reden. Ihr Vater war ein Jammerlappen, was man von Ludwig wirklich nicht sagen konnte. Das war die Falle, in die ihr Stolz sie führte. Ludwig von Hausen war ein schlechter Mensch, der Teufel in Menschengestalt, so schien ihr, aber warum hatte er dann sie gewählt? Ausgerechnet sie? Die verzogene Tochter eines drittklassigen Schauspielerehepaars? Er war ein ganz besonderer Mann, anders als alle anderen, also musste sie eine ganz besondere Frau sein, anders als alle anderen Frauen. Das erfüllte sie zunehmend mit Stolz, je länger sie darüber nachdachte. Ihr Tatendrang regte sich. Sie wollte es ihm gleichtun. Anfangs nur in ihren Träumen.
Sie fragte sich zu keiner Zeit, worin denn nun seine Schuld genau bestand. Ob er Steuern hinterzog, Verbrecher deckte, in Drogen- oder Waffenkartellen tätig war, interessierte sie nicht. Sie wollte es einfach nicht wissen. Seine Schuld war in ihren Augen allein die, sie hintergangen zu haben.
Das würde sie ihm heimzahlen. Aber sie schwor sich, es – anders als ihre Mutter – nicht auf dem Rücken ihrer Kinder auszutragen. Sie tat alles, um ihren zwei Söhnen und der Tochter ein Heim zu geben. Klaus, dem Erstgeborenen, den es schon als Kleinkind zum Computer zog; Helmar, dem Introvertierten, der malte und musizierte, und Lisa, die ihr persönlich als Mädchen so fremd war, weil sie sich völlig normal entwickelte und so uneitel war. Gute Kinder, aber ein herzliches Gefühl empfand sie für keines von ihnen. Am ehesten vielleicht noch für Helmar, er war viel femininer als Lisa, aber er gab ihr auch deutlich zu verstehen, wie sehr er sie dafür verachtete, dass sie ausgerechnet diesen Mann geheiratet hatte. Seinen Vater, den er so abgrundtief hasste, dass er Akne davon bekam. Helmar begriff gar nicht, dass sie Komplizen waren. Noch nicht. Aber er würde es schon noch begreifen.
Fünfzehn Jahre hatte sie damit verbracht, die Kinder vergessen zu lassen, dass ihr Vater nicht für sie da war. Nicht weil er so viel arbeitete, sondern weil er als Vater gar nicht existierte. Es war ihr gelungen. Jetzt war es an der Zeit, an sich selbst zu denken.
Ludwig Müller von Hausen schloss die Haustür auf. Er stand still im Atrium und lauschte. Die Kinder waren noch in der Schule. Sie besuchten ein Tagesinternat in der Nähe von Potsdam und kehrten erst spätnachmittags heim. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie dort auch wohnen können – aber das wäre ihnen und seiner Frau nur schwer zu vermitteln gewesen.
Die Haushälterin kam erst gegen vier wieder, wenn es das Abendessen zu richten galt. Er stellte seine Aktentasche ab, zog den leichten Sommermantel aus und hängte ihn in die Garderobe.
Er war sich sicher, dass seine Frau zu Hause war und mit einer Überraschung aufwartete. Sie überraschte ihn gern, und er kam nicht umhin, sie für ihre Ausdauer zu bewundern. Sie schien sich immer noch als seine Partnerin zu fühlen, als Komplizin, obwohl er ihr dazu nie Anlass gegeben hatte. ‹Ein eigenwilliges Ding›, dachte er spöttisch. Er war sich gar nicht mehr sicher, ob er sie selbst töten würde, eigenhändig, das wäre ein fast zu intimer Abschied.
Er schritt langsam die Treppe hoch. Links lagen die Zimmer der Kinder. Helmars Tür stand wie immer offen. Ihm Ordnung beizubringen war völlig sinnlos. Eine Künstlernatur ohne jeden Funken von Disziplin, in einem so heruntergekommen Körper, dass es ihn jedes Mal anwiderte, seinen Sohn sehen zu müssen. Lisa war anders, sie war stolz auf ihre sportliche Gestalt, zu Recht. Sie machte immer eine gute Figur. Beim Tennis, beim Hockey, beim Reiten. Für seine Tochter empfand er so etwas wie Stolz, sie schien neben ihm der einzige Mann im Haus. Über Klaus und was aus ihm werden würde, geworden wäre, mochte er erst gar nicht nachdenken.
Rechts lagen die zwei Schlafzimmer, getrennt durch das Ankleidezimmer. Ihre Tür stand offen. Das leise Lachen war nicht mehr zu überhören. Es stammte von einem Mann.
Ludwig von Hausen ging langsam auf die leicht geöffnete Tür zu. Er war sich ziemlich sicher über das, was ihn erwarten würde. Diese Situation hatte er in den letzten Jahren schon einige Male erlebt. Sie schlief mit ihren jeweiligen Favoriten gern im Schlafzimmer, sofern die Tür offen stand. Sie tat es aber auch im Wohnzimmer, im Garten, in der Küche. Das erste Mal, als er sie ertappen sollte, hatte sie sich von einem in Berlin nicht unbekannten Preisboxer in der Garage penetrieren lassen. Er fand kein anderes Wort dafür. Denn genau so sah es auch aus, nach einem gewalttätigen Eingriff.
Er sah das gutmütig erstaunte Gesicht des Mannes noch vor sich, der Sekunden zuvor voll Stolz die Gattin des bekanntesten Anwaltes der Stadt gegen die sorgsam aufgestapelten Winterreifen gepresst hatte, den Rock gehoben, ihre langen Beine in den schwarzfelligen Pumps mit den Knien auseinandergedrückt, die eine Hand fest in ihrem Nacken, die andere auf ihrem hochgestellten Hintern.
Der Mann trug Jeans, daran erinnerte er sich noch genau, und blaue Shorts, die ihm zwischen den Beinen hingen. Er ruckelte sich mit der Besessenheit eines Spitzensportlers in sie hinein, und von Hausen war damals fast versucht gewesen zu applaudieren, so sportlich schien ihm diese Veranstaltung. Wäre da nicht der Blick seiner Frau gewesen, die ihn von unten her unverwandt anstarrte. Er erkannte in ihren Augen etwas, was er so nur von sich zu kennen glaubte, Hass, reinen Hass.
Der keineswegs ihm galt, das begriff er in der Folge, er galt dem Schicksal, das sie beide zusammengeführt hatte.