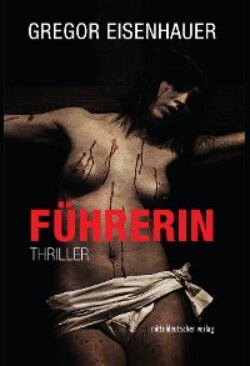Читать книгу Führerin - Gregor Eisenhauer - Страница 7
Mittwoch, 7. März, 10 Uhr
Dorint Plaza Hotel, Konferenzraum
Оглавление«Meine Damen und Herren, wir glauben die Welt zu kennen, in der wir leben. Unsinn! Wir leben längst in einer anderen Welt. Wir werden längst von anderen Mächten regiert. Fakten! Nehmen Sie die Fakten zur Kenntnis! Der amerikanische Geheimdienst verfügt mit Facebook über das effektivste Spionage-Tool, das je existierte. Eine Milliarde Zuträger und täglich werden es mehr. Die Agents lesen unseren Twitter-Verkehr, kennen unsere E-Mails, sie wissen, was wir denken, was wir fühlen, essen, trinken und verdauen! Sie haben unsere medizinischen Daten und unsere Arbeitsakten gescannt. Alles, was je elektronisch erfasst wurde, ist in den Archiven der Geheimdienste. Ein zweites Ego von uns existiert längst als Daten-Klon. Warum wir uns nicht empören? Weil wir davon nichts wissen wollen! Die Welt ist uns zu kompliziert geworden! Der Clou an der Sache: Die Agents sind nicht die Schlimmsten. NSA und CIA hinkten schon immer ein wenig hinterher. Alles, was die CIA kann, kann die Mafia besser. Sie haben die besseren EDV-Spezialisten und sie haben die größere kriminelle Energie. Die italienische Mafia, die russische Mafia, die chinesische Mafia, die Triaden Hongkongs. Die kriminellen Geheimbünde haben die Welt unter sich aufgeteilt. Nicht alle sind noch so mächtig, wie sie es einmal waren. Die Katholiken schwächeln. Das Opus Dei ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Freimaurer schwächeln. Die Illuminaten sind im Altersheim. Stark, sehr stark hingegen und sehr jung ist eine Bewegung, die von einer ungemein faszinierenden Frau geführt wird, ich habe sie bereits im Publikum entdeckt. Willkommen, Ayn Goldhouse! Wie war noch der Tarnname ihres Amazonenbundes? Nymphomania? Bleibt nur zu hoffen, dass ihre weiblichen Führungskräfte dem Stress irgendwann nicht mehr gewachsen sind und der Kinderwunsch siegt!»
Charles Klimt kicherte in sich hinein, als würde er seinem Publikum keinen einzigen vernünftigen Gedanken zutrauen. Die Zuhörer wiederum schüttelten den Kopf über diesen Wahnsinnigen, dessen Weltruhm in einem so krassen Missverhältnis zu seiner Erscheinung stand. Ein kleiner dicker Mann mit hochrotem Kopf, der jeden Augenblick zu explodieren drohte. Sein Bluthochdruck schien nicht weniger lebensbedrohlich für ihn als sein cholerisches Temperament. Er trug einen schlecht sitzenden grauen Anzug, den er offensichtlich achtlos im Reisekoffer verstaut hatte, und stützte sich auf einen schwarzen Gehstock mit silbernem Knauf, den er im Laufe des Vortrages zornig auf den einen oder anderen unruhigen Zuhörer richtete. Seine Krawatte hatte er schon vor Beginn der Rede gelockert, und je länger er sprach, desto weiter zog er den Knoten nach unten, als wollte er seinen Kopf aus einer Schlinge befreien. Ein Wahnsinniger, so dachten die meisten, was ihr Vergnügen an seinem Auftritt keineswegs schmälerte. Im Gegenteil: Sie erhofften einen Eklat, deswegen waren sie schließlich gekommen.
Der Vortragssaal im hoch gesicherten Dorint Plaza Hotel war voll besetzt. Ein handverlesenes Publikum aus Historikern, Publizisten und Verlegern, von denen nicht wenige noch immer ihre Einladungskarte verteidigungsbereit in den Händen hielten, denn die zehnfache Zahl an Interessierten hatte sich vergeblich um Einlass bemüht.
Charles Klimt hatte die Anwesenden eine halbe Stunde warten lassen, entsprechend groß war anfangs die Unruhe im Raum gewesen. Jeder fühlte, dass etwas Besonderes geschehen würde, etwas Unerhörtes, Skandalöses, und keiner konnte sich eines unguten Gefühls der Nervosität erwehren, obwohl klar war, dass sie, die Zuhörer, nur Statisten in einem Drama sein würden, das Klimt zu seinem alleinigen Vergnügen zu inszenieren gedachte.
Die Ausgänge des Vortragssaals waren durch Bodyguards gleich mehrfach gesichert, die Leibesvisitation bei der Einlasskontrolle war von ungewohnter Strenge gewesen, das Gerücht eines möglichen Anschlags hatte sich im Flüsterton verbreitet und sorgte für zusätzliche Unruhe – und für ein seltsames Gefühl gefährlicher Exklusivität.
Vor dem Hotel hatte sich, wie immer wenn Charles Klimt irgendwo auf der Welt zu einem seiner seltenen Vorträge erschien, ein Trupp fanatisierter Gegner eingefunden, die drohend ihre Transparente schwangen. «Tod dem Antichrist!» – «Auf den Scheiterhaufen mit dem Gottesleugner!» Oder einfach nur: «Satan! Hebe dich hinweg!» Eine Bezeichnung, die abwegig schien, wenn man den kleinen kurzatmigen Mann so bemüht stramm und aufrecht hinter seinem Rednerpult stehen sah.
Nach seiner Eingangsfrage, die ihm einen ersten verhaltenen Applaus eingebracht hatte, hielt er einen Moment inne. Von der Aufregung draußen war im Hotel selbst nichts zu spüren. Diskret hinter Klimt postiert wachten zwei weitere Muskelpakete über den ruhigen Ablauf des Abends. Schräg, im Halbschatten des Vortragenden, kontrollierte Klimts Sekretär die Szenerie.
«Meine Damen und Herren, es gibt tausend gute Gründe, an die Existenz des Teufels zu glauben, aber keinen einzigen, der uns von der Existenz Gottes überzeugen könnte. Ersparen Sie mir im Folgenden die Tortur, die Weltgeschichte des letzten Jahrhunderts zu rekapitulieren oder gar die Zahlen der Opfer zu listen, die im Krieg, in den Konzentrationslagern, in den Gulags, auf den Killing Fields abgeschlachtet wurden. Ersparen Sie mir, die Folterkeller aufzuzählen, in denen die Bestie Mensch ihrem Namen alle Ehre machte, ersparen Sie mir, an all das Unrecht zu erinnern, von dem wenige profitieren und an dem viele, viel zu viele, zugrunde gehen, ohne Gehör zu finden. Schenken Sie mir stattdessen Vergessen, bin ich zuweilen geneigt zu bitten, leihen Sie mir Ihren stumpfen Sinn, Ihre tauben Ohren, Ihren blinden Blick, Ihren ruhigen Schlaf. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich mich so umsehe und die serielle Ausdruckslosigkeit Ihrer Gesichter mit der Leere Ihrer Herzen verrechne, dann empfinde ich Naivität keineswegs mehr als ein Geschenk, sondern als einen Fluch, weit ärger noch als Krankheit, Siechtum und Tod. Offen gesagt, meine eigene Schlaflosigkeit erscheint mir da plötzlich als Geschenk!»
Die ersten Buhrufe wurden laut. «Unverschämt!» – «Wir sind doch nicht hier, um uns beleidigen zu lassen!» Selbst die gelasseneren Zuhörer raunten einander zu: «Alberne Publikumsbeschimpfung! Mal wieder sehr emotional der Herr! Dient wohl der Show!»
Die Ordner blickten grimmiger. Aber die Aufregung legte sich schnell, schließlich war allen Anwesenden klar, dass sie genau deswegen gekommen waren. Entsprechend süffisant war das Lächeln Klimts, der ein wenig vom Rednerpult zurückgetreten war, aber nun seinen Mund wieder ganz nah ans Mikrofon brachte, weil so sein zorniges Flüstern umso vernehmlicher durch den Saal drang. «Lassen Sie mich sprechen vom Antichristen, in dreifacher Gestalt. Dem Menschen, der das schlimmste Unheil über die Welt bringen wird. Die Olympiade der Teufel, wenn Sie so wollen. Es gibt nicht wenige Südstaatler, der Gesinnung oder der Geografie nach, die den amerikanischen Präsidenten schon aufgrund seiner Hautfarbe für den Antichristen halten, einen Antichristen mit marxistischem Glaubensbekenntnis. Das ist natürlich Unsinn. Nähern wir uns der Sache objektiv. Fakten! Warum handelt es sich bei Barack Obama um den Antichristen? Zählen Sie die Buchstaben seines Namens: Barack Hussein Obama – sechs Buchstaben plus sieben plus fünf –, achtzehn, dreimal die Sechs. Six hundred and sixty six is the number of the beast. Sie zweifeln? Der missglückte Eid, erinnern Sie sich. Er ist Linkshänder. Hexen grüßen den Teufel stets mit der Linken. Das Fahrzeug, die gepanzerte Limousine, in der er nach der Vereidigung davonfuhr, trägt den Spitznamen: das Biest! Der Segen, gesprochen von einem Evangelisten, von einem der falschen Heiligen der letzten Tage mit Namen Rick Warren, rechnen Sie die Fakten zusammen: Wahrlich, er ist der Antichrist! Er ist das Werkzeug falscher, weil auf das Unmögliche gerichteter Hoffnungen. Es war kein Akt waghalsiger Prophetie, ihm eine unglückliche Regierungszeit vorherzusagen – der Beiname Hussein sagt alles, meine Damen und Herren! Kein Mann, der Hussein hieß, war je wirklich vom Glück gesegnet. Salem aleikum, Saddam!
Wir leben in satanischen Tagen. Der Antichrist ist unter uns, in vielfacher Gestalt.» Klimts Tonfall wurde höhnisch. Sein Blick musterte die Zuhörer so voller Hass, dass nicht wenige den Blick senkten. Ertappt bei einer Sünde, von der sie keine Ahnung hatten.
Der Papst taugt nicht mehr als der Antichrist. Denken Sie an die Quote. Denken Sie politisch korrekt. Zumindest eine Frau muss im Vorstand sein! Der Antichrist in weiblicher Gestalt. Ich bin kein Feminist, wie Sie wissen. Ich weiß nicht, wer die Zahl aufgebracht hat, aber es steht wohl außer Frage, dass der Feminismus und die Ideologie der weiblichen Selbstbestimmung mehr Menschenleben gekostet haben als alle Kriege der Menschheit. Wer ein ungeborenes Kind ermordet, zerstört eine werdende Familie. Wer kinderlos bleibt, beraubt sich selbst der Macht über die Familie. Wer herrschen will, braucht die Macht über die Kinder. Nichts ist lächerlicher als eine kinderlose Frau, die über die Zukunft aller redet! Einige Frauen haben das inzwischen kapiert. Das neue Matriarchat ist im Werden. So viel darf ich Ihnen schon jetzt verraten, das wird kein Spaß für uns Männer. Die zukünftige Herrin der Welt? Sie sitzt im Publikum. Und der Dritte im Bunde, der schlimmste aller Antichristen? Ohne mir schmeicheln zu wollen, das bin ich selbst! Sie lachen. Lachen Sie! Erheitern Sie mein Herz. Denn wissen Sie, was das Schöne an diesen Thesen ist? Sie können sie nicht widerlegen. Was ich bislang vorgetragen habe, sind Fakten: Fakten, die in einem verschwörungstheoretischen Erklärungsmodell der Welt sehr überzeugend sind, von unwiderlegbarer Evidenz geradezu. In einem nichtreligiösen Erklärungsmodell sind sie von indiskutabler Nichtigkeit. Das Gerede eines Wahnsinnigen. Wer wollte sich die Mühe machen, einen Wahnsinnigen zu widerlegen – vor allem, mit welchen Argumenten? Nun, der Wahnsinnige behält recht, wenn die Katastrophe tatsächlich eintritt. Die Apokalypse. Die Machtübernahme Satans.
So weit, so gut. Ich weiß, dass ich mich in diesen Dingen gern wiederhole … und einen gewissen Hang zum Pathos mögen Sie einem alten Mann verzeihen!»
Klimts Kichern ließ die Anwesenden frösteln. ‹Dieser Mann ist komplett wahnsinnig›, schienen einige zu denken, aber kaum, dass sein Blick auf ihnen ruhte, sei es durch Zufall oder weil ihr unwillkürliches Kopfschütteln auf sie aufmerksam machte, verabschiedeten sie den Gedanken schon wieder. In diesem alten, teigigen Gesicht glühten Augen, die an alles denken ließen, nur nicht an Irrsinn.
«Sie werden sagen, nichts Neues, was er vorbringt! Hirngespinste eines alten Mannes! Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nur um eins, schärfen Sie den Blick für die Spur des Bösen in der Gegenwart. Das Böse kann sich stets nur wiederholen, weil die vermeintlich Guten sich seiner Wirkungsweisen nicht erinnern. Das frohe Blöken der Schafe ist Musik in den Ohren des Wolfs!»
«Krank, oder?!» – «Der kotzt sich ja mal wieder ganz schön aus!» – «Und täglich gib uns unseren Weltuntergang!» – «Geschwätz!»
Zwei Dutzend Journalisten waren in einem Nebensaal versammelt worden, damit sie dort ungestört per Videoübertragung dem Vortrag folgen konnten. Im Hauptsaal waren sie unerwünscht, denn Klimt hegte eine tiefe Abneigung gegen die «nuttige Journaille», so sein Lieblingsausdruck, für den er etliche Varianten hatte, die alle gleichermaßen vulgär im Ton waren.
«Ein durch und durch unsympathischer Zeitgenosse, wenn Sie mich fragen. Ein Spinner, aber nicht ohne Charisma!» Martina Claasen schien es bei diesem Urteil belassen zu wollen.
Der Chefredakteur des Internetmagazins NewsOnline klopfte noch einmal bekräftigend mit seinem Füllfederhalter auf den Tisch, denn er applaudierte sich zuweilen gern selbst.
«Ja, ja, schön und gut, aber was halten Sie von seinen Thesen?» Er wandte sich an seine Mitarbeiterin, die gelangweilt die Beine übereinandergeschlagen hatte. Sehr lange Beine, wie er nicht umhin kam festzustellen. Zumindest da hatte sie keinen Schaden genommen. Sie wirkte grazil wie immer. Umso mehr überraschte ihr rüder Tonfall.
«Ich kann dieses Endzeitgequatsche nicht mehr hören, egal von welcher Seite es kommt. Die Welt ist schlecht, tolle Neuigkeit, was geht es mich an!?»
«Stopp! Ich schätze Ihre flapsige Art, aber nur im Umgang mit Ihren Interviewpartnern! Also bitte … konzentrieren Sie sich und teilen Sie mir Ihre vorurteilsfreie Meinung über Herrn Klimt mit! Etwas mehr Substanz könnte dabei nicht schaden!»
Martina Claasen, fünfunddreißig, Kurzhaarfrisur, ein wenig zu blass für ihre sehr durchtrainiert wirkende Figur, musterte mit kaum verhaltenem Spott ihren Chef. Wäre ihr seine blasierte Neugier nicht seit Jahren vertraut gewesen, sie hätte ihm offen ins Gesicht gegähnt. Stattdessen schien sie hoch konzentriert nach den passenden Worten für ihren Unmut zu suchen, was Schauspielerei war, denn ihre Einschätzung von Klimt stand fest. Er erinnerte sie in zu vielem an ihren eigenen Vater, als dass sie sein cholerisches Gepolter hätte ernst nehmen können.
An den anderen Tischen im Videokonferenzraum herrschte aufgeregtes Getuschel, jeder schien mit dem Auftritt Klimts beschäftigt zu sein, aber Martina spürte sehr wohl, dass viele neugierige Blicke, die absichtslos durch den Raum zu schweifen schienen, ihr und ihrem Chef galten. Seit über einem halben Jahr waren sie nicht mehr gemeinsam zu sehen gewesen, und vieles war gemunkelt worden, darunter das Absurdeste, was sie sich überhaupt nur vorstellen konnte, dass sie beide nun endgültig ein Paar geworden seien und sie sich deshalb von der vordersten Reporterfront zurückgezogen hatte.
Äußerlich betrachtet sprach nichts gegen die Kupplerfantasien der Kollegen, das musste Martina zugeben, als sie ihren so geduldig wartenden Chef mit geradezu sentimentaler Neugier musterte – denn acht Monate waren eine lange Zeit in ihrem Milieu und die Wiederbegegnung wenige Stunden zuvor im Redaktionsbüro war nur kurz gewesen.
Ludger Kehrtmann wirkte so smart, dass es fast schon schmerzte. Dabei war er keineswegs eitel, seine Vorliebe für teure Schreibgeräte und Hightech-Rennräder ausgenommen. Er trug gute, aber nicht zu teuer wirkende Anzüge, solides Schuhwerk, in Handarbeit gefertigt, eine Uhr, die er von seinem Vater geerbt hatte und der wiederum von seinem, bis zurück zu Urururgroßvaters babylonischen Tagen. Überhaupt die familiäre Tradition! Sein Großvater war Leiter eines bedeutenden Verlages gewesen, sein Vater Herausgeber einer bedeutenden Tageszeitung, und Kehrtmann war sich seines guten gesellschaftlichen Umgangs von Kindesbeinen an bis in den letzten Nerv seiner Wahrnehmung derart bewusst, dass es schon eines Frankensteins als Gegenüber bedurft hätte, um ihn zu einem irritierten Blinzeln zu bewegen. Martina gegenüber empfand er allenfalls Mitleid, so schien es ihr in diesem Moment. Als Frau hatte er sie noch nie wahrgenommen, warum auch, eine Heirat wäre ohnehin nie infrage gekommen, und als Geliebte ließ sie all das vermissen, was er sich unter einer zahmen, dekorativen und in Maßen temperamentvollen Mitfahrerin so vorstellte. Wobei sie nicht einmal wusste, ob er überhaupt ein Auto hatte. Aber wenn, saß er garantiert immer selbst am Steuer.
Rein körperlich verband die beiden eine herzliche Abneigung schon seit den Tagen, als sie noch im Printjournal zusammengearbeitet hatten. Für sie war Ludger Kehrtmann immer der Strichjunge der Anzeigenkunden gewesen; für ihn verkörperte sie die altmodische Form investigativen Zeitvertuns.
Martina konnte sich noch gut daran erinnern, als sie ihm das erste Mal begegnet war. Ihr Vater hatte sie damals in sein Büro geschleift. Sie selbst hätte lieber im Buxtehuder Stadtanzeiger volontiert, aber ihr Vater hatte sie bekniet, diese Chance ihres Lebens, wie er es immer nannte, doch nicht so leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Was das Schlimme war: Er hatte natürlich recht. Die Chance auszuschlagen, bei einem der besten Nachrichtenmagazine Europas anzuheuern, nur weil der eigene Vater den Fürsprecher gab, wäre selten dämlich gewesen. Aber peinlich war die Situation dennoch.
Ihr Vater vegetierte damals im letzten Stadium seiner Trunksucht. Er hielt sich noch einigermaßen gerade, aber wer genauer hinsah, bemerkte die Verfallserscheinungen nur allzu deutlich. Sein Äußeres wies all die Spuren der Vernachlässigung auf, die ein alleinstehender Mann, der jeden Sonnenaufgang mit einem Wasserglas Wodka begrüßte, nicht mehr vertuschen konnte, weil er den Blick in den Spiegel erst gar nicht mehr wagte. Schlecht rasiert, im nicht mehr waschbaren Cordsakko, das Hemd leicht fleckig, die Schuhe seit Monaten nicht geputzt – sie konnte alle Einzelheiten lebhaft erinnern, denn dieses Bild seines Abschieds vom Berufsleben hatte sich ihr eingebrannt. Und dann war da noch dieser Geruch gewesen, eine unsägliche Mischung aus Schweiß, Alkohol, billigem Waschmittel – und Angst. Ja, er hatte Angst gehabt damals, dass seine Stellung und sein Ruf nicht mehr genügen würden, ihr das Entree zu verschaffen. Das war das Schlimmste gewesen, das war das, was sie Ludger Kehrtmann niemals verzeihen würde, dass er ihren Vater ängstlich erlebt hatte.
Kehrtmann wäre allerdings nicht Kehrtmann gewesen, wenn er diesen Auftritt ihres Vaters nicht taktvoll ignoriert hätte. Er wusste schon lange, wie es um ihren Vater stand, er hatte ihm unerwartet viel Freiraum gegeben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht einfach nur, weil in Monatsabständen noch immer ein akzeptabler Artikel von ihm erschien, aber der Blick, mit dem er ihn musterte, als sie in sein Büro traten, war von einer solchen Kälte gewesen, dass sie am liebsten sofort wieder gegangen wäre.
Kehrtmann hatte die Mappe vor sich liegen gehabt, in der einige ihrer Reportagen versammelt waren, die sie für diverse Berliner Zeitungen geschrieben hatte. Er schlug sie auf, ohne hineinzusehen, schlug sie wieder zu.
«Sie haben Talent. Ohne Zweifel!» Im gleichen Tonfall hätte er auch sagen können: «Sie haben Neurodermitis.»
«Wir wollen es mit Ihnen versuchen. Zudem: Ihr Vater hat Sie wärmstens empfohlen, und wir in der Redaktion wissen alle, was wir an Ihrem Vater haben» – in Gedanken setzte er hinzu: ‹Vor langer Zeit hatten.›
Der Deal war klar. Das wusste sie, das wusste ihr Vater. Kehrtmann verfügte über die Gabe, andere seine Gedanken lesen zu lassen – wenn er es wollte. Ihr Vater würde sich dezent aus der Redaktion verabschieden, ohne auf eine unanständig hohe Abfindung zu bestehen, und sie würde seine Stelle einnehmen. «Unser ganz privater Generationenvertrag», witzelte ihr Vater nach dem Gespräch, das er als seinen Erfolg verbuchte – und sofort zum Anlass nahm, sich ins nächste Koma zu saufen. Er hatte es sich ja verdient!
Ihr Vater hatte seinen Vertrag auslaufen lassen, ohne noch groß einen Finger zu rühren. Sie selbst zerriss sich in den folgenden Monaten, um den Verdacht zu ersticken, dass sie ihre Stelle nur seiner Protektion zu verdanken hatte. Und eins musste sie zugeben: Auf professioneller Ebene verstand sie sich gut mit Kehrtmann.
«Die Arbeit der Redaktion wird sich in den nächsten Jahren ein wenig anders gestalten», hatte er ihr im Folgegespräch verkündet. «Wir werden gar nicht umhinkommen, uns von den bürgerlichen Journallesern zu verabschieden und uns intensiver den Onlineanalphabeten zu widmen.» Seinen Sinn für Ironie konnte sie nie teilen, aber sein strategisches Denken konnte sie nachvollziehen.
Er hatte den richtigen Riecher in diesen Dingen. Die Onlineredaktion wurde ausgelagert, das Team radikal verjüngt, die Themenauswahl modisch frisiert.
«Wir wollen, dass die Leute für diese Themen zahlen, also müssen wir ihnen auch Themen bieten, für die sie bezahlen wollen. Die Zeiten der feuilletonistischen Bevormundung sind vorbei. Also bitte, keine Premierenbesprechung aus Bottrop, keine Rezension eines jungen hochbegabten georgischen Naturlyrikers und erst recht keine Gesinnungsprosa. Personality sells. Denn das fehlt unseren Lesern: ein Ego. Also bitte: ganz schlicht. Geschichten von Menschen über Menschen. Egal ob Politik, Wissenschaft oder Kultur. Es muss menscheln!»
Der Erfolg hatte ihm recht gegeben, ihn aber auch mit der Aura einer unendlichen Langeweile umgeben, die er selbst wohl als Unangreifbarkeit definiert hätte. Die Folge war, dass in der Redaktion die schlimmsten Gerüchte über sein Privatleben kursierten. Das Gerede endete, als er seine Verlobte vorstellte. Das heißt, sie stellte sich selbst vor, so als wollte sie allen weiblichen Redaktionsangestellten mitteilen, dass Ludger Kehrtmann von nun an vergeben war. Martina hatte sie nur einmal gesehen vor ihrem Tod. Als das Unglück geschah, war sie auf einer dreimonatigen Recherchereise in Afrika.
Als sie wiederkam, lief alles wie gewohnt. Kehrtmann ließ sich nicht anmerken, wie stark ihn diese Tragödie mitgenommen hatte. Er trug nach wie vor die besten Anzüge, gab sich kollegial, aber nie anbiedernd, und steuerte die Geschicke seiner Redaktion mit ruhiger Hand, als wäre er schon im Kindergarten zum Kapitänsanwärter berufen worden. Es war zum Kotzen. Alles, was sie sich gewünscht hätte, war, ihn einmal dabei zu ertappen, wie er heimlich an seinen Nägeln kaute. Oder sich mit den Fingern die Nase schnäuzte. Oder sich die Brusthaare unterm Hemd kraulte. Ein unsinniger Wunsch. Ein Wunsch, für den sie sich inzwischen sogar schämte. Denn er hatte sie trotz ihrer Erkrankung nicht fallen gelassen – was ein Leichtes für ihn gewesen wäre.
«Also, was halten Sie davon? So Sie denn geneigt sind, sich wieder mehr auf die Arbeit zu konzentrieren und weniger auf meine Person.»
«Das wird von dem abhängen, was er noch bringt. Bis jetzt hat er ja nur seine dreifach verdauten Besserwissersprüche wiedergekäut! Alles ein wenig vorgestrig! Um nicht zu sagen senil!»
«Senil, meinen Sie?» Kehrtmann musterte sie nachdenklich. Irgendwie wirkte er nicht ganz bei der Sache. Das konnte aber auch Ablenkung sein. Er irritierte seine Gegner gern durch eine gewisse blasierte Gleichgültigkeit. Und seine Mitarbeiter waren Gegner für ihn. «Apropos: Die Locken standen Ihnen übrigens besser! Nur so nebenbei.»
Kehrtmann hatte, das musste sie auch jetzt wieder zugeben, einen unfehlbaren Instinkt für die Schwachstellen seines Gegenübers, im Guten wie im Bösen. Genau das wollte er mit seiner Bemerkung über ihre Frisur unter Beweis stellen.
Ihre Chemotherapie lag sieben Monate zurück, und obwohl ihre Haare langsam wieder wuchsen, sie würde sie niemals wieder lang und lockig wachsen lassen! Denn das Bild, das hatte sie sich geschworen, wollte sie nie wieder vor Augen haben: Wie all ihre Haare auf dem Boden gelegen hatten, an dem Tag, als sie die Perücke kaufen ging, zwei Wochen nachdem sie die Diagnose erhalten hatte. Sie wollte damals den Tag nicht abwarten, bis sie sich die Haare büschelweise vom Kopf reißen konnte.
«Sie können mich mal … an ihren Figaro verweisen! Aber mein Problem ist im Augenblick ehrlich gesagt ein ganz anderes: Warum bin ausgerechnet ich hier und keiner unserer Geschichtsnerds fürs Angegilbte?»
«Das werden Sie gleich erfahren, aber lassen wir ihn erst mal wieder zu Wort kommen.»
Beide hatten mit halben Ohr auf Klimts Vortrag gehört. Sie waren professionell genug, um den rhetorischen Ballast von den Kernaussagen trennen zu können. An seinem Tonfall merkten sie, dass er langsam zur Sache kam.
«Warum ich nach Berlin gekommen bin, in die ehemalige Reichshauptstadt, Hitlers ‹Germania›, in die Höhle des Löwen sozusagen, ich, ein sterbenskranker alter Jude, meine Damen und Herren, weil ich mich Ihnen zum Fraß vorwerfen will! Denn hier in Berlin hat der Teufel seinen Hauptwohnsitz. Was denken Sie denn, warum ich sonst hier bin?!» Klimt lachte höhnisch und fuchtelte wild mit seinem Gehstock ins Publikum. Übergangslos verfiel er wieder in einen dozierenden Tonfall. «Wenn wir das Böse verstehen wollen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit seinen hervorragendsten Vertretern schenken, und das ist keiner dieser Serienkiller in Nadelstreifen, an denen sich unsere Krimidamen, sei es lesend oder schreibend, so zartfühlend delektieren. Das Böse ist im letzten Jahrhundert in vielfacher menschlicher Gestalt auf die Bühne der Weltgeschichte getreten: Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot – die unheilige Quadriga des Schreckens. Nun, Mao ist tot, und er hat keinen Nachfolger gefunden. Stalin ist tot, und niemand ist gewillt, sein Erbe anzutreten, Pol Pot desgleichen. Der Kommunismus hat sich selbst erledigt. Der Rassismus nicht, der Antisemitismus schon gar nicht. Gut, das wissen Sie natürlich. Was wissen Sie nicht? In welcher Gestalt der Teufel tatsächlich überlebt hat! Obama ist es nicht, das war nur ein Scherz auf Ihre Kosten. Sie sind doch politisch korrekt, oder?» Er lachte kurz auf. «Der Papst ist es nicht, und ich bin es auch nicht, obwohl ich mich noch recht fit fühle!»
Klimt legte eine Pause ein und stützte sich affektiert auf seinen Gehstock. Das Publikum wurde unruhig. Keiner im Saal hatte die geringste Ahnung, worauf er eigentlich hinauswollte, und nicht wenige bereuten inzwischen, überhaupt erschienen zu sein. Das war zu spüren, aber Klimt fuhr in bewusst ruhigem Ton fort.
«Hitler ist tot, aber Hitler war nur der ranghöchste, schauspielerisch begabteste Repräsentant des Nationalsozialismus. Nicht sein Ideologe. Hitler wollte Deutschland untergehen sehen, weil er sich selbst untergehen sah, aber das sagt nur etwas über seine Eitelkeit aus und nichts, gar nichts über das Wollen der nationalsozialistischen Elite, die sich ja – bis auf die wenigen Nürnberger Sündenböcke – unbeschadet ins neue Deutschland hinüberretten konnte. Oder nach Argentinien weiterzog, nach Chile, nach Paraguay, in den Nahen Osten.»
Er schnaufte kurzatmig, als wäre er selbst auf der Flucht.
«Wissen Sie, zuweilen kommt mir ein Bild in den Kopf. Adolf Eichmann, Sie kennen ihn, den Verantwortlichen für die Judentransporte in die Gasöfen, Eichmann, der eine neue Heimat in Argentinien gefunden hatte, wurde, lange vor seinem Prozess, von einem Interviewer gefragt, ob er etwas bedauere. ‹Ja, natürlich bedauere ich etwas›, antwortete Eichmann. ‹Ich bedauere, dass wir nur sechs und nicht zehn Millionen Juden vergast haben.›»
Klimt legte erneut eine kurze Pause ein, ohne den Blick vom Pult zu heben. Ein Raunen ging durchs Publikum, als er mit einem kleinen Kichern in der Rede fortfuhr.
«Wissen Sie, was an diesem Bedauern auffällig ist? Nicht das Ungeheuerliche der Tatsache, dass er weitermorden wollte. Das versteht sich, Eichmann war ein böser, böser Mensch, da werden Sie mir alle zustimmen. Auffällig, im moralischen Sinn, ist vielmehr dieses Bedauern Adolf Eichmanns. Dieses Bedauern war aufrichtig! Wie kann ein böser Mensch aufrichtig sein?!»
Klimt stützte beide Hände breit aufs Pult und fixierte sein Publikum mit einem abschätzigen Blick, als traute er den hier Versammelten gar nicht zu, seine Worte in ihrer wirklichen Bedeutung zu verstehen.
«Meine Damen und Herren, es gibt nichts Lebendigeres als unversöhnlichen Hass! Nichts Wahreres! Nichts Ehrlicheres! Glauben Sie mir, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Was daraus folgt? Ganz einfach: Dieser Hass erledigt sich nicht einfach mit der Hinrichtung Eichmanns. Diese Bande von Verbrechern, die sich Nationalsozialisten nannten, hat Europa in den Abgrund gestürzt, Russland an den Rand der Niederlage gebracht, die Alliierten zur Aufbietung all ihrer Kräfte gezwungen und nebenbei sechs Millionen Menschen vernichtet, weil sie Juden waren. In nur zwölf Jahren! Was für eine logistische Meisterleistung! Das meine ich gänzlich ohne Ironie. In der Technologiegeschichte des Bösen nehmen die Deutschen den Spitzenrang ein, mit weitem Abstand. Maos Kulturrevolution, Stalins Liquidation der Kulaken, die Massaker der Roten Khmer, der Völkermord in Ruanda … all das erscheint dagegen wie das Werk von Amateuren. Und die Historiker wollen uns glauben machen, dass diese Elite des Bösen keinen Gedanken an eine Fortexistenz verschwendet hat?! Ich bitte Sie, das ist lächerlich!»
Klimt schnaufte empört, als wäre er persönlich beleidigt worden. «Ungeheuerlicher noch als diese Verbrechen ist die Dummheit all derer, die glauben, mit der Kapitulation des Deutschen Reiches sei der Nationalsozialismus erledigt gewesen! Die Fluchtwege waren längst ausgekundschaftet, riesige Summen Geldes außer Landes geschafft, Scheinfirmen gegründet, und wozu das alles? Weil diese Funktionäre des Schreckens in sonnigeren Ländern beschaulich als Privatiers und Rentner ihr Leben zu fristen gedachten? Was für ein Unsinn, meine Damen und Herren, was für ein lächerlicher, was für ein gefährlicher Unsinn!»
Klimt schüttelte müde den Kopf. Er zog ein Taschentuch aus seiner zerbeulten Jacketttasche und wischte sich wiederholt die schweißnasse Stirn, dann steckte er es achtlos wieder weg und holte tief Luft.
«Lächerlich.»
Das Publikum verharrte in angespannter Stille. Klimt wusste, dass er nun die Zuhörer in seinen Bann gezogen hatte – und er genoss es, indem er sich Zeit ließ mit dem Fortgang seiner Rede.
«Meine zentrale Überlegung ist: Die Historiker haben bislang zwar zur Kenntnis genommen, dass die Nazielite früh die Niederlage ahnte, früh Asylmöglichkeiten suchte und fand – aber, so mein Einwand, doch nicht nur, um ihr Leben zu retten! Unsinn. Sie wollten den Fortbestand der nationalsozialistischen Ideologie sichern! Ihr vordringliches Ziel war nach wie vor … die Macht! Beweise? Beweise werde ich zuhauf bringen! Zuhauf, meine Damen und Herren, zuhauf! Aber lassen Sie mich zunächst einen Witz erzählen, damit Ihnen das alles nicht so verbissen erscheint, was ich Ihnen vortrage, einen jüdischen Witz selbstredend: Ein frommer Mann kommt verzweifelt zum Rabbi. ‹Rabbi, ich habe nur einen Sohn und der ist jetzt Christ geworden, was soll ich tun?› Der Rabbi bittet sich Bedenkzeit aus, er muss mit Gott darüber reden. Eine Woche später kommt der fromme Mann wieder: ‹Rabbi, was haben Sie erfahren?› Der Rabbi sagt: ‹Schau, mein Lieber, Gott hat gesagt, er hatte auch nur einen Sohn, und der ist auch Christ geworden!› – ‹Und was hat Gott gemacht?›, will der Mann wissen. ‹Ein neues Testament.›»
Klimt lachte scheppernd.
«Ein neues Testament! Das ‹Neue Testament›! Was für eine geniale Pointe. Vor allem – wie leicht zu übertragen. Hitler, meine Damen und Herren, hat kein politisches Testament hinterlassen. Er begnügte sich mit der Ordnung seiner privaten Hinterlassenschaft und dem Nerobefehl: ‹Möge Deutschland mit mir untergehen!› Wie gesagt, er war ein eitler Mann, der sich in seinem Tun erschöpft hatte. Er selbst war der größte Volksschädling. Ganz anders die ihm nachgeordneten Funktionäre, allen voran: Alfred Rosenberg. Der Name sagt Ihnen nichts oder nur wenig? Der ‹Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts› – sein Hauptwerk. Alfred Rosenberg war Hitlers Chefideologe und Ideengeber. Darüber hinaus war er ein williger und sehr geschickter Handlanger. Im Zweiten Weltkrieg ging er mit seinem Einsatzstab ‹Reichsleiter Rosenberg› auf Raubzug durch ganz Europa, als Leiter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete trieb er deren Germanisierung voran, soll heißen, er war einer der Organisatoren der systematischen Judenvernichtung. Im Nürnberger Prozess wurde Rosenberg als Hauptschuldiger der NS-Kriegsverbrechen angeklagt, in allen vier Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. So viel zu den Fakten, die viele kennen. Nun zu den Fakten, die nur wenigen bekannt sind. Rosenberg führte zeitlebens Tagebuch, ein politisches Tagebuch, wie es sich bei seinem Charakter von selbst versteht. Diese Tagebücher, die zeitlich bis zum Ende des Krieges reichten, lagen dem alliierten Gericht, namentlich dem Ankläger Robert Kempner, in Auszügen vor. Aufgrund ihrer Brisanz wurden sie allerdings unter Verschluss gehalten – und verschwanden. Böse Zungen behaupteten, Kempner habe sie unterschlagen, was Blödsinn ist, er hat mehrfach darauf hingewiesen, dass er selbst zeitlebens auf der Suche nach diesem Tagebuch war. Im Übrigen» – Klimt kicherte – «alle, die glauben, hier würde ein Märchen ähnlich wie das von Hitlers Tagebüchern erzählt, mögen in die nächste Bibliothek gehen und sich kundig machen. Ich sehe ja an Ihrer Unruhe, dass Sie geneigt sind, meinen Ausführungen mit Misstrauen zu begegnen, Ihr gutes Recht. Mein Recht ist es, Ihnen und dieser Heerschar verblödeter Historiker die Kompetenz abzusprechen, die Fakten vorurteilsfrei zu deuten.»
Klimts Sekretär trat an das Stehpult und schenkte Wasser in das halb volle Glas. Sein Chef winkte ihn unwirsch beiseite, aber die kleine Geste der Beruhigung, sei sie verabredet gewesen oder auf eigenen Einfall des Sekretärs hin erfolgt, brachte ihn wieder ein wenig zur Besinnung.
«Zu den Fakten: Rosenbergs Aufzeichnungen galten und gelten als verschollen. Am dreißigsten Jahrestag der Machtergreifung erschien in einem deutschen Nachrichtenmagazin die Meldung, dass im sowjetischen Außenministerium geplant sei, zwei Bände der Rosenberg-Tagebücher zu veröffentlichen. Die Meldung war einfach von der sowjetischen Presse übernommen worden und erwies sich als falsch. Jede Nachfrage bei den russischen Behörden blieb ohne Antwort. Jede weitere Nachforschung schien aussichtslos.»
Klimt klopfte wiederholt mit seinem Gehstock auf den Boden.
«Vollkommen aussichtslos. So auch der Befund meiner lieben historischen Kollegen, die ich um Rat fragte. Von welcher Seite kam Hilfe? Meine Damen und Herren, zuweilen kann man die Ironie des Schicksals gar nicht genug belächeln! Eine Nachricht, die auch vielen Laien nicht entgangen sein dürfte: Die Verliese des vatikanischen Archivs öffneten sich vor einiger Zeit. Ahnen Sie, was das für einen Historiker bedeutet, meine Damen und Herren?! Stellen Sie sich vor, die Mafia hätte über Jahrzehnte hinweg penibel Buch geführt über all ihre Untaten, über all die Politiker, die von ihr geschmiert wurden, über all die Komplotte, die je mit den Mächtigen der Wirtschaft geschmiedet wurden, Band um Band eine Chronik des Grauens! Und nun erst die katholische Kirche! Nein, nein, ich weiß, Sie erwarten, dass mir Schaum vor den Mund tritt und ich nun eine meiner gewöhnlichen Brandreden gegen diese schlimmste aller spirituellen Verbrecherorganisationen halten werde. Keinesfalls. Ich bewundere die katholische Kirche für die organisatorische Effizienz ihrer Machtausübung. Ich bewundere sie für ihre vatikanische Bibliothek und ihr Archiv. Das Gedächtnis der Menschheit! Gut, ein wenig einseitig sortiert, aber was für ein Schatz an Geheimwissen! Annähernd zwei Jahrtausende spionierten Priester und Laien im Namen des Allmächtigen alles und jeden aus, der in den Ruch kam, der Kirche schaden zu können!»
Klimt schien kurz vor einem Herzinfarkt, so heftig schnaufte er.
«Ahnen Sie etwas? Ahnen Sie, wie umfangreich die Dossiers über all die Mächtigen der nationalsozialistischen Bewegung sind? Nein, Sie können es nicht ahnen, denn es übersteigt Ihre Vorstellungskraft. Ja, ich gebe es gern zu, selbst meine Erwartungen wurden übertroffen! Jeder weiß, dass der Vatikan sich mit Hitler einließ, weil er um die Zukunft der Kirche in einem Reich völkischen Glaubens bangte. Jeder weiß, wie wenig die Antisemiten in Soutane getan haben, um die Judenverfolgung zu verhindern. Alles bekannt, alles bekannt, wenn auch ungern gehört. Aber in welchem Ausmaß die vatikanischen Spitzel die Führungskräfte der NSDAP observiert haben, hat selbst mich überrascht. Allen voran – ja, Sie werden es nicht glauben, allen voran Alfred Rosenberg. Er, der Chefdenker der Nazis, war der ärgste Feind, die gefährlichste Bedrohung der vatikanischen Kamarilla. Er hielt nichts vom Christentum, nichts vom Papst, er wollte eine germanische Religion und war deshalb von Beginn an im Fadenkreuz der Inquisitoren. Jede Schrift von ihm, jedes Buch, jede wichtige Akte in Abschrift, findet sich im Vatikan, natürlich auch das Manuskript seiner Erinnerungen, kurz vor Kriegsende verfasst – und sein Tagebuch!»
Im Saal wurde es mit einem Schlag dunkel. Auf der Leinwand hinter dem Stehpult wurde es blendend hell. Ein Raunen ging durch den Saal. Einzelne standen auf, Stühle fielen. Aber der Schock über das Bild, das auf die Leinwand projiziert wurde, bannte die Leute an ihre Plätze.
Klimt blickte mit sichtlicher Genugtuung auf die erschrockenen Gesichter vor ihm. Er wies mit seinem Gehstock in die große Runde der Zuhörer.
«Ich sehe, dieser Mann hinter mir ist Ihnen allen noch ein Begriff. Aber ich sehe an Ihren erstaunten Gesichtern auch, dass Sie den Zusammenhang mit dem bisher Gesagten noch nicht ganz nachvollziehen können?! Keine Sorge, das wird bald der Fall sein. Dieser hässliche und sehr böse Mensch hinter mir ist Charles Manson. Richtig, jener Charles Manson, der durch das Tate-LaBianca-Massaker seinen luziferischen Ruhm erlangte. Noch immer sitzt er in Haft, seine Gnadengesuche wurden selbstredend abgelehnt. Sein Mythos, die Verkörperung des Bösen schlechthin zu sein, der ist allerdings überlebensgroß. Nun, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf ein Detail dieses fotografischen Porträts zu richten. Sehen Sie es, Sie sehen es! Zwischen den Augenbrauen: ein Hakenkreuz! Nein, keiner der Mithäftlinge hat es ihm eingeritzt. Das würde keiner wagen. Seine Herrschaft dort ist unbestritten. Also, woher kommt dieses Tattoo? Er hat es sich selbst tätowieren lassen. Charles Manson ließ sich ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren?! Warum wohl? Ein Spinner, sagen Sie, ein Spinner. Sicher, ein Spinner! Das erklärt ja alles hierzulande.»
Klimt verkostete die Worte mühsam mit den Kiefern mahlend, als wollte er bewusst ihren bitteren Nachgeschmack spüren. Müde stützte er sich auf seinen Gehstock. Sein herrischer Seitenblick wies den Sekretär an, das Licht im Saal wieder anzustellen. Mit einem kleinen, bösen Lächeln beobachtete er, wie einige sich die Hände vor die geblendeten Augen schlugen.
«Keine Sorge, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende. Ich fasse mich kurz. In den Tagebuchaufzeichnung von Alfred Rosenberg finden sich detaillierte Angaben zum Unternehmen ‹Barabbas›, jenes Unterfangen, das den Fortbestand der nationalsozialistischen Ideologie und den Endsieg über das Judentum sichern sollte. Ein Dokument des Fanatismus, aber ein Geniestreich der Strategie. Geld war ausreichend außer Landes geschafft worden. Die Elite der SS konnte entweder im eigenen Land untertauchen oder fand – dank tätiger Mithilfe des Vatikans wie des italienischen Roten Kreuzes – eine neue Identität im Nahen Osten oder in Südamerika. Dieser lose Verbund alter Kameraden trug über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Historiker haben das immer bestritten, weil die Zeitzeugen es bestritten haben. Aber die Zeitzeugen waren mehrheitlich Komplizen der Nazis!»
Klimts Stimme überschlug sich vor Empörung.
«Ja, glauben Sie denn, ein Adolf Eichmann gibt offen und ehrlich Auskunft über die Pläne und Ziele der untergetauchten Nazis! Lachhaft! Wie naiv muss man sein? Wie gutgläubig? Halt, werden Sie einwenden, gut und schön, der Wahn lebte fort, die materiellen Mittel waren gegeben, aber ausrichten konnten diese Altnazis doch nichts mehr, waffen- und machtlos wie sie waren. Meine Damen und Herren, das ist leider ein Irrtum. Die Macht», Klimt tippte sich demonstrativ an den Kopf, «die Macht sitzt hier! Hier ist der Ursprung des Bösen. Die überlebenden Nazis wussten sehr genau, was sie wollten, und sie wussten sehr genau, wie sie es umsetzen mussten. Die Organisation ‹Barabbas› ist strukturiert wie ein Orden, Schweigepflicht, Eintrittsgelübde, sorgsame Selektion der Novizen. Rosenberg hatte die Fluchtwege so aufgefächert, dass nahezu weltweit in jedem Land eine kleine schlagkräftige Einheit operieren konnte. Ihr Ziel? Fanatiker heranzuziehen. Herrenmenschen, Instrukteure des Grauens. Glauben Sie mir eins: Krebszellen vermehrten sich schon immer schneller als gesunde Zellen!»
Klimt musterte mit einem bösen Rundumblick all jene, die zweifelnd den Kopf schüttelten, und das waren nicht wenige. «Ich weiß, in der verkürzenden Überschau klingt das verwegen, wenn nicht gar ein wenig romanhaft: Instrukteure des Grauens. Nun ja, aus eigener Kraft, meine Damen und Herren, wird keiner zum Fanatiker. Es braucht immer einen Geburtshelfer des Wahnsinns. Wer, glauben Sie wohl, hat Charles Manson auf die Idee gebracht, Sharon Tate mitsamt ihrem ungeborenen Kind abschlachten zu lassen, diesen blonden Engel an der Seite des Juden Roman Polanski, dessen Mutter, im sechsten Monat schwanger, nach Auschwitz deportiert worden war. History repeats!»
Bei den letzten Worten Klimts erlosch erneut das Licht. Auf der Leinwand hinter ihm wuchsen aus einem nebeligen Grau die Türme des World Trade Centers, bis sie im überscharfen Kontrast den Raum zu dominieren drohten. Klimt schien es gar nicht zu bemerken, sondern fuhr ungerührt in seinem Text fort.
«Die einzig verlässliche Macht, das einzig Berechenbare und somit Beherrschbare im Menschen ist das Böse. Es geht um das Neue Testament, um das Neue Testament des Schreckens. Sie glauben mir nicht? Nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass mich keiner verfolgt.»
Klimts Kichern blieb ohne Echo beim Publikum, aber darauf hatte er auch nicht gehofft. Er nahm einen Schluck Wasser, räusperte sich und fuhr in ruhigem Tonfall fort.
«Die Zerstörung des World Trade Centers. Die Schleifung des Turms zu Babel. Meine Damen und Herren, was glauben Sie, wie viele Verschwörungstheorien sind derzeit im Umlauf? Unzählige, versteht sich, Unzählige. Eine abstruser als die andere, und doch haben sie eins gemein: den Zweifel an der Fähigkeit einer kleinen islamischen Terrorgruppe, einen solch genialen Anschlag zu planen und durchzuführen. Dieser Zweifel ist begründet! Die Terrorgruppe des Herrn Mohammed Atta hätte, auf sich allein gestellt, nicht einmal einen Supermarkt in Brand setzen können. Was mich so sicher macht? Sehen Sie in die Gesichter dieser Männer, studieren Sie ihre Lebensläufe, das waren Befehlsempfänger! Fragt sich zwangsläufig: Wer waren ihre Instrukteure? Das Pentagon, das Weiße Haus, das World Trade Center, die Trias der amerikanischen Macht, das politische, das wirtschaftliche, das militärische Haupt mit einem Schlag geköpft! Wir sind uns über die Schändlichkeit dieses Anschlags einig, sicher, aber was für ein genialer Plan. Ausgeheckt von kamelreitenden Islamisten – lächerlich!
Das Böse ist vor Ort, sei es in Gestalt eines scheinbar geistig verwirrten Handlangers wie Charles Manson oder einer hocheffizienten Hamburger Terrororganisation, die eben nicht den Namen Osama Bin Ladens trägt. Ich kann verstehen, wenn Sie Beweise fordern – Sie werden mich verstehen, wenn ich im Interesse meiner ganz persönlichen Dramaturgie diese Beweise erst im nächsten Vortrag vorlege. Die finale Demütigung der Siegermacht Amerika, das war ein Ziel der ‹Operation Barabbas› – und es wäre ihnen beinah gelungen. Nun ja, den Rest erledigt die Gier der Wall Street, was Rosenberg übrigens schon in den Zwanzigerjahren vorhergesagt hat. Das zweite Ziel der ‹Operation Barabbas›: die Vernichtung des Staates Israel. Da stehen die Chancen schon besser. Ersparen Sie mir ihre Unmutsäußerungen, ich weiß, es klingt zynisch, was ich vorzutragen habe, aber Sie können mir nicht den Zynismus der Fakten anlasten.
Fakt ist: Die Gründung des Staates Israel wurde von den Juden weltweit als Emanzipationsakt gefeiert. Man glaubte sich sicher im eigenen, im gelobten Land. Das ist die eine Sehweise. Nun die andere: Werfen Sie einen Blick auf die Landkarte des Nahen Ostens, vergegenwärtigen Sie sich die Größe des Staates Israel, seine Grenzziehungen, eingeschlossen vom Meer, von der Wüste, von feindlichen Nachbarn. Dieser Staat Israel ist ein ziviles Konzentrationslager, geleitet in eigener Regie, immerhin, aber nichtsdestotrotz ein großes, komfortables Gefängnis mit erschwertem Freigang.»
Das feindselige Flüstern im Publikum wurde zum Raunen, empörte Zwischenrufe, einige drängten zum Ausgang, andere machten Anstalten, das Podium zu stürmen. Klimt, dem die Anstrengung des Vortrags inzwischen deutlich anzusehen war, richtete sich auf und schrie ins Mikrofon.
«Stopp. Schluss mit Ihrem dummen Gezeter! Hören Sie mich zu Ende an! Fakten! Erster Fakt: Israel ist ein One-Bomb-Country, so die militärische Ausdrucksweise, die nichts anderes besagen will, als dass eine Atombombe genügt, den Staat der Juden vom Erdboden verschwinden zu lassen. Zweiter Fakt: Der Iran, da sind sich alle Geheimdienste dieser Welt einig, wird in spätestens fünf Jahren über die Bombe verfügen, und das nicht zuletzt dank der Beihilfe deutscher Wirtschaftsunternehmen, die jahrzehntelang enge Verbindungen zum Iran pflegten! Es versteht sich, dass die ‹Operation Barabbas› ihren Teil, den entscheidenden Teil, dazu beigetragen hat. Die Bombe, meine Damen und Herren, wird fallen! Israel wird vernichtet werden.»
Klimt wischte sich mit einem Taschentuch die schweißnasse Stirn und fuhr mit erschöpfter Stimme fort.
«In meinem nächsten Vortrag werden Sie erfahren, wer genau die Drahtzieher sind! Aber ich fürchte, dazu wird es leider nicht kommen … Denn meine Ermordung steht unmittelbar bevor!» Klimts letzte Worte gingen im allgemeinen Tumult fast unter. Die Ordner öffneten eilends die Türen. Der Sekretär zog Klimt zu einem der hinteren Ausgänge, seine Bodyguards stellten sich drohend davor.
«Irrsinn, das ist der totale Irrsinn!» Die Stimmen im Journalistenraum gingen wild durcheinander. «Der Mann ist durchgeknallt.» – «Ganz Israel ein KZ – das ist immerhin eine hammergeile Schlagzeile.» – «Der hat sich um Kopf und Kragen geredet!»
Es war keine Empörung zu spüren, eher Genugtuung, dass sich hier einer selbst hingerichtet hatte und die Story nun genüsslich ausgeschlachtet werden konnte.
Kehrtmann hatte sich mit Martina Claasen in eine stillere Ecke des Raums zurückgezogen. Vor ihnen ein Monitor, auf dem das Standbild von Klimts Abgang eingefroren schien.
«So was Irrsinniges hab ich lange nicht gehört!» Martina schüttelte verständnislos den Kopf.
«Nun ja, diesen Vorwurf musste sich Kopernikus auch gefallen lassen.»
«Sie wollen doch nicht andeuten, dass Sie auch nur ein Wort von diesem Merchandising-Gequatsche ernst nehmen! Der will sein Buch verkaufen, mehr nicht!»
«Ich stelle zunächst einmal fest, dass Sie viel zu emotional reagieren, wie übrigens die meisten im Publikum. Ich stelle weiter fest, dass Klimt eine interessante Perspektivenverschiebung gelungen ist, er sieht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel, was drittens, wenn ich Sie erinnern darf, genau unser Job ist. Fragen stellen, interessante Fragen stellen, die die Dinge durchaus auch mal auf den Kopf stellen dürfen.»
Martina sah ihren Chef an, als wäre er ihr geradewegs vom Planet der Unwissenden direkt vor die Füße gefallen. Er seinerseits wirkte hingegen einfach nur amüsiert.
«Klimt ist ein Unsympath der Sonderklasse, das gestehe ich Ihnen sofort zu, aber was sagt das über die Qualität seiner Argumente?»
«Das kann ich Ihnen sagen.» Martina äffte Kehrtmanns Tonfall nach. «Weil ich Ihnen zuliebe den doch sehr vagen Begriff Unsympath präzisieren kann: Er ist ein egomanisches, hypercholerisches Superarschloch! Was sagt das über seine Argumentation? Ganz einfach, wenn er die Wahl hat, wird er immer das spektakulärere Faktum, das schillerndere Argument, den irrsinnigeren Beweis wählen, weil er sich selbst damit besser ins Scheinwerferlicht rücken kann. Er ist kein Wissenschaftler, sondern ein profitgeiler Hochstapler!» Martina Claasen fuhr sich gewohnheitsmäßig durch die Haare, Kehrtmann lächelte ein wenig seltsam. Sie hoffte für ihn, dass sich dieses Lächeln auf ihre Worte und nicht auf ihre Frisur bezog. Sie fand ihre kurzen Haare schrecklich hässlich, und obwohl sie selbst wusste, dass es völliger Unsinn war, glaubte sie, dass es allen anderen genauso ging.
«Sie haben vollkommen recht. Aber was sagt das über die Qualität seiner Argumente?»
«Haben Sie mir überhaupt zugehört?» Martina blinzelte ihn böse an. «Dieser absurde Verschwörungsquatsch über eine Bande seniler Altnazis bedient nur die Empörungslust und die Skandalgeilheit unserer lieben Kollegen. Sehen Sie sich doch um in diesem Irrenhaus hier!»
Kehrtmann schlug die Beine übereinander und blickte gelangweilt auf die noch immer aufgeregt debattierende Schar der ihm altbekannten Hauptstadtjournalisten.
«Liebe Kollegin, was ich sehe, gibt ihm recht! Punkt eins, sein Marketing-Coup, so er denn als solcher geplant war, ist gelungen. Dieses Buch wird sich millionenfach verkaufen. Punkt zwei, wo er recht hat, hat er recht, oder? Der weiblich harmonisierende Blick auf die Welt hat sich doch als ein wenig trügerisch erwiesen. Das Böse regiert. Weniger metaphysisch gesprochen: Das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass der Iran in wenigen Jahren über Atomwaffen verfügt. Wir stehen kurz vor dem Abgrund, ein nuklearer Konflikt ungeahnten Ausmaßes droht, Israel plant bereits den Präventivschlag …»
«Und Klein Adolf kehrt aus dem Kyffhäuser zurück und rüstet zum ultimativen Endsieg?! Tut mir leid, ich konnte mit Weltuntergangszenarien noch nie etwas anfangen. Alles heiße Luft.»
Kehrtmanns Blick ruhte ruhig auf ihrem Gesicht. Er schätzte ihre Intelligenz, daran hatte er nie einen Zweifel gelassen, aber er vermisste zuweilen bei ihr den Mut, die Gesetze der beruflichen Logik außer Kraft zu setzen und das ganz andere zu denken. Martina wiederum spürte sehr genau, was er von ihr erwartete, aber sie hätte sich eher eine Pappnase aufgesetzt als zuzugeben, dass die Atombombendrohungen des Iran und die «Operation Barabbas» sie einen Dreck interessierten, solange sie die Ergebnisse ihrer ersten Nachuntersuchung noch nicht erhalten hatte. Ihr privater Krieg gegen den Krebs war das Einzige, was im Augenblick zählte. Vielleicht ahnte er das ja sogar, denn er wirkte für seine Art ungewohnt umgänglich.
«Die Aktion Barabbas ein Fake?!»
«Genau, ein Riesen-Fake!»
«Gut, lassen wir vorläufig den Wahrheitsgehalt außer Acht und konzentrieren wir uns auf den Propagandawert und auf die Schlusspointe: Immerhin stellt Klimt uns ja seine Ermordung in Aussicht.»
«Das glauben Sie doch selbst nicht!»
«In sieben Tagen werden wir es wissen», entgegnete Kehrtmann lakonisch. «Aber um auf Ihre anfängliche Frage zurückzukommen, warum Sie eigentlich hier sind und nicht einer Ihrer historisch gebildeten Kollegen … Seinetwegen sind Sie hier.»
Er ließ die Aufnahme der Rede ein wenig zurücklaufen, bis der Sekretär im Bild erschien.
«Er ist unser Mann!»
Ein schmaler Kopf, der habichtartig aus dem dunklen Anzug ragte. Schlanke Gestalt, durchtrainiert, Langstreckenläufer, vermutete Martina. Ein sehr agiler, ein sehr selbstbewusster Mann, der älter wirkte als er war und im Unterschied zu ihrem Chef trotz seiner arroganten Ausstrahlung etwas Anziehendes hatte, was genau, das konnte sie in ihrem Kurzscan seiner Person nicht herausfinden.
«Klimt will sich umbringen lassen», fuhr Kehrtmann fort. «Gut für sein Buch, die Presse und das Boulevardfernsehen. Nur – er gibt keine Interviews vorab. Dieser Wilson schon. Er will uns ein Exklusivinterview geben. Jetzt fragen Sie mich nicht warum?! Alle anderen Blätter und Blogs sind jedenfalls außen vor. Und ich darf Ihnen versichern, diese Exklusivität hat uns keinen Cent gekostet. Die Pointe an der Sache», er setzte sein spöttischstes Grinsen auf, «hab ich Ihnen allerdings noch gar nicht verraten!»
«Die wäre?» Martina rieb sich müde die Augen.
«Er will dieses Interview nur mit Ihnen führen. Weiß der Teufel, warum.»
«Mit mir?» Sie blickte Kehrtmann ungläubig an. «Er kennt mich doch gar nicht?!»
«Fragen Sie nicht mich, fragen Sie ihn! Morgen haben Sie die Gelegenheit. Der Termin ist bereits vereinbart.»
Martina wusste, dass es sinnlos war, so zu tun, als würde sie sich über dieses Arrangement ohne ihr Zutun aufregen. Dieses Interview war ihre Mega-Chance, wieder ins Geschäft zurückzukommen, und zwar mit großem Tusch, das war beiden klar.
«Gut.» Sie nickte.
«Hier, ein Dossier über ihn, lesen Sie es sich in Ruhe durch. Allzu viel konnten wir nicht herausfinden. Er ist Vollwaise.» Für den Familienmenschen Kehrtmann schien damit über Wilson alles gesagt, was sich sagen ließ.
«Nun zu den Menschen, vor denen Sie sich hüten sollten!»
Martinas fragender Blick ließ ihn dozierend die Hände verschränken. Seine Lieblingsgeste, vermutete sie, weil er so seine manikürten Hände ins rechte Licht rücken konnte. Was für eine Welt, dachte sie unwillkürlich, in der Männer mehr Geld für Maniküre ausgaben als Frauen.
«Klimts Feinde sind auch Ihre Feinde. Denn jede publizistische Schützenhilfe, sei sie negativ oder positiv, wird unweigerlich als Waffenbrüderschaft ausgelegt werden. Also seien Sie auf der Hut. Vor allem vor den beiden!»
Kehrtmann spulte die Aufnahme zurück. Martina goss sich Wasser ein, ihr Mund war plötzlich sehr trocken und die Luft erschien ihr viel zu stickig, obwohl die meisten Kollegen inzwischen den Raum verlassen hatten.
«Hier, unser Glück will es, dass wir beide recht gut gemeinsam im Bild haben!»
Martina musterte die vorderen Reihen.
«Ist das nicht ein alter Bekannter?» Sie tippte mit ihrem Kugelschreiber auf ein Gesicht in der zweiten Reihe.
«Ludwig Müller von Hausen!»
«Ah ja, unser dünnbeiniger Bluter!» Martina rief die Daten ab. Ihr Gedächtnis funktionierte noch immer perfekt, trotz Chemo und Strahlentherapie, wie sie sich selbst widerwillig zugestand.
«Kunstmäzen und Führer der Humanistischen Liga, Anhänger Stefan Georges, Liebhaber von Knabenchören, Familienvater aus Diskretionsgründen, nicht wegzudenken vom alten Westberliner Parkett, einer der ganz großen Strippenzieher in town …»
Kehrtmann nickte anerkennend.
«Das war eine Ihrer letzten wirklich guten Reportagen. Schade, dass sie ein anderer zu Ende schreiben musste …»
Martina war sich gar nicht sicher, ob sie die Arbeit damals gern zu Ende gebracht hätte. Es ging um die Mafia-Investionen in Ostdeutschland, um die Milliardensummen, die dort sauber gewaschen worden waren, dank der Hilfe skrupelloser Juristen, die als Aufkäufer und Mittelsmänner agierten. Ludwig Müller von Hausen war einer der erfolgreichsten, mit Sicherheit der skrupelloseste. In Gestalt der «D’Annunzio-Gesellschaft», deren Vorsitzender er war, hatte er eine wunderbare Tarnorganisation, um seine italienischen Kontakte zu pflegen, die bis in höchste Regierungskreise reichten – noch dazu konnte er seine Transaktionen so sehr elegant steuerlich absetzen. Es ging das Gerücht, dass sich allerdings nie hatte erhärten lassen, dass er Mitglied der P1-Loge war, jener erzkonservativen Geheimorganisation, die Italien seit Jahrzehnten regierte und die dank der Globalisierung der Drogen- und Devisengeschäfte nun auch europaweit ihre dreckigen Geschäfte machen konnte.
«Ein aalglatter Hund, mit dem ich mich ungern noch einmal anlegen würde. Die zwei, drei Gespräche in seinem literarischen Salon waren unangenehm genug. Er droht nicht, er macht Komplimente. Das heißt, er hat es nicht nötig zu drohen.»
«So sehe ich es auch», stimmte Kehrtmann zu, «ein sehr gefährlicher Gegner für Klimt – so es denn zur Konfrontation kommt. Immerhin wissen wir, dass von Hausen Klimt seit geraumer Zeit observieren lässt, warum auch immer! Na ja, Sie werden es herausfinden! Hier, in diesem Fall wird es mit Sicherheit zur Konfrontation kommen. Erkennen Sie die Frau?»
Er tippte in geradezu freudiger Erregung auf den Bildschirm, was bei ihm selten vorkam.
Das Gesicht einer etwa fünfzigjährigen, sehr gepflegten Dame, die ihr bekannt vorkam, ohne dass sie sie im Moment verorten konnte. «Ich kenne das Gesicht …!»
«Sicher, kennen Sie diese Frau, die halbe Welt kennt sie mittlerweile, zumindest in Amerika!»
Kehrtmann schwang sich einmal im Stuhl herum und wandte dann Martina sein ein wenig hektisch geflecktes Gesicht zu. Er glaubte, an einer wirklich großen Story dran zu sein, das sah man ihm an. Einen Augenblick lang wirkte er geradezu sympathisch in seiner jugendlichen Aufgeregtheit.
«Lady Dolorosa, so ihr Spitzname in den einschlägigen Kreisen, oder auch Lady Macbeth, wie ihre politischen Gegner sie betiteln. Mit richtigem Namen: Ayn Goldhouse, Führerin der New-Virgins-Bewegung, eine wiedergeborene Ayn Rand, wie ihre Anhänger glauben, eine seltsame Mischung aus Sandra Palin und Lady Gaga, wie ich finde. Wieder andere nennen sie die Heidi Klum der Esoterik, allerdings ist sie ungleich geschäftstüchtiger. Als Hohepriesterin der ‹Neuen Unschuld› führt sie eine unüberschaubare Schar von extrem fanatischen Anhängerinnen an. Ihr Erkennungszeichen ist übrigens eine eintätowierte schwarze Rose, unauffällig, aber aussagekräftig: Schönheit bereitet Schmerzen, sie ist der Dorn im Herzen der Ungläubigen!»
«Klingt ein wenig bizarr», wandte Martina geistesabwesend ein, was Kehrtmann allerdings nicht zu bemerken schien.
«Das ist bizarr! Aber mich dürfen Sie nicht für den ganz normalen Wahnsinn dieser Welt verantwortlich machen … Hier ein kleines Dossier, in dem alles Wichtige über sie zusammengefasst ist. Die Informationslage ist ziemlich gut. Sie hasst Klimt wie die Pest, verfolgt ihn seit Jahren. Eine hochintelligente Stalkerin. Für sie verkörpert er seit seinem Gottesleugnerbuch schlichtweg alles, was sie verabscheut. Antiquierte Männlichkeit, intellektuelle Arroganz und – ein unsportliches Äußeres. In ihren Augen ist er der Antichrist – und gehört liquidiert, das sagt sie ganz offen.»
Martina hatte ihn reden lassen, obwohl sie vieles von dem, was er erzählte, schon wusste. Aber sie war fasziniert von den Augen dieser Frau, die in unverwandtem Hass Richtung Klimt starrten. Was ihr bislang allerdings noch nie aufgefallen war: Da war noch etwas anderes im Blick, etwas das sie selbst sehr gut kannte, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht hatte.
Dieser Kick Grausamkeit. Eiseskälte. Sie kannte dieses satanische Glänzen von ihren Ex-Kokser-Freunden. Eine seelische Unberührbarkeit, die viele mit Macht verwechseln, mit der Macht jener, die von sich glauben, durch die Hölle gegangen zu sein und nun auf alle Ewigkeit zu den Unberührbaren zu gehören.
«Hatte sie je mit Drogen zu tun?», fragte Martina Kehrtmann. Der nickte.
«Ein guter Riecher! Das hab ich Ihnen ja immer attestiert! Als sie sechzehn war, brach sie mit einer Gouvernante zu einer Europareise auf. In Paris büxte sie aus, es dauerte Monate, bis die Eltern sie wiederfanden, gefangen im totalen Drogendelirium. Sie kam in ein amerikanisches Sanatorium – und im Jahr darauf war sie geläutert. Sie selbst hat übrigens nie einen Hehl daraus gemacht, die Junkie-Ausreißer-Story ist Bestandteil der Legende ihrer wundersamen Erweckung …»
«Was hat sie mit Klimt vor?»
«Sie will ihn nicht sofort liquidieren, sie will ihn langsam grillen. Noch lieber als seinen Tod hätte sie es wohl, würde er der Lächerlichkeit preisgegeben. Ihre Kunst, fürchte ich, besteht darin, beides möglich zu machen!»
«Wird ein schwieriger Job mit den beiden!»
«Der Job ist gefährlich, ohne Frage!»
«Aber ich hab ja ohnehin nichts mehr zu verlieren bei meiner reduzierten Lebenserwartung, denken Sie sich wohl.»
«Unsinn! Kokettieren Sie nicht immer mit Ihrer Krankheit, das hilft Ihnen nicht weiter und überfordert nur Ihre Freunde, zu denen Sie mich im Übrigen zählen dürfen, auch wenn Ihnen das ein wenig peinlich sein mag.» Er lächelte maliziös. «Wie auch immer: Sehen Sie es positiv! Das ist die Story Ihres Lebens. So oder so!»