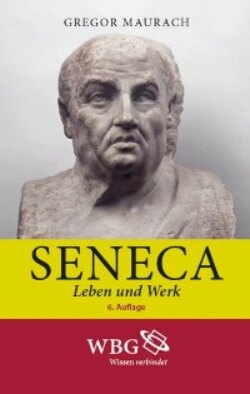Читать книгу Seneca - Gregor Maurach - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE HEIMKEHR UND DIE MACHT
Оглавление§ 37 Kaiserin Messalina hatte nach Jahren des Wütens dann doch den Bogen überspannt: im J. 48 feierte die mit dem Kaiser Verheiratete im Hause des C. Silius mit diesem eine zweite Hochzeit, eine Wahnsinnstat nach vielen anderen Wahnsinnstaten, und sie büßte diese Ungeheuerlichkeit in den lukullischen Gärten mit dem Tode. Und das war das Werk des Freigelassenen Narcissus (s. oben Anm. 7; RE 8 A, 252): ihm war es gelungen, dem Kaiser das Todesurteil abzuringen, Pallas gelang es dann, dem Kaiser Agrippina, Senecas einstige Gönnerin, als neue Gemahlin zuzuführen (RE 3,2806,28ff.). Und sie rief mit Zustimmung des Senats (Suet. Claud. 12,1) Seneca zurück. Und der Anhänger der Stoa, die ja die politische Tätigkeit gebot, akzeptierte (Grimal ANRW 1976).
Es war klar, daß man auch über die Nachfolge des eher verachteten, vielfach verhaßten Kaisers (RE 3,2836,1ff.) nachdachte: er war im J. 48 bereits 58 Jahre alt, Agrippina wollte, als Nachkomme des Augustus, mehr sein als nur eine Kaisergattin (RE 3,2807, 40ff.; Zeugnisse ihres Ehrgeizes 2809, 1ff.). Sie brachte den Kaiser dazu, ihren Sohn zu adoptieren, erinnerte mit seinem Namen „Nero Claudius Drusus Germanicus“ an ihren nach wie vor hochgeehrten Vater und ließ sich selber Augusta nennen (Tac. 12,26,1). Um nun die öffentliche Meinung über sich und ihren Sohn günstig zu stimmen, gab sie ihm nicht Freigelassene zu Lehrern oder Erziehern (der jetzige Kaiser galt als beherrscht von solchen: § 38), sondern den allgemein geachteten Ritter Seneca (Tac. 12,8,2).
Sollte er ihr „als Werkzeug dienen bei der Verschwörung, die sie zu inszenieren gedenkt“ (Grimal 64,72)? Wußte er von dem „terrible scheme in which Agrippina’s patronage involved him” (Griffin 62, zur Patronage Tac. 12,8,2)? War er also bereit, ein böses Spiel mitzuspielen? Geahnt kann er es haben, mußte er Agrippina doch kennen; aber das Spiel hat er dann doch nicht lange mitgespielt (§ 39). Einerlei – die Begnadigung kam, und Seneca war nicht nur frei, er war ein mächtiger Mann. Aber er stürzte sich jetzt nicht in den politischen Trubel, ja er beeilte sich nicht einmal, nach Hause zu kommen: das Scholion zu Juv. 5,109 berichtet, er habe, statt nach Rom aufzubrechen, nach Athen reisen wollen. Athen – die Stadt der Philosophie. Der Mann also, der seit 41 auf der Insel gehaust hatte, der in dieser Verbannung wohl nur durch die Philosophie „an seinem Schicksal wuchs und zu einer wesentlich verinnerlichten Haltung kam“ (um E. Sterns Worte zu gebrauchen, s. Anm. 48), dieser Mann wollte nun nach Athen, an den Ort, wo die Männer gelebt hatten, die noch so lange nach ihrem Tode ihn geistig erretteten. Es kam nicht dazu (Griffin 37, Anm. 5), er mußte sogleich nach Rom. Agrippina wollte auf den Prinzenerzieher nicht lange warten.
Der Prinz war 12 Jahre alt; der Unterricht in Rhetorik war für den künftigen Kaiser, wenn er den jetzigen, etwas wirren, durch klare Rede übertreffen wollte (Tac. 6,46,1; RE 3,2836,20ff.), sein wichtigstes Fach. Der kluge Mann sollte aber auch das Gemüt des Prinzen lenken (Tac. 14,55,3; Abel 671), und natürlich hoffte die ehrgeizige Prinzen-Mutter auf Unterstützung (Tac. 12,8,2). Und da lebte auch noch der Mann, der ihm zwar seinerzeit das Leben gerettet (§ 35), ihn aber auch jahrelang auf Korsika hatte schmachten lassen – der Kaiser. Es werden keine leichten Jahre gewesen sein bis zur Ermordung dieses Mannes.
§ 38 Den Kaiser ermordete dann seine eigene Frau. Er hatte Reden geführt, die sie um ihre Machtstellung bangen ließen (Tac. 12,64,2; Suet. Claud. 43f.; RE 3,1815,2ff.), da bereitete sie ihm ein Giftpilzgericht, ließ den anderen Thronaspiranten umbringen (Tac. 13,1,1) und den toten Kaiser vergotten, so daß ihr Sohn divi filius wurde (Griffin 130), und ordnete die Begräbnisfeierlichkeiten. Nero hielt dem Toten die Ehrenrede, doch als er – notgedrungen – bei dessen „Weisheit“ ankam, lachte die Zuhörerschaft laut los (Tac. 13,3,1), die Feier war zur Farce geworden. War das Senecas Absicht gewesen, als er dem Thronfolger die Rede schrieb? Kaum, denn dann hätte er den jungen Kaiser einem argen Risiko ausgesetzt (Grimal 75). Absicht aber war der Lacherfolg, den eine Satire des stilgewandten Rachedurstigen erzielte, die „Verkürbissung“50: Claudius stirbt und begibt sich zum Olymp, er ist ja nun auch Gott. Herakles empfängt ihn und verwendet sich dann im Götterrat für Claudius’ Aufnahme in den illustren Kreis. Doch der ist geteilter Ansicht, und am Ende springt Kaiser Augustus auf und hält eine flammende Vernichtungsrede, der neue Gott wird in die Unterwelt verwiesen, als Sklave des gerechten Aeacus, der aber überläßt ihn einem Freigelassenen – und so ist Claudius wieder in der Hand eines solchen (Knoche 66f.). Beißender, vernichtender Hohn auf den verhaßten Toten, gewiß; aber auch politisches Manifest: keine Macht den Freigelassenen mehr, und vor allem: zurück zu den Prinzipien des gerechten Augustus (Grimal 73,76f.; Griffin 130).
§ 39 So begannen die Jahre von Senecas Macht: mit der ›Verkürbissung‹, die nicht nur die Wiederkehr augusteischer Gerechtigkeit verhieß, sondern auch den neuen Kaiser als neuen Phoebus pries (4,1,15ff., bes. 24): felicia saecula praestabit. Die Leser (der Hof: Knoche 64, Griffin 129), die vielleicht auch von allerhand Vorzeichen gehört hatten,51 durften hoffen, zumal der junge Kaiser in seiner Antrittsrede versprach zu regieren wie Augustus (Suet. Nero 10,1). Hinfort sollten Palast- und Staatslenkung nicht mehr verquickt werden (Tac. 13,4,2), und sogleich faßte der befreit aufatmende Senat einige Beschlüsse, die der Rechtssicherheit dienen sollten (RE Suppl. 3,356,56ff.). Und dies sehr gegen den Willen der Agrippina.
Und dies ist das Stichwort: Seneca und der ihm – es klingt wie ein Wunder (Tac. 13,2,1) – befreundete andere „Minister“ Afranius Burrus hatten von jetzt an nicht nur für eine ordnungsgemäße Erledigung der Geschäfte zu sorgen, die den Palast angingen; sie hatten auch den sich steigernden Ehrgeiz der Kaiserin-Mutter einzudämmen. Bezeichnend ist die Szene, die vor einer Audienz ablief: eine Gesandtschaft aus Armenien war gekommen und wartete nun am Audienztage in einem Nebenraum auf den Beginn (Tac. 13,5,2 zum J. 54; Cass. Dio 61,3,3f.). Da erscheint Agrippina und schickt sich an, im Audienzsaal auf dem Throne Platz zu nehmen, so als sei sie an der Regierung beteiligt. Seneca und Burrus gewahrten den sich anbahnenden Skandal und bewogen Nero im letzten Moment – welcher Eindruck von römischer Regierungsmacht wäre sonst entstanden! – dazu, vom Throne aufzustehen und der Mutter entgegenzugehen, als wolle er sie begrüßen, um dann nicht mehr auf dem Throne Platz zu nehmen. „So wurde mit dem Anschein der Ehrerbietung die Verletzung der Form verhindert“, resümiert Tacitus. – Doch Seneca hatte nicht nur solchen Formverletzungen zu wehren, er hatte auch Auswüchsen entgegenzutreten, die vor Nero aufgekommen waren, z.B. der Flut von Anklagen wegen Majestätsbeleidigung (Tac. 13,10,2); und auch der junge Kaiser gab einmal seinem Widerwillen Ausdruck, Todesurteile zu unterschreiben (Sen. clem. 2,1,1ff.; Suet. Nero 10,2): er wollte ein milder Herrscher sein.
Tacitus wollte hierin den Einfluß Senecas sehen, und in der Tat verfaßte Seneca zwischen Ende 55 und Ende 56 (Grimal 83, Griffin 396) eine Schrift ›Über die Milde‹ (›De clementia‹).52 Nero wird in ihr als frei und rein von jeglichem Blutvergießen gepriesen – aber zu Anfang 55 war derjenige beseitigt worden, der allein ihm hätte den Thron streitig machen können, Britannicus (§ 38; Tac. 13,15,3ff.: Britannicus habe seine Erbitterung über die Zurücksetzung nicht immer verheimlicht). Man brachte in Rom zwar Verständnis für diesen Mord auf, der schlimme Thronstreitigkeiten hatte vermeiden helfen (RE Suppl. 3,360,37ff.), und offenbar hat Seneca ihn ebenfalls gebilligt („Einer nur soll Herrscher sein!“, Horn. Il. 2,204; Arist. Met. 12, Ende), doch es blieb ein Mord, der den Senat des jungen Herrschers nicht „rein von Blutvergießen“ (clem. 1,11,3) ließ.
§ 40 Diese Schrift legt den Kaiser auf seine bereits bewiesene Naturanlage zur Milde fest: sie will ein Spiegel dieser Anlage sein (1,1,1; 1,1,6f.). Sie sei zudem ein sicherer Schutz – ein Hinweis, der bei der Ängstlichkeit des jungen Mannes (Griffin 136,138) angebracht war. Seneca plädiert für die Abkehr von jeglicher Grausamkeit und erweist sich so, und will sich erweisen, als ein Mann, der den Herrscher gut zu lenken weiß. Die Schrift sollte auch zeigen, in wie guten Händen das Reichsregiment liege (Griffin 141ff.). Sie beruht auf dem philosophischen, nicht utilitaristischen Gedanken, daß man eine gute Tat (und Milde walten zu lassen, ist eine solche) tun müsse um der Rechtschaffenheit (der Tugend) willen. Praktische Überlegungen garantieren nichts, allein der philosophische, per definitionem an äußerlichem Vorurteil uninteressierte Grundsatz sichert die Anwendung der Milde. Und der Monarch ließ sie walten: eine Verschwörung fand kein blutiges Ende, und auch sonst erging kein Bluturteil (RE Suppl. 3,359,11ff.). Auch den Einfluß der Mutter schränkte der Herrscher ein (Tac. 13,18,2; Suet. Nero 34,1), ja, er schäumte zwar, als er von Racheplänen der Mutter hörte und von Umsturzabsichten eines ihrer Vertrauten, des Stoikers Rubellius Plautus,53 ließ sich dann aber von Seneca beruhigen (Tac. 13,20,2). Spürte Nero hier etwas von einer Opposition von Intellektuellen, so mußte Seneca spätestens jetzt Klarheit darüber gewonnen haben, „mit welcher Vorsicht sich hinfort der Präfekt (Burrus) und Seneca auf dem glatten Parkett bewegen mußten“ (Köstermann zu Tac. 13,20,1).
Wahrscheinlich war es auch der Rat Senecas und Burrus’, mit Cn. Domitius Corbulo genau den richtigen Mann an die am gefährlichsten bedrohte Reichsgrenze, nach Armenien zu entsenden (vgl. Griffin, Nero 78); zumindest berichtet Tacitus (13,6,3), die beiden „Minister“ seien nach Ansicht der Leute für die Militärpolitik dieser Jahre verantwortlich gewesen. Wenn dem so wäre, dann hätte Seneca, und mit ihm Burrus, eher auf Grenzwahrung als auf Gebietsausweitung abgezielt (Grimal 107). Man vergesse dabei nicht, daß dies auch die Politik des Tiberius gewesen war (Tac. ann. 2,26,2f.), und auch Augustus selber hatte im Testament geraten, die Grenzen zu wahren und nicht auszuweiten (Tac. 1,11,4).
§ 41 Im Palast selbst jedoch wurde die Lage Senecas mit den Jahren schwierig, die Kompromisse drückend. Die immer mehr in den Hintergrund gedrängte Kaiserin-Mutter hetzte gegen Seneca (Tac. 13,14,3), auch außerhalb des Palastes wurde Kritik laut (Tac. 14,11,3); zwar schätzte man die milden Urteile sicherlich sehr (RE Suppl. 3,372,28ff.; 373,22; 374,19ff., 29ff.), aber die wilde Aggressivität des Kaisers tobte sich in nächtlichen Schlägereien aus (Tac. 13,25,2ff.; Cass. Dio 61,8,1; Suet. Nero 26,1f.), und vielleicht sickerte auch manches von Neros Exzessen im Palast nach draußen. Daß Seneca ihm die Freigelassene Claudia Acte zuführte, und zwar so, daß er einen Verwandten dafür gewann, sich als ihren Liebhaber auszugeben, dem Kaiser aber sein Haus zu öffnen (Tac. 13,12,1; RE Suppl. 3,359,59f.), das war vielleicht noch vertretbar, obschon der Kaiser inzwischen verheiratet war,54 denn es war besser, die Begierde des Ungezügelten auf diese Weise zu „kanalisieren“ und unter Kontrolle zu behalten. Aber daß Nero den Otho in die Verbannung schickte (Plut. Galba 20; RE a. O. 367,64ff.), nur um seiner herrlich schönen Frau habhaft zu werden; daß er es zuließ, daß Hunderte von Haussklaven des Pedanius Secundus hingerichtet wurden (im J. 62), das machte böses Blut. Gewiß, es gab da ein Gesetz, das erst ganze 50 Jahre alt war, nach dem alle Haussklaven getötet werden sollten, wenn einer von ihnen den Herrn umbrächte (Köstermann zu Tac. 14,42,2), es war auch im J.57 (Tac. 13,32,1) auf die Freigelassenen ausgedehnt worden; aber diese gesetzlichen Bestimmungen angesichts des niedrigen Charakters des Secundus und der Schlüpfrigkeit der ganzen Angelegenheit (Köstermann zu Tac. 14,42,1) fast – die Freigelassenen wurden verschont – voll auszuschöpfen, das schuf erhebliche Unruhe. Ob Seneca einverstanden war, wissen wir nicht; scharf protestiert hat er offenbar nicht (Tacitus schweigt), und im Gegensatz zur Schrift ›Über die Milde‹ stand diese exorbitante Brutalität allemal.55
§ 42 Um zu einem umfassenden Eindruck von dem zu kommen, was Seneca als Berater des Kaisers tat, aber auch von dem, was er als Privatmann getan und gerade nicht getan hatte, sei zunächst geklärt, was das denn bedeutete, „Berater des Kaisers“ zu sein, und danach sei besprochen, was wir über sein Leben als Privatmann in diesen Jahren wissen.
Berater des Kaisers – als solcher hatte Seneca den Prinzeps vor öffentlichen Auftritten zu beraten und weiter überall dort, wo in politischen Dingen eine Verlautbarung des Kaisers zu erwarten war, bis hin zu den Reden, die der „Berater“ zu schreiben pflegte (Griffin 77ff.). Gewiß hatte Seneca auch bei Palastangelegenheiten mitgesprochen (Griffin 77), ebenso bei Ernennungen (s. oben § 40; Griffin 85,88ff.). Diese Rolle war die eines amicus principis, wie Seneca bei Tac. 14,54,1 selber sie bezeichnet (vgl. bes. ben. 6,32,2ff.). J. Gaudemet hat ausgeführt,56 wie vielfältig eine solche Stellung sein konnte (Dichter, Rhetoren, Ärzte, Juristen und naturgemäß Militärs hatten sie inne), und Tacitus (14,53,1ff.) läßt Seneca selber sein Amt als eine Fülle von Sorgen (curae: 54,2) beschreiben, derer er nun „müde“ geworden (fessus, ebd.). Es war dies wohl kein Amt, das sich auf bestimmte Tagesstunden begrenzen ließ; denn wenn irgend etwas an dem Bericht des Tacitus (14,2) über jenes Gelage wahr ist, während dessen die Mutter sich dem Sohne anbot und Seneca statt ihrer Acte ins Gefecht schickte, dann zeigt der Bericht etwas von der Allgegenwart des amicus.
§ 43 Wenn man aber fragt, was Seneca denn als Politiker und Regent getan habe, dann wird man zwar vermuten dürfen, daß er oft mit Afranius Burrus sich beraten, daß er auch ihm manchen Rat gegeben und manche Stunde gewidmet habe, aber man muß zugeben, daß über diese Seite der Tätigkeit Senecas nichts bekannt ist: „Kein Historiker erwähnt irgendeine Gelegenheit, bei welcher Seneca im Senate während Neros Regierungszeit anwesend gewesen wäre“ (Griffin 74). Seneca hat (vgl. oben § 2,35) stets Erwähnungen seiner aufreibenden Tätigkeit gemieden, wenigstens spricht er in den uns erhaltenen Werken so wenig von sich selber, daß man meinen könnte, er habe so gut wie ganz seinen Studien gelebt – eine bemerkenswerte Zurückhaltung. Und noch eines sei mit aller Deutlichkeit gesagt: wenn wir über sein Leben als Senatspolitiker und als Privatmann nichts wissen, dann bedeutet dies auch, daß darüber nichts bekannt war. Kein Historiker erwähnt irgend etwas dergleichen. Und das weist nicht allein auf seine persönliche Zurückhaltung (s. § 2 Ende), was das „Image“ und seine Pflege betrifft, es weist auch darauf, daß Seneca – sehr im Gegensatz zu einem Menschen wie Ofonius Tigellinus, seinem Nachfolger als Kaiserberater (z.B. Tac. 15,37; Griffin, Nero 100f.) – bescheiden auftrat, sich keinerlei auffällige Protzereien, Laster und Verbrechen zuschulden kommen ließ. Sagen wir es rundheraus: nicht nur, was er getan, muß gefragt werden, sondern auch, was er nicht getan. Denn auch dieses Schweigen der Quellen, die doch sonst so sensationslüstern sind, ist beredt.
50 Der Titel nur bei Cass. Dio 60 (61), 35,3; vgl. U. Knoche, Die römische Satire 41982, 62ff. Das Abfassungsdatum: Nov./Dez. 54 (Griffin 129, Anm. 3). Zur politischen Komponente jetzt K. Bringmann ANRW 32,2; 897ff.; H. Horskotte, Die polit. Zielsetzung von Senecas Apocolocyntosis, Athenaeum 63, 1985, 337ff.; auch O. Schönberger, Die Apocolocyntosis des L. Annaeus Seneca, in: Jahresber. für das Schuljahr 1987/8 des Wirsberg-Gym. Würzburg, 2 Teile (neuer Text und Komm.); D. Flach, Hypomnem. 39, 1973, 164ff. zu den Versprechungen bei Neros Regierungsantritt, die in der Apokolokyntosis anklingen bzw. gestützt werden.
51 Grimal 80 unten muß selbst zugeben, daß seine geistvollen Vermutungen zu Neros Sonnen-Ideologie eben nur dies sind, Vermutungen: da Nero bei seiner Geburt zu Antium von einem Sonnenstrahl berührt worden sei (Suet. Nero 6,1), sprach man von einer „Vermählung mit der Sonne“ nach ägyptischer Weise, und darum preise Seneca den jungen Kaiser in Ap. 4,l,15ff. als neuen Phoebus. Bringmann (Anm. 50) 897 Mi. und Griffin 132 sprechen demgegenüber von traditionellem Lobpreis.
52 Grimal 83f. meinte, das erste Buch stelle die Rede dar, die Nero vor dem Senate gehalten habe anläßlich der feierlichen Gelübde zum Jahresbeginn, denn an den Kalenden des J. 55 legten die Konsuln Nero und L. Antistius Eid und Gelübde ab (zum Eid und Gelübde Liv. 21,63,5ff.; Ov. fast. 1,75ff., s. auch RE Suppl. 14,969,8ff.). Gesichert ist Grimals Einfall nicht, obschon nicht unwahrscheinlich (Griffin 135, Anm. 3).
53 Rubellius Plautus galt als stoisch interessiert, Tac. 14,57,3. Syme, Tacitus 555 äußerte die Ansicht, Nero habe hier zum ersten Male den Widerstand seitens der stoischen Philosophie in Rom gespürt.
54 Er hatte 53 Octavia, die Stieftochter Agrippinas, geheiratet (E. Hohl, RE Suppl. 3,351,36; 354,31ff.). Zu ihrem Tode s. Anm. 58, § 53 Ende und RE 3,2897,42ff.
55 Scharf protestierte im J. 59 z.B. Thrasea Paetus gegen eine Heuchelei des Senates (Tac. 14,12,1; Griffin 102). Zu einer festlichen Gelegenheit, die Seneca und Burrus gemeinsam guthießen, erschien er zum Ärger des Kaisers im bloßen „Gehanzug“ (Tac. 16,21,1). Fairerweise muß man zugeben, daß ein Protest solcher Art im Falle Senecas einer Demission gleichgekommen wäre; muß aber auch einräumen, daß er noch im Zeitraum von 62/64 (dem Abfassungsdatum der ›Naturales quaestiones‹: Abel, Bauformen, 166) einen Vers Neros lobend zitierte (n.q. 1,5,6, bes. 6,4,2). Die einzige Form des Protestes scheinen seine Rückzugsersuchen gewesen zu sein, und die waren mutig genug, denn sie bedeuteten über kurz oder lang den Todesbefehl.
56 Romanitas – Christianitas. Festschrift Straub 1982, 52ff. Vgl. Griffin 67ff. zur Rolle des amicus principis.