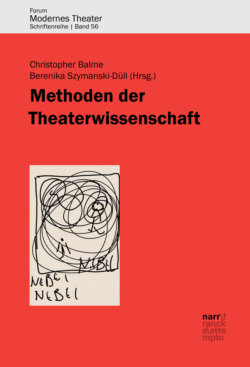Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 46
3. Affekt versus Emotion
ОглавлениеDie affektive Dimension von Aufführungen zu beleuchten, bedeutet nicht, das emotionale Erleben einzelner Zuschauer*innen zu rekonstruieren oder überhaupt individuelle Gefühle zu beschreiben. Die hier vorgeschlagene Perspektive geht vielmehr von einer Unterscheidung zwischen Affekt und Emotion aus.1 Affektivität ist demnach das dynamische Geschehen, das verschiedene Akteure auf vielfältige Weise miteinander in Beziehung setzt. Affekte finden also eher zwischen Akteuren statt als in ihnen (wobei unter Akteuren immer auch nicht-menschliche Handlungsträger oder Adressaten von Handlungen verstanden werden können). Gerade durch diesen relationalen Charakter sind Affekte von Emotionen als individuellen psychischen Zuständen zu unterscheiden. Anders als eine Emotion, ein Gefühl oder eine Stimmung ist der Affekt eine weitgehend unbestimmte Größe. Affekte bemessen sich zunächst in ihrer Intensität, sind hingegen noch nicht in ihrer Gerichtetheit, Wertung oder Artikulation bestimmbar – bevor sie in kulturell bzw. diskursiv etablierte Bahnen gelenkt und auf spezifische Weise ausagiert werden können. So entziehen sie sich oft auch einer präziseren sprachlichen Bezeichnung. Dagegen sind Emotionen soweit kulturell codiert, dass sie sprachlich repräsentiert werden können. Emotionen rekurrieren auf Affekte, um diese mit einem kulturell geprägten Repertoire von Artikulationsformen in Beziehung zu setzen. Insofern sind Emotionen nicht auf physiologische Empfindungen reduzierbar, sondern führen Empfindungen mit komplexen Konzepten zusammen, die diese Empfindungen artikulieren und dabei auch beeinflussen und kanalisieren. In diesen Konzepten manifestieren sich kulturell verankerte Klassifikationen, Interpretationen und Wissensbestände.2
Die besonderen Möglichkeiten einer affektorientierten Aufführungsanalyse werden deutlich, wenn man davon ausgeht, dass Affekte kein individuelles, inneres Geschehen sind, sondern sich in externen Relationen und Konstellationen manifestieren. Tatsächlich nutzen Regisseur*innen etwa die proxemische Dimension der Aufführung, d.h. die variable Positionierung der Akteure im Raum, um affektive Verhältnisse zwischen Figuren zu verdeutlichen (Nähe und Distanz, Anziehung und Abstoßung beispielsweise). Auch räumlich-visuelle und/oder klangliche Atmosphären sind ein wichtiges Mittel, um vielfach diffuse, unklare und uneindeutige affektive Dynamiken darzustellen. Anstatt zu psychologisieren oder über Gefühlszustände zu spekulieren, sollte die Aufführungsanalyse deshalb ihre Chancen nutzen, die in einer genauen Beschreibung von Situationen und Handlungsformen liegen: Wie bzw. in welchem Modus wird eine bestimmte Handlung, etwa ein einfacher Gang über die Bühne, ausgeführt? Welche Situation findet ein Akteur vor, wenn er die Bühne betritt? Wie adressieren die Akteure von der Bühne aus das Publikum? Kann in der Hinwendung zum Publikum ein affektiver Gestus beschrieben werden? Der Begriff des Gestus kann eine Orientierung für affektorientierte Analysen dieser Art geben. Er bezeichnet Haltungen von Akteuren, die sich sowohl kommunikativ als auch körperlich zeigen. Eine an Brecht orientierte Theatertheorie geht davon aus, dass solche Haltungen nie nur von einzelnen Akteuren eingenommen werden, sondern sich zwischen Akteuren entfalten und von sozialen Kontexten abhängen. Aussagen zum Gestus können insofern bei einzelnen Akteuren ansetzen, müssen sich von dort aus aber auf komplexe Situationen und soziale Verhältnisse erstrecken.3 Am Ende solcher Analysen, die – wie jede Aufführungsanalyse – immer weiter verfeinert werden können, steht kein Katalog von Emotionen, die einzelnen Akteuren zugeschrieben werden könnten, sondern die differenzierte Beschreibung einer situativen Konstellation, die den*die Analysierende*n stets mit einschließt.
Eine Aufführungsanalyse, die sich auf die affektive Dimension fokussiert, muss also materielle Relationen des Geschehens im Theaterraum herausarbeiten. Die Affekte sind aus dieser Perspektive die beschriebenen Relationen, es sind hingegen keine subjektiven Gefühle, die man individuellen Akteuren zurechnen könnte. Das soll zum Schluss exemplarisch an der Inszenierung Die Hamletmaschine vom Exil Ensemble4 des Berliner Gorki Theaters verdeutlicht werden (Regie: Sebastian Nübling, Premiere am 24.2.2018).