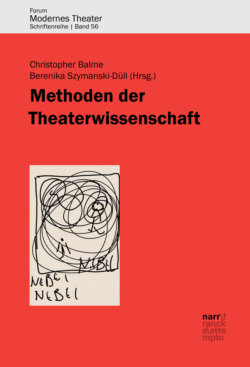Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 50
Definition der Aufführung als Dispositiv
ОглавлениеEine offensichtlich zunächst nur heuristisch zu verstehende Analogie zwischen Foucaults Dispositivbegriff und der Aufführung liegt in der dis-positio von heterogenen Elementen. Theater ist immer eine raum-zeitliche Anordnung von materiellen – Körpern, Stimmen, Objekten, Apparaturen, – und immateriellen Elementen und Verfahren, von Techniken wie Schauspiel-, Gesangs-, und Tanztechniken oder Arbeitsweisen, von immateriellen Diskursen und Medien, und institutionellen und organisatorischen Verfasstheiten, die das ins Spiel bringen, was sich zeigt und gleichzeitig nicht zeigen kann. Welche Konzeption oder Vorstellung von Theater materialisiert sich also in welchen Anordnungen? Diese Frage verweist darauf, dass der Aufführung eine gewisse Kontingenz innewohnt, die Überschreitung mithin als Maßgabe des Theaters figuriert, durch welche sich die Aufführung auf andere Medien hin öffnet, die nunmehr weitere Materialisationen von Theater sind.
Die Aufführung ist mithin weder primär ein Text, eine Situation oder eine Erfahrung. Die Aufführung ist die Materialisation eines Dispositivs: des Dispositivs Theater oder gar des Dispositivs der darstellenden Kunst im weiteren Sinn. Nicht jedes theatrale Dispositiv kann sich zu jeder Zeit materialisieren. Denken Sie an das Theater Kleists, Craigs, Appias, Artauds, deren Vorstellungen von Theater derart kontingent sind, das sie ihre eigene Überschreitung in sich tragen und die Materialisation in den zeitgenössisch bekannten, institutionalisierten und tradierten Formen desavouierten. Und dennoch materialisiert sich auch die Kunst genannter Autoren – in anderen Formen, Formaten, Medien, mitunter zu anderen Zeiten. Derartige Werke und Ideen sprengen den tradierten Aufführungsbegriff und machen auf Sollbruchstellen aufmerksam.
Das fachwissenschaftliche Novum, Theater unter epistemologischen Prämissen als Anordnung, als Dispositiv zu denken, besteht folglich darin, die Materialisation in einer Aufführung und die Herausbildung weiterer spezifischer Formate (wie beispielsweise bürgerliches Illusionstheater, Regietheater, Lecture Performance, Work-in-Progress, Artistic Research-Formate) weit differenzierter als bislang im Wechselspiel historischer, gesellschaftlicher, institutioneller und ästhetischer Bedingungen beschreiben zu können. Damit soll indes keiner Verallgemeinerung Vorschub geleistet werden. Wenn Ulrike Haß schreibt, „Theater ist per se ein summarischer, abstrakter Begriff, oder anders gesagt, ein Suchbegriff“,1 und damit die generelle Defintion von „Theater als Dispositiv“ ablehnt, ist dies durchaus anzuerkennen. Sofern wir aber von einer je spezifischen und materialen Ausprägung sprechen, ohne die dieses epistemologische Modell nicht zu konzipieren ist, wie beispielsweise dem Dispositiv Regietheater, wird ein derartiges Verständnis von Theater konstruktiv und erkenntnisbringend. Das Dispositiv Regietheater wäre demnach eine institutionelle Anordnung, also primär ein bestimmtes ästhetisches und sozio-ökonomisches Dispositiv, in welchem sich die Ordnung der darstellenden Kunst auf eine bestimmte Art und Weise materialisieren kann.
Zu fragen ist im Rahmen dieser Methode einerseits nach der Art und Weise der Anordnung, welche die darstellende Kunst vornimmt, also nach ihrem Wissen und dessen Prinzipien (auktorialen Strategien und intrinsischen Kalkülen), und andererseits nach der Wahrnehmung, der Erfahrung und dem Wissen, welche(s) daraus ergeht. Darüber hinaus stellt sich vor allem die Frage, inwiefern diese Strategien und Kalküle mit den Strategien und Kalkülen anderer (gesellschaftlicher) Dispositive koalieren oder konfligieren. Theater als Dispositiv zu betrachten, bedeutet, es in all seinen Dimensionen der institutionellen Verankerung und Arbeitsweisen, der Produktions- wie der Rezeptionsverhältnisse, der gesellschaftlichen Diskurse und ihrer materiell-technischen Praktiken zu beschreiben, und jene Momente der Dysfunktion oder Fiktion, die im Rahmen der Materialisation evident werden, als jene raren Momente zu verstehen, an welchen ein Dispositiv sinnlich erfahrbar wird. Denn diese sinnliche Erfahrbarkeit von Dysfunktionen macht den wesentlichen Unterschied der Dispositive darstellender Kunst gegenüber anderen Dispositiven aus – sie ist vielleicht sogar ihr zentrales Kalkül.
Es heißt vor allem auch, das Theater in strategischer Beziehung zu einem künstlerischen und (oder) gesellschaftlichen Problem zu begreifen, und zu überlegen, wie sich die je spezifische Materialisation der theatralen Ordnung dazu verhält. Methodisch lässt sich auf dieser Grundlage die Forderung ableiten, bei einer analytischen Auseinandersetzung mit dem theatralen Dispositiv, im Konkreten, der Aufführung, der Partitur, der Installation oder anderem, an den Sollbruchstellen anzusetzen – den dysfunktionalen oder fiktiven Elementen –, in denen die bestehende Ordnung und die regulierende Vernetzung von Aktanten nicht mehr reibungslos funktioniert. Derartige Brüche, die als Skandal, als Fehler oder gar als Nicht-Aufführung evident werden können, machen den strategischen Einsatz eines Dispositivs gerade dort einsehbar, wo sein Funktionieren andernfalls aufgrund von Konvention und Habitualisierung verborgen bleibt. Theater ist der paradigmatische Verhandlungsort von Dispositiven, gerade weil Theater nur als Dispositiv, als Konstellation von mannigfaltigen und heterogenen Elementen zu fassen ist.
Die vorgeschlagene Methodik erweitert das Repertoire der Theaterwissenschaft als auch die bisherigen Ansätze, dieses epistemologische Modell in das Fach einzubringen, in zwei zentralen Punkten: 1.) Theater ist kein geschlossenes System. Als Dispositiv konstituiert es sich auch zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt unter maßgeblichem Einbezug anderer Dispositive – dem Dispositiv bestimmter Körperpraktiken, dem Dispositiv der Medien, dem Dispositiv der Probenarbeit und der Ausbildung. Das Dispositiv als Ordnung der darstellenden Kunst ist folglich nicht totalisierbar. 2.) Die Elemente, die das Dispositiv ins Spiel und damit als solche hervorbringt, gehen nicht auf in ihrer Hervorbringung. Die hervorgebrachten Körper sind immer zu viel oder zu wenig und vermögen so Anomalien zu erzeugen, die das Dispositiv untergraben – die es lebendig halten. Dadurch bringen die in das Spiel involvierten Körper immer wieder neue Kontingenzen mit sich, sodass die Aufführung nie nur ein intendiertes (ideologisches) Ergebnis (gemäß einer Strategie, eines Kalküls) zeitigt. Das Dispositiv lässt sich folglich nur als Praxis des Spiels verstehen, das sich z. T. auch gegenüber den angewandten Strategien versperrt. Damit unterscheidet sich dieser Ansatz auch von bisherigen Ansätzen, die mit dem Dispositivbegriff in Bezug auf das Theater bereits arbeiten.2 Diese gehen stets vom Theater als einem geschlossenen Dispositiv aus, das ideologischen Charakter erhält, weil es die Art und Weise, wie es Hören und Sehen im Bühnenraum aufeinander bezieht, verdecken muss, um wirksam zu sein.3 Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass vorschnelle Ideologisierungen von bestimmten (historischen) Theatertypen verhindert werden. Seine Komplexität erlaubt es weiterhin, vermeintlich emanzipatorische zeitgenössische Theaterformen auf ihre machtkonformen Grundierungen hin zu untersuchen.