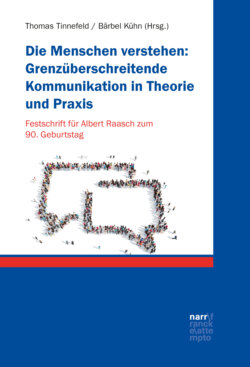Читать книгу Die Menschen verstehen: Grenzüberschreitende Kommunikation in Theorie und Praxis - Группа авторов - Страница 11
3 Fachdidaktische Vertiefung in der „Arbeitsgruppe für Angewandte Linguistik-Kiel“ (AALF-Kiel)
ОглавлениеDas Referat im Seminar über den Inhalt des Interviews mit Professor Martinet führte nicht nur zu einem Proseminarschein, sondern die Transkription des Gesprächs wurde als Beitrag angenommen und erschien in der ersten Publikation der von Albert Raasch 1969 ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe für Angewandte Linguistik Französisch-Kiel.
Diese Kieler Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Raasch setzte sich zusammen aus Studierenden der Romanistik, vornehmlich fortgeschrittener Semester, aus Referendarinnen und Referendaren sowie aus interessierten Lehrerinnen und Lehrern im Schuldienst.1 Das gemeinsame Interesse galt der Frage, wie das Lehren und Lernen von Fremdsprachen – insbesondere des Französischen – wirksamer, vor allem unter Einbezug der Arbeiten der Angewandten Linguistik, erfolgen kann.
Die Lehrveranstaltungen von Professor Raasch im Wintersemester 1969 / 1970 mit einem Seminar Einführung in die Angewandte Linguistik sowie Angewandte Linguistik und Französischunterricht an Gymnasien und Realschulen führten durch Inhalte wie:
Analyse der gängigen Lehrwerke in den Bereichen Wortschatz, Phonetik und Grammatik
Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung von adäquaten Übungssequenzen für den Sprachunterricht
Analyse audio-visueller Sprachlernmethoden aus landeskundlicher (heute würde man sagen interkultureller) als auch linguistischer Perspektive sowie
Gestaltung und Einsatz von Tests als möglicher Form der Lernstandsdiagnose
zu einer Profilierung fachdidaktischer Anliegen.
Auch auf den wöchentlichen Zusammenkünften der AALF-Kiel wurden diese Forschungsanliegen intensiv diskutiert. Wochenendseminare und ein Arbeits- und Forschungsaufenthalt der Gruppe am CAVILAM (Centre Audiovisuel de Langues Modernes in Vichy; https://www.cavilam.com) erweiterten das Themenspektrum vor allem im Hinblick auf einen Sprachunterricht mit spezifischen Voraussetzungen.
Die konkrete Umsetzung theoretischer Überlegungen in ein Unterrichtsmaterial, das sowohl dem Stand der Fachdidaktik als auch Erkenntnissen der Angewandten Linguistik Rechnung trug, wurde durch folgenden Umstand eingeleitet. Professor Raasch hatte einen Kontakt zu dem Leiter des Sprachenreferats des Deutsch-Französischen Jugendwerks, Dr. Fritz Kerndter. Diese Institution förderte nicht nur deutsch-französische Aktionen auf regionaler Ebene – so zwischen Schleswig-Holstein und Poitou-Charentes (1975/1976) –, sondern sie subventionierte auch deutsch-französische Jugendbegegnungen. Das besondere Interesse lag dabei auf der Sprachförderung während des Aufenthaltes.
Da es weder eine adäquate pädagogische Methode der Sprachvermittlung gab noch Unterrichtsmaterial, das in seinem Inhalt auf das Alter der Jugendlichen und den zweisprachigen Kontext zugeschnitten war, stellten sich die Mitglieder der AALF-Kiel unter der Leitung von Professor Raasch dieser Herausforderung. Das Ergebnis war die spezifisch für diesen Kontext konzipierte Tandem-Methode. Sie zielte darauf ab, dass sich deutsche und französische Teilnehmer im Sprachunterricht nebeneinandersetzen und sich gegenseitig beim Erlernen der Sprache des Nachbarn helfen. Damit wurde in Kiel ein Methodenansatz kreiert, der später auch in andere institutionelle Kontexte im Zusammenhang mit dem Sprachlehr- und -lernprozess aufgenommen wurde.
Und es wurde Sprachmaterial in deutscher und französischer Sprache erarbeitet, das jeweils zehn Lerneinheiten mit Übungen und Wortschatzliste sowie Hör- und Bildmaterial umfasste und das 1978 jeweils in deutscher und französischer Fassung unter den Titeln Kommen Sie mit nach Deutschland? und La France, on y va! veröffentlicht wurde.2
Diese Methode und das Material wurden 1970 auf einer deutsch-französischen Begegnung mit zwei Schulklassen erprobt, bevor sie dann in den Folgejahren in deutsch-französischen Jugendbegegnungen, die vom Bureau International de Liaison et Documentation (B.I.L.D.) mit Unterstützung des DFJW durchgeführt wurden, zum Einsatz kamen.3
An der Ausbildung der animateurs-interprêtes, die für die Spracharbeit während der Begegnungsaufenthalte verantwortlich waren, wurden immer auch Mitglieder der AALF-Kiel beteiligt, die die sprachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Prinzipien der Methode den künftigen Animateuren erklären und die auf diese Weise erste pädagogische Lehrerfahrungen sammeln konnten.
In den Ausführungen zu den Grundlagen der Methode, die sich an Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren ohne Vorkenntnisse richtet, erfolgt eine konkrete Zielbeschreibung der Methode mit der Nennung folgender Grobziele:
„Die Teilnehmer sollen in der Lage sein,
mündliche Äußerungen in der Fremdsprache zu verstehen,
Grundbedürfnisse (Fragen, Bitten etc.) in der Fremdsprache zu artikulieren,
über den Weg des Abbaus von Sprachhemmungen die Befangenheit gegenüber dem fremdsprachlichen Partner überwinden,
eventuelle vorhandene Vorurteile gegenüber dem Partner und dem Land abzubauen,
Partnerschaftliches Verhalten beim Lösen von Sprachschwierigkeiten zu zeigen,
Hilfsmittel wie Wörterbücher etc. zur Überwindung von Sprachschwierigkeiten zu benutzen.“4
In den Ausführungen zu den Funktionen der einzelnen Teile der Sprachmethode wird im Hinblick auf die Bedeutung der zu den Dialogtexten visuellen Darstellungen auf Klarsichtfolie ausgeführt, dass die visuelle Komponente unentbehrlich sei, „weil sprachliches Handeln immer an Faktoren wie Ort und Zeit der Handlung, Rolle des Partners etc. gebunden ist.“ (Ebd., 9)
Schon diese Liste der Grobziele zeigt, in welchem Maße in den 1970er Jahren Forschungserkenntnisse der linguistischen Pragmatik in die spezifisch fachdidaktische Arbeit der AALF-Kiel zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts eingeflossen sind.
Die durch Albert Raasch initiierte Zusammenarbeit mit dem DFJW wurde komplementiert durch seine Arbeit für den Deutschen Volkshochschulverband. Das Wissen der Studierenden um die wegweisende Erarbeitung des VHS-Zertifikats für Französisch (1969) öffnete eine weitere Tür für Überlegungen zur Lernzielbestimmung im Fremdsprachenunterricht, die – konsequenterweise – auch in klar beschriebenen Abschlüssen mit dem entsprechenden Material mündeten.
Die Einladung von Albert Raasch an Studierende zur beobachtenden oder aktiven Teilnahme an von ihm geleiteten Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte der Schulen oder Unterrichtenden an Volkshochschulen vermittelten den Studierenden oft einen nachhaltigen Eindruck davon, wie stark die Kluft zwischen dem unterrichtlichen Handeln in einem traditionellen Unterricht und einem Fremdsprachenvermittlungsprozess war, dessen fachdidaktische Orientierung nach Albert Raasch „in der Ermöglichung optimalen Lernens unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen einer Lehr- / Lerngruppe im Hinblick auf eine reflektierte Lernzielsetzung (lag).“ (Raasch 1981: 46)