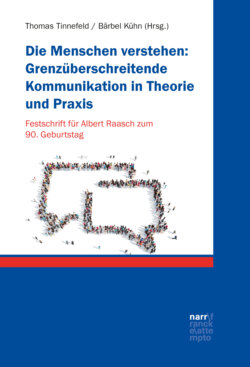Читать книгу Die Menschen verstehen: Grenzüberschreitende Kommunikation in Theorie und Praxis - Группа авторов - Страница 19
Оглавление2 Das Fundament von Albert Raasch als Gründer: über zwei Jahrtausende
Man kann nicht umhin, für eine (vielleicht die) Antwort hierauf auf die oben zitierte Aussage von Albert Raasch vom GAL-Kongressbericht 1970 zu rekurrieren: Rückstand aufholen! Diese seine Diagnose der Zeit um 1970 war in zweifacher Weise berechtigt.
2.1 GAL – AILA
Albert Raasch ging es wohl um die Angewandte Linguistik. Gerade auch er wusste qua seines Lebenslaufs jedoch, dass Anwendung ohne Theorie ein Salto Mortale sein würde. So empfanden dies – vor Deutschland – zu Beginn der 1960er Jahre bereits andere Europäer. Ergo: Im Jahre 1964 wurde in Nancy (Frankreich) eine Organisation namens Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA) gegründet. Weltumfassend wollte sie sein und ist es ja denn auch geradezu exorbitant schnell geworden. Vorbereitet worden war sie von Antoine Culioli und Guy Capelle, also von romanistischen Kollegen unseres Jubilars. Ziel dieser Weltorganisation war und ist es, die wissenschaftliche Öffentlichkeit für die Angewandte Linguistik zu sensibilisieren und diese zu fördern. Dies geschah mit großartigem Erfolg: Bereits 1969 – mithin erst wenige Monate nach der Gründung der GAL – umfasste diese internationale Dachorganisation AILA bereits 28 Mitglieder, d.h. nationale Tochterorganisationen (sogenannte national affiliates) als jeweilige Repräsentantinnen ihres jeweiligen Landes / Staates.
Nun, wie oben qua Albert Raasch angedeutet: Fraglos hatte Deutschland einen Nachholbedarf in Angewandter Linguistik. Diesen aber weitgehend eben nur wegen eines gleichermaßen dringlichen Desiderates in dem Feld, das man um 1968 Moderne Linguistik nannte, d.h. Theoretische Linguistik (Kap. 2.2.1).
Ein bloß ein Jahrhundert zurückreichender Blick beantwortet die oben gestellte Frage „Ist die Theoretische Linguistik ein Teil der Angewandten Linguistik? somit wohl mit einem Nein. Ein über zwei Jahrtausende zurückreichender Blick hingegen beantwortetet sie – wenngleich nicht uneingeschränkt – mit einem Ja, so doch zumindest begründet mit einem Jein bzw. doch mit einem eher überwiegenden Ja (Kap. 2.2.2).
2.2 Theorie contra (?) Anwendung
2.2.1 Strukturalismus und Generativismus als Nachholbedarf
Die Komparativisten, die (Post-)Humboldtianer (bis zur Weltanschauungstheorie von Sprache) sowie die Zweige der sogenannten Psychologie der Sprache (vs. spätere Psycholinguistik) bis zur (strittigen) sogenannten Völkerpsychologie reichend, die positivistischen Junggrammatiker (Neogrammarians) waren als Erbe des späten 18. und vor allem des 19. Jahrhunderts zur Kenntnis genommen worden und dominierten die Philologien. Indes: Was sollte man mit den gesammelten Daten dieser Bemühungen anfangen, wie sollte man sie interpretieren? Dafür versuchten linguistische Schulen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – also in etwa bis zur Gründung der GAL – Antworten zu geben. Ohne die jüngere Geschichte der Linguistik zu rekapitulieren, hier nachfolgend nur sogennante ‚Schulen‘, bzw. deren Schwerpunkte, die sich 1968ff. die Angewandte Linguistik – im Rahmen damals angenommener Möglichkeiten – zunutze zu machen vermochte. Da waren, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen:
Der heute üblicherweise als Vater – aus unserer Sicht eher als Großvater – des Strukturalismus bezeichnete Ferdinand de Saussure (1857-1913) mit seiner Genfer Schule sowie in Paris mit der parole, mithin auch gesprochener / geschriebener Sprache versus der langue und ihrer jeweiligen Struktur, innerhalb derer jedes einzelne Element eines Systems seinen Stellenwert (valeur) erst bestimmen kann – sei es z.B. ein Laut im phonetischen System, sei es ein Lexem im semantischen System einer Sprache –, zudem mit Sprache als organisiertem System mit sozialer Funktion und mit auf Oppositionen beruhenden sprachlichen Systemen. Dabei ist das Erbe von Beaudouin de Courtenay (1945-1929) und dessen früher Kazaner Schule spürbar.
Die Prager Schule um und nach Roman Jakobson (später Harvard / USA), N. Trubetzkoy, V. Mathesius u.a. mit ihrer Betonung sprachenspezifischer Phonologie und dann auch der Morphonologie, der Sprache als Kommunikationsinstrument.
Die Kopenhagener Schule der Glossematik von, um und nach Viggo Broendal und Louis Hjelmslev, in der Logik und Grammatik verbunden wurden, die aber sprachübergreifend auf die allgemeine Semiotizität von Zeichen ausgriff.
Da waren auch und nicht zuletzt die diversen Ausdifferenzierungen US-amerikanischer Richtungen des Strukturalismus, so die YALE-Schule um Leonard Bloomfield, in deren Rahmen auf der Basis des Behaviorismus analytische Deskriptionsinstrumentarien für Sprachstruktur geschaffen wurden – allerdings um den Preis der semantischen Dimension. Der Nachdruck lag hier indes auf Deskription statt Präskription.
Dagegen aber auch die von Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf begründete anthropologische Richtung, die über den innersprachlich analysierbaren Distributionalismus auf die Dimension der Wahrnehmung ausgriff: Sprache bedinge das Denken und dieses die Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Sodann die Generative Transformationsgrammatik mit ihrem Begründer Noam Chomsky. Erwachsen aus der YALE-Tradition von Zellig Sabbettai Harris griff er jedoch bereits in seinen Syntactic Structures (1957) über Sprache als ergon, also eines Strukturwesens, beschreibbar im hier und jetzt, hinaus und orientierte sich hin zu Sprache als energeia, mithin auf das Werden grammatischer Strukturen bezüglich deren logischer Organisation – unterstützt von Chomskys Herkunftsdisziplin, der Mathematik.
Da war – in späteren Übersichten oft vergessen – auch die Britische Schule des Kontextualismus von und nach John Rupert Firth. Begründet auf der weltweit vergleichenden Anthropologie / Ethnologie (als Vertreter z.B. Malinowski (1986) oder Mead) wurde bereits erkannt, wie Sprachäußerungen vom verbalen, weiter physischen und noch weiter vom kulturellen Kontext abhängig sein mögen. Im Ergebnis stellte M.A.K. Halliday Sapir und Whorf auf den Kopf qua seiner Soziosemiotik, gemäß derer die sozial bedingte Wahrnehmung der Wirklichkeit das Denken und dieses erst dessen sprachlichen Ausdruck bestimme.
Fazit bis hier: Das oben zitierte Nachholen und Weiterentwickeln dieser theoretisch-linguistischen Ansätze ist unbestreitbar gelungen. Gilt dies indes auch für deren Anwendung(en)?
Man muss konzedieren: Für Anwendung – in welchen der eingangs für die GAL-Gründung genannten Fachbereiche bzw. Sektionen auch immer – waren die o.a. bahnbrechenden Errungenschaften keineswegs konstitutiver Impuls, noch waren sie Forschungsziele.
Dennoch zeitigten sie bei Anwendern, die sich wohlmeinend und oft mühsam mit den strukturalistischen, und also neuen Modellen vertraut gemacht hatten, bedingte Erfolge.
Diese zeigten sich etwa:
in dem auf die Wandtafel projizierten oder an diese geschriebenen Viereck des Vokaldiagramms für den Fremdsprachenunterricht für 12-jährige Lerner oder
im generativ-transformationellen Stammbaum für den Wechsel eines Aktiv- in einen Passivsatz beim Lernziel für 13-jährige Lerner.
Dies alles war wohl fortschrittlich und gut gemeint gewesen, aber aus heutiger angewandter Sicht gilt wohl eher: Die Theoretische Linguistik gehört in die Küche des Kochs, nicht aber auf den Teller des Kellners!
Der Ansatz Theorie contra Anwendung war also wohl kein wirklicher Fortschritt.
Dessen war sich sehr früh unser Jubilar bewusst – in Jahrtausende währender Tradition!
2.2.2 2000 und mehr Jahre Anwendung
Setzen wir nun die kurze Periode von der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Mitte des 20. Jahrhunderts (wie oben in 2.2.1.) in ihren sprachwissenschaftshistorischen Rahmen, dann fällt auf, dass die Schulen dieses Zeitabschnitts sich sprachbezüglich um Erkenntnis um der Erkenntnis selbst willen bemüht hatten. M.a.W. war der Forschungsgegenstand ‚Sprache‘ identisch mit dem Forschungsziel ‚Sprache‘, genauer also mit dessen Methoden zu seiner Analyse und Beschreibung. Dies geschah im Gegensatz zu langwährender Tradition. Für diese war Anwendung durchaus oft extralinguistisch konstitutiv, sowie häufig auch finalisierend. So – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – etwa:
Sehr früh die Indische grammatische Schule von Panini (ca. 4. Jh. v.Chr.) und dessen Nachfolger: Sprache als System wurde erfasst mit Erkenntnissen, die (mor)phonologisch erst das 19. Jahrhundert wiederentdeckte. Dies indes mit dem konstitutiven Forschungsziel, die Gesetzmäßigkeiten der alten Vedatexte des Sanskrit festzuhalten – ein religiös bedingtes Forschungsziel also.
Im antiken Griechenland fragte man sich, ob die Welt chaos oder cosmos sei. Ein Schlüssel zur Antwort sei Sprache gewesen, ist Sprache ja doch Teil der Wirklichkeit. Was mithin für Sprache als pars pro toto gelten mag, konnte auf die gesamte Wirklichkeit generalisiert werden. Die Beschäftigung mit Sprache musste somit als Test herhalten: Ist die Beziehung zwischen Laut und Bedeutung willkürlich (arbitrary), also von zwischenmenschlicher Konvention abhängig (so die sogenannten Anomalisten) oder ist sie natur- und damit göttergegeben (so die sogenannten Analogisten)? Konstitutiv für die sprachwissenschaftliche Reflexion war mithin ein angewandtes Ziel: Es war philosophischer und übergreifend sogar theologischer Natur.
Die frühen arabischen Schulen: Ihnen ging es bei allen strukturellen linguistischen Erkenntnissen letztlich nicht um Erkenntnis um ihrer selbst willen, sondern ganz gezielt um den Fremdsprachenunterricht für Angehörige unterjochter Gruppen, denen man die Lektüre des Koran ermöglichen wollte, der in andere Sprachen halt nicht übersetzt werden durfte. Konstitutiv und hier auch klar finalisierend war wieder ein angewandtes Ziel linguistischen Tuns.
Das Mittelalter Europas: Neben einer Betonung des Verhältnisses zwischen Grammatik und Logik war hier die Stufung philologia ancilla theologiae von Bedeutung, und mithin auch hier wieder ein der Religion dienendes, angewandtes Ziel.
Die Entwicklung der Philologien von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zu den Komparativisten und Junggrammatikern des 19. Jahrhunderts war letztlich gleichermaßen angewandt motiviert. Die Erkundung und Beschreibung von Sprachen außerhalb der eigenen Sprache sowie des Griechischen und Lateinischen lieferte zwar ein nicht überschätzbares Fundament für deren historische sowie synchrone Analysen mittels der theoretisch-methodischen Instrumentarien der gegenwärtigen Linguistik. Indes waren diesen übergeordnete, angewandte Interessen der Auslöser für jene bahnbrechenden sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse: Wo stehe ich mit meiner Sprache, meinem Denken, meiner Kultur im Verhältnis zu anderen? Verstärkt durch die Romantik ergab sich beispielsweise auch die Frage: Was sagt mir die nunmehr thematisierte Geschichte meiner Sprache über meine sprachlich-kulturellen Wurzeln?