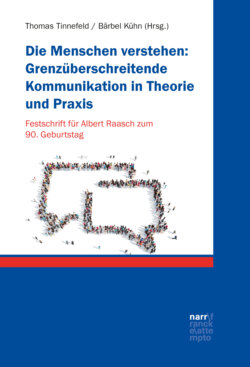Читать книгу Die Menschen verstehen: Grenzüberschreitende Kommunikation in Theorie und Praxis - Группа авторов - Страница 5
Vorwort
Оглавлениеvon Thomas Tinnefeld
Dem verdienten Linguisten und Fremdsprachendidaktiker Professor Albert Raasch meinen ganz herzlichen Glückwunsch zu seinem 90. Geburtstag. Es erfüllt uns alle – und ich spreche hier bewusst auch im Namen von Bärbel Kühn und allen Beiträgern und Beiträgerinnen zu diesem Band – mit großer Freude und Dankbarkeit, eine Festschrift zu einem solch hohen Geburtstag herausgeben bzw. zu dieser beisteuern zu dürfen, was wissenschaftshistorisch unzweifelhaft eine große Rarität darstellt. Dass ein Wissenschaftler ein solches Alter erreicht, ist schon nicht selbstverständlich; noch viel weniger erwartbar ist, dass er auch in diesem Alter in seiner Disziplin aktiv ist. Albert Raasch ist somit nicht nur als Mensch und als Romanist herausragend, sondern darüber hinaus stellt das Faktum, dass er sein jahrzehntelang erworbenes und immer mehr verfeinertes Wissen auch weiterhin der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und dieser damit die Chance gibt, daran auch lange nach seiner Emeritierung teilzuhaben, ein weiteres Verdienst Albert Raaschs dar.
Es würde sicherlich zu weit führen und lediglich ein höchst unvollkommenes Ergebnis zeitigen, wollte man versuchen, an dieser Stelle Albert Raaschs Leben nachzuzeichnen. Daher mögen hier lediglich einige sehr subjektiv ausgewählte Schlaglichter genügen, die den meisten Romanisten wahrscheinlich ohnehin bekannt sein dürften. Als Hochschulprofessor seit Ende der 1960er und ordentlicher Professor an der Universität des Saarlandes für Angewandte Linguistik und das damals sehr neue Fach Sprachlehrforschung Anfang der 1970er Jahre überblickt Albert Raasch mehr als 50 Jahre der Geschichte seiner Lehr- und Forschungsgebiete und darf somit ohne Übertreibung gleichsam als wandelnde Enzyklopädie dieser angesehen werden. Dabei war er sich zu keinem Zeitpunkt zu schade, auch die Praxis des Fremdsprachenunterrichts fördernde Werke zu veröffentlichen, deren Existenz vielen zu früheren Zeiten und ebenso heute tätigen Romanisten aus eigener Anschauung und / oder eigener Nutzung heraus bekannt sein dürfte. Ob es sich dabei um den französischen Mindestwortschatz oder die französische Mindestgrammatik handelt, den französischen Anfangsunterricht, das Wie der Erlernung von Fremdsprachen oder besonders leichte Zugänge zu diesem – immer ging und geht es Albert Raasch darum, Fremdsprachen als zugängliche Größen zu verstehen und zu beschreiben und sie in ihrer grenzüberschreitenden Funktionalität zu fördern. Persönlich aus dem „hohen Norden“ Deutschlands kommend und diesem nach wie vor geographisch und emotional verbunden, setzt er sich bis heute folgerichtig für das Saarland – hier sei nur der von ihm gegründete Sprachenrat Saar erwähnt – und die Großregion SaarLorLux ein, deren Charakter einer Grenzregion ihm besonders am Herzen lag und liegt. Seine Publikationen – ob in Buchform, in Herausgeberschaften oder auch in Aufsatzform – decken die Angewandte Linguistik und die Sprachlehrforschung in der jeweiligen Praxis, aber natürlich auch in der dieser zugrundeliegenden Theorie, in beeindruckender Manier ab. Seine Tätigkeit in Verbänden und Vereinigungen, die nicht zuletzt dazu verhalfen, angewandt-linguistische und fremdsprachendidaktische Erkenntnisse zum Nutzen einer breiteren Öffentlichkeit umzusetzen, zeugen von seinem politischen Bewusstsein und ebenso seiner Fähigkeit, die sprichwörtlichen „dicken Bretter“ zu bohren, die es zu einer derart erfolgreichen Umsetzung bedarf. In diesem Zusammenhang sei hier lediglich die Gesellschaft für Angewandte Linguistik erwähnt, zu deren Gründungsvätern Albert Raasch gehörte und die – was für eine Dimension – vor zwei Jahren ihr fünfzigjähriges Bestehen gefeiert hat. Das Faktum, dass Albert Raasch in seinem bisherigen Leben zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, die ihn zu einem hochdekorierten Wissenschaftler machen, ist somit hochgradig verdient und zeigt gleichzeitig, dass er in seiner Arbeit immer auf der Höhe der Zeit gewesen ist – woran sich bis heute nichts geändert hat.
Die vorliegende Festschrift ist aufgrund einer recht spontanen Initiative von Bärbel Kühn entstanden. In einem Moment der unmittelbaren Begeisterung habe ich diesen Vorschlag der Zusammenarbeit für den verehrten Jubilar sehr gern angenommen, und wir sondierten die Lage, um auf diese Weise zu erfahren, ob sich ein solches Vorhaben realisieren lassen würde. Als dessen Realisierbarkeit sich immer mehr herauskristallisierte, machten wir uns an die Arbeit und fanden zahlreiche Kollegen aus früheren und ebenso neu(er)en Zeiten, die ihre Zusammenarbeit unmittelbar zusagten, wofür wir ihnen an dieser Stelle herzlich danken.
Obwohl Bärbel Kühn und ich diesen Band miteinander zusammengetragen haben, haben wir uns dazu entschlossen, hier je ein getrenntes Vorwort beizusteuern, da uns unterschiedliche Kontexte mit dem Jubilar verbinden und wir diese so konsistenter beschreiben können.
Albert Raasch ist mir zwar seit Jahrzehnten – bereits als Student – auf der Basis seiner Schriften bekannt, tiefer persönlich kennengelernt haben wir uns jedoch erst im Jahre 2011 auf der – wenn dies hier hinzugefügt werden darf – von mir organisierten und geleiteten 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung. Albert Raasch erwies nicht nur dieser Tagung die Ehre, sondern ebenso allen vier, bisher auf jene folgenden Tagungen der gleichen Reihe wie auch drei Symposien zum Französischen, die ebenfalls in Saarbrücken stattfanden. Zudem begegneten wir beide uns immer wieder auf verschiedenen anderen, teilweise sprachpolitischen Veranstaltungen und zum Teil von ihm selbst (mit)organisierten oder geleiteten Veranstaltungen, die in den vergangenen zehn Jahren im Saarland stattfanden, und entwickelten während der zahlreichen Gespräche, die wir zu diesen Anlässen führten, eine sehr herzliche persönliche Beziehung zueinander. Dabei beeindruckte Albert Raasch mich ein um das andere Mal mit seiner persönlichen Ruhe, seiner tiefen Menschlichkeit und Freundlichkeit und nicht zuletzt mit einer Bescheidenheit, die nur den wirklich Großen zu eigen ist, sowie mit seiner Beharrlichkeit in der Verfolgung der wissenschaftlichen und (sprach)politischen Ziele, die ihm am Herzen lagen und liegen. Kurzum: Albert Raasch ist mir in den vergangenen zehn Jahren sehr ans Herz gewachsen, wenn dies hier so persönlich ausgedrückt werden darf, und ich freue mich, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu dürfen, ihm im Kontext des vorliegenden Bandes eine kleine Freude bereiten zu können.
Dabei hatte ich die Ehre und das Vergnügen, mich der Aufsätze der folgenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen annehmen zu dürfen, welche im Anschluss kurz beschrieben werden sollen – und dies in der Hoffnung, damit nicht die Spannung der Lektüre der Volltexte vorwegzunehmen, sondern diese im Idealfalle vielleicht sogar noch ein wenig weiter aufzubauen.
Im wahrsten Wortsinn spannend ist ein persönlicher Blick in die Geschichte, den uns Wolfgang Kühlwein vermittelt und der sich auf die Gesellschaft für Angewandte Linguistik und somit auch auf einen wichtigen Abschnitt des gemeinsamen Lebensweges des Autors und des Jubilars bezieht. Im Beitrag wird deutlich, wie visionär Albert Raasch und seine Mitstreiter vor 50 Jahren waren und wie weitsichtig sie agierten, ohne dabei den weitläufigen historischen Kontext Ihres Tuns aus dem Blick zu verlieren. Es liegt hier ein wichtiges Zeitzeugnis vor, das solchen Lesern, die damals mit von der Partie waren oder auch im näheren oder weiteren Umfeld der Akteure wirkten, viele wertvolle Erinnerungen (und oft vielleicht auch inzwischen Vergessenes) wachruft, sich aber auch für jüngere Leser als hochgradig inspirierend erweist und ihnen nicht zuletzt auch einen gewissen Respekt vor den Leistungen ihrer (Vor)Vorgänger einflößt.
Einen Einblick in die Sprachenpolitik der Großregion SaarLorLux gibt Claudia Polzin-Haumann mit Blick auf die berufliche Bildung in dieser Grenzregion, die Albert Raasch, wie erwähnt, traditionell sehr am Herzen liegt. Der hier gegebene Einblick in vorhandene Strukturen, aufgelegte Programme und nicht zuletzt die jeweils gültige Nachbarsprachenpolitik vermitteln einen anregenden Eindruck von konkreten Herausforderungen dieser von hoher grenzüberschreitender Mobilität und (nicht selten) der Beherrschung der Sprache der jeweils „Anderen“ geprägten Region, und das von der Autorin gezogene Fazit hinsichtlich des bisher Erreichten stimmt hoffnungsfroh – auch und besonders in dem Bewusstsein, dass dieser Prozess naturgemäß ein nie enden wollender ist und ein immer neuen Herausforderungen ausgesetzter sein wird.
Ganz im Sinne des Jubilars sieht Eva-Martha Eckkrammer die Mehrsprachigkeit als den Normalfall an – und dies umso mehr in einer Zeit wie der gegenwärtigen, in der eher (sprach)kulturelle Konvergenz als Divergenz herrscht. Aufbauend auf Wilhelm von Humboldt und seiner Philosophie einer jeweils eigenen Weltsicht, die sich über eine jeweils andere Sprache erschließt, hält sie – nicht zuletzt in historischer Perspektive und unter besonderer Berücksichtigung des Französischen – ein leidenschaftliches wissenschaftliches Plädoyer zugunsten der sprachlichen Vielfalt, wobei sie besonders der Vorherrschaft des Englischen als Wissenschaftssprache kritisch gegenübersteht und ein Mehr an Selbstvertrauen vonseiten der übrigen Wissenschaftssprachen – z.B. des Französisch oder auch des Deutschen – einfordert, wohl wissend, dass sich hier auf den unterschiedlichsten Ebenen hochkomplexe Konstellationen ergeben, die keinerlei einfacher Lösungen harren.
Franz-Joseph Meißner befasst sich mit der romanischen Mehrsprachigkeit – und in diesem Bereich mit dem Beitrag des Englischen zum Erwerb eines romanischen Kernwortschatzes. In gewissem Sinne liegt hier eine komplementäre Sichtweise zu der kultur- bzw. bildungspolitisch kritischen Position der Konkurrenz zwischen dem Englischen einerseits und den romanischen Sprachen andererseits vor, indem das Englische als potentielle Chance betrachtet wird, bei Fremdsprachenlernern zu einer Erweiterung ihrer Interkomprehension im Bereich der romanischen Sprachen beizusteuern. Wie aufwendig diese Arbeit ist, wird deutlich, wenn man sich die Ausführungen des Autors zu der Datenbank Kernwortschatz der romanischen Mehrsprachigkeit (KRM) vor Augen führt. Dabei ergeben sich erhebliche Transferschnittstellen zwischen dem Englischen einerseits und den Sprachen der Romania andererseits – ein Eindruck, den wir alle, die wir uns lehrend und lernend in diesem Bereich bewegen, mit Sicherheit bereits gehabt haben, der hier jedoch auf eindrucksvolle Weise wissenschaftlich bestätigt wird. Die hier vorgenommenen Beschreibungen und Analysen unterstreichen die seit Jahren erhobene Forderung der curricularen Integration der Interkomprehension in den Fremdsprachenunterricht. Im Sinne einer das Englische einbindenden Didaktik der romanischen Mehrsprachigkeit würden sich dabei ungeahnte Synergie-Effekt ergeben.
Mit dem Themenfeld individuelle Mehrsprachigkeit beschäftigt sich Nadine Rentel, die auf der Basis eines Leitfadeninterviews die sprachliche Biographie einer multikulturell und multilingual sozialisierten Sprachwissenschaftlerin nachzeichnet und analysiert. Erhoben und anschaulich ausgewertet werden dabei deren individuelle Sprachlernmotivation, ihre Einstellung zu den jeweiligen Fremdsprachen und ihr jeweiliger Spracherwerbs- und Sprachverwendungskontext. Besonders mit Blick auf den zuletzt genannten Gesichtspunkt stellt die Autorin in Frage kommende Einflussfaktoren in den Raum, die zwar von Individuum zu Individuum variieren können, sich bei der Mehrheit ähnlich sozialisierter Sprecher jedoch sicherlich in der einen oder anderen Form ebenfalls manifestieren.
Auf der Basis von Überlegungen des Jubilars aus den vergangenen Jahrzehnten diskutiert Karl-Heinz Eggensperger mögliche Wissens- und Sprachminima, die zu der Entwicklung und Sicherstellung eines curricular verankerten, funktionalen Ausdrucksvermögens führen. Dabei geht es um die Frage, wie nicht nur ein begrenzter Gesamtwortschatz vermittelt werden kann, sondern auch ein begrenzter Wissensausschnitt, und mit diesem die zu dessen Versprachlichung notwendigen Ausdrucksmittel. Exemplarisch wird als ein solcher Wissensausschnitt der droit des obligations (Schuldrecht) herangezogen. Dabei veranschaulicht der Autor in höchst praktischer Manier, wie ein solches Sachfeld ausgegrenzt werden kann und auf welche Weise Lernprozesse für die Rezeption entsprechender Fachtexte unterstützt werden können. Es bleibt zu hoffen, dass das eigentliche Anliegen des Autors gelingt, mit seinem Beitrag eine Diskussion über Sprachökonomie und Wissensökonomie im Fremdsprachenunterricht anzustoßen, was besonders, aber nicht ausschließlich, mit Blick auf einen effizienten Fachsprachenunterricht sicherlich hochgradig nützlich wäre.
Eine auf Französisch verfasste, linguistische Analyse zu spezifischen, in der frankophonen afrikanischen und französischen Presse belegten lexikalischen Ko-Okkurrenzen steuert Peter Blumenthal bei. Dabei konzentriert er sich auf affektive Basislexme wie désir, tristessse, solitude oder volonté und wendet eine probabilistisch ausgerichtete statistische Analyse auf diese an, die aufgrund von deren jeweiligem Kotext Rückschlüsse auf die inhaltliche Verwendung dieser Lexeme erlaubt. Dabei ergibt sich nach Einschätzung des Autors die – in weiterer Forschung zu verifizierende – prinzipielle Möglichkeit, auf der Ebene der lexikalischen Kombinatorik und der Konzeptualisierung von Wörtern konkrete Konvergenzen und Divergenzen in der Entwicklung der Frankophonie aufzuspüren, wobei manche Unterschiede in der Verwendung des Französischen in Frankreich und Afrika durchaus aufschlussreich sind.
Ebenfalls mit Konvergenzen und Divergenzen, jedoch mit einem ganz anderen Bezugsfeld, untersucht Heidrun Gerzymisch, in enger fachlicher Anlehnung an Albert Raasch, die vielfältigen Beziehungen zwischen der Angewandten Linguistik und der Übersetzungswissenschaft in begrifflicher Hinsicht und mit Blick auf ihre jeweiligen Beschreibungskategorien – insbesondere das Operationalisieren, die Mittlung vs. Vermittlung von Text und Botschaft sowie Vergleich und Transfer – wobei sie nicht zuletzt aufschlussreiche Berührungspunkte zwischen beiden herausarbeitet. Mit Blick auf die Mehrsprachigkeit ergibt sich für die Autorin in diesem Kontext die Frage der – zumindest theoretischen – Möglichkeit einer Verknüpfung von universaler Kommunikation mit gemittelter Kommunikation, in der dann auch die Angewandte Linguistik und die Translationswissenschaft sowie die Kommunikations- und die Kulturwissenschaft verortbar wären.
Mit der Unsicherheit im Übersetzungsprozess und ihrem Umgang, durch die das Übersetzen – als fortgesetzter Entscheidungsprozess – naturgemäß geprägt ist, beschäftigt sich Christiane Nord. Die Autorin beschreibt und analysiert hierarchisch von oben nach unten – also vom Allgemeineren zum immer Konkreteren –, auf welche Weise diese verschiedenen Arten der Unsicherheit, die sich dem Übersetzer in seiner Verantwortung gegenüber dem Autor und dem Leser, aber auch gegenüber dem Auftraggeber, stellen, verringert – wenn auch nicht gänzlich vermieden – werden können. Typologisch ergibt sich dieser Weg aus der grundlegenden Wahl des Übersetzungstyps (dokumentarisch oder instrumentell) und sprachlich aus der schrittweisen Lösung von Problemen, ausgehend von der Pragmatik, über Kultur und Sprache bis hin zu einzelnen Wörtern und Morphemen. Die jeweils konkret gegebenen Beispiele lassen diesen Beitrag zu einer instruktiven Lektüre für jeden an der praktischen Seite der Übersetzung Interessierten werden.
Christine Sick beschreibt in ihrem Beitrag die neueste Entwicklung Ihres Sprachlernprogramms TechnoPlus Englisch von dessen computerbasierter hin zu seiner mobilen Version. Dabei ergeben sich interessante Einblicke hinsichtlich der bei einer solchen Entwicklung zum Tragen kommenden Faktoren, wie z.B. der didaktischen Konzeption, der Zielgruppe oder auch einer entsprechenden Bedarfsanalyse. Durch die Beschreibung der einzelnen Komponenten des Programms und der auf diesem basierenden Wortschatz-Trainer-App erhalten die Leser einen Eindruck von dessen Wirkungsweise, von seinem didaktischen Potential, von seiner technischen Dimension und nicht zuletzt von seinem Nutzen für die Zielgruppe: die Studierenden der Ingenieurwissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Mit Bezug auf die literaturwissenschaftliche Seite Albert Raaschs beschäftigt sich Uwe Dethloff mit Jean-Jacques Rousseau und der Veränderung des Verständnisses der Natur in der literarischen Landschaftsdarstellung. Vor dem Hintergrund der neuen Naturkonzeption im 18. Jahrhundert in Frankreich entwickelt der Autor Jean-Jacques Rousseaus Pionierrolle aus dem Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes und den Rêveries du promeneur solitaire und analysiert die literarische Landschaftsgestaltung im französischen Roman ab etwa der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anhand von Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse und Senancours Oberman sowie Bernardin de Saint-Pierres Roman Paul et Virginie und Chateaubriands Novelle René. Hochinteressant ist zudem die Spiegelung der hier vorgenommenen Analysen des Autors mit seiner Einschätzung des Naturverständnisses im 21. Jahrhundert, durch die dieser eigentlich historische Beitrag eine gleichsam unerwartete Aktualität erhält.
In seinem ebenfalls historisch ausgerichteten, aber an der Gegenwart orientierten Beitrag beschäftigt sich Heinz-Helmut Lüger vor dem Hintergrund des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) und der Bologna-Reform mit geschichtlichem Kontextwissen und frankreichkundlicher Textarbeit. Anhand seiner Analyse zweier Reden – derjenigen des damaligen Pariser Bürgermeisters Jacques Chirac anlässlich des Amtsantritts des damals neu gewählten Staatspräsidenten François Mitterrand vom 21. Mai 1981 und dessen Antwort – zeigt der Autor anschaulich auf, dass es bei weitem nicht hinreicht, lediglich über Wortschatz- und Grammatikwissen zu verfügen, wie dies im GeR abgebildet wird, sondern dass fundierte Geschichtskenntnisse, kulturelle Kenntnisse, das Wissen um die politischen Hintergründe und die Biographien der beiden im Mittelpunkt stehenden Personen etc. vorhanden sein müssen, um die verschiedenen explizit und implizit ausgedrückten Sachverhalte, die im Text gemachten Anspielungen und die im Gesagten enthaltenen Präsuppositionen dekodieren zu können. Gerade, weil hier bei Muttersprachlern – in diesem Falle also Franzosen, die ihre Geschichte zudem recht gut kennen – und Nicht-Muttersprachlern, die nicht in der gleichen Kultur sozialisiert worden sind, im Allgemeinen erhebliche Unterscheide in der Verständnistiefe bestehen, erachtet der Autor landeskundliches und kulturorientiertes Lernen als unabdingbar für das Textverstehen und die erfolgreiche Kommunizierung von Kontextwissen, wobei ihm sicherlich unproblematisch zugestimmt werden kann.
Allen Beiträgern und Beiträgerinnen sei an dieser Stelle sehr für Ihre Aufsätze gedankt, mit denen Sie Albert Raasch ehren.
Schließlich danken Bärbel Kühn und ich Christine Sick, die ihre Mailinglist aktiviert hat und dank derer es uns möglich wurde, die tabula gratulatoria zu vervollständigen.
Schließlich bitten wir bei all denjenigen Begleitern Albert Raaschs auf seinem Lebensweg, die wir im Zusammenhang mit dieser Festschrift nicht kontaktiert haben, um Verständnis: Sollte dies vorgekommen sein, so ist es in keinem einzigen Fall mit Absicht geschehen. Zudem sei auch all jener Lebensbegleiter Albert Raaschs gedacht, die nicht mehr physisch unter uns sind und die unter anderen Umständen hier ebenfalls vertreten wären. Schließlich geht der Dank auch an diejenigen, die gern zu diesem Band beigetragen hätten, dies jedoch aus gesundheitlichen Gründen leider nicht tun konnten.
In diesem Sinne Dir, lieber Albert, weiterhin frohes Schaffen und vor allem viel Gesundheit, Lebensfreude und das wunderschöne Bewusstsein, dass Du heute ebenso wie früher von uns allen und darüber hinaus von unzähligen weiteren Menschen geschätzt, bewundert und geliebt wirst.
Saarbrücken, im Juli 2020 Thomas Tinnefeld