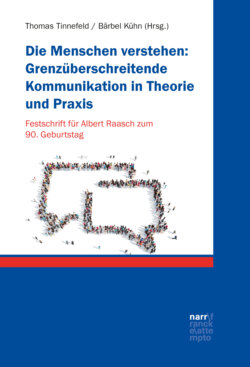Читать книгу Die Menschen verstehen: Grenzüberschreitende Kommunikation in Theorie und Praxis - Группа авторов - Страница 6
Vorwort
Оглавлениеvon Bärbel Kühn
Beginnen möchte ich meine kleine Ergänzung zum Vorwort von Thomas Tinnefeld mit einer Frage, mit der ich nicht allein dastehe unter den Beiträger*innen dieser Festschrift. Und auch Albert Raasch hat sie uns beiden schon gestellt: Seit wann kennen wir uns eigentlich schon?
Zur Beantwortung dieser Frage muss ich lediglich die alten Lehrpläne für die Goethe-Institute in Deutschland aus meinem Regal ziehen: Auf Seite 3 steht Goethe-Institut 1996, auf Seite 4 steht Prof. Dr. Albert Raasch (Universität Saarbrücken) als Mitglied im Projektbeirat und Dr. Bärbel Kühn als Mitglied in der Projektgruppe. Ich weiß nicht mehr, ob wir erst 1995 mit der Arbeit an diesen Lehrplänen begonnen haben oder schon 1994; aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Kollege in der Projektgruppe, Dr. Hans-Dieter Dräxler, dem Goethe-Institut vorschlug, Prof. Albert Raasch, den er aus der Linguistik kannte, als Berater hinzuzuziehen. Die Lehrpläne wurden, wie Albert Raasch weiß, zu einem wichtigen Vorläufer für den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.
In meiner Erinnerung sprach Albert schon damals vom Sprachenrat Saar, der 1991 gegründet wurde; es kann aber auch später gewesen sein, denn wir blieben in Kontakt und als ich 2009 in Bremen vorschlug, einen Sprachenrat zu gründen, kam die Idee natürlich von ihm und natürlich stand er uns beratend zur Seite. Und so ging es weiter mit uns: Ich hatte inzwischen das Goethe-Institut als Arbeitgeber mit den Hochschulen im Land Bremen getauscht, wo wir im Sprachenzentrum gemeinsam mit dem Arbeitskreis der Sprachenzentren alle zwei Jahre ein internationales Symposion veranstalteten. Selbstverständlich war Albert Raasch stets der Ehrengast und nie werde ich seine Formel für die Einleitung seiner Fragen im Plenum vergessen: „Ich möchte ja noch lernen, daher möchte ich fragen…“
Einmal hat er mich auch auf eine wunderschöne Reise mitgenommen: im Oktober 2004 in die Slowakei nach Banská Bystrica. Auf einer Konferenz an der dortigen Matje-Bel-Universität durfte ich einen Vortrag über das e-Portfolio EPOS halten, das wir in Bremen entwickelt hatten. Erst dort erfuhr ich, dass er seit 1994 Träger einer Medaille dieser Universität ist. Das ist Albert Raasch: Aus seiner Ehrung dort entwickelte er eine Förderung für mich. Danke, Albert!
Und noch mit unserer Festschrift entwickelte es sich für mich ähnlich: Autorinnen und Autoren, die ich bisher häufig nur ihren Namen nach kannte, die ich jetzt jedoch um einen Beitrag bitten durfte, wurden zu Kommunikationspartner*innen. Die gemeinsame Bekanntschaft mit Albert Raasch war unsere Vermittlerin. Mit einer kleinen Vorbereitung auf sie und ihre Beiträge möchte ich daher meinen Teil der Einführung abschließen.
Britta Hufeisen schreibt ihren Beitrag aus der gemeinsamen Geschichte mit Albert Raasch im Engagement für Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL). Was Anfang der neunziger Jahre noch über die Bildung einer Arbeitsgruppe in der GAL thematisch verfolgt werden konnte, ist heute als zu formulierendes Projektvorhaben mehr und mehr abhängig von der Frage der Finanzierung und damit auch von den Forschungsinstitutionen oder auch den Stiftungen, bei denen eine solche beantragt werden muss.
Hans Giessen zeigt am Beispiel der Höflichkeitsformel „bitte“, dass zur angewandten Linguistik landeskundliche und kulturelle Themen ebenso gehören wie grammatikalische und lexikalische. In diesem Zusammenhang kritisiert er ein für die Fremdsprachendidaktik hinderliches „nur bedingt“ einheitliches Vorgehen von Wörterbüchern.
Die hohen Potentiale von Grenzregionen für das Lernen der Nachbarschaftssprachen verdeutlicht Christina Reissner an einem Beispiel aus der grenzüberschreitenden Primarschullehrerausbildung an der Universität der Großregion. Sie berichtet von einem deutsch-französischen Projektseminar im Wintersemester 2019 / 20, in dem Lehramtsstudierende beider Länder, ausgestattet mit einem „Lernkoffer“ zu unbeliebten Tieren, die andere Sprache zugleich als Unterrichtsgegenstand und als Kommunikationsmittel erfahren konnten.
In seinem Beitrag zu „Sprachenlernen als Grenzerfahrung“ betont Hermann Funk, dass Sprachbedarfe nicht einfach aus der Situation von Grenzregionen heraus entstehen. So lässt auch dort die Bedeutung des Englischen als internationale Berufssprache das Lernen der Nachbarsprache als unnötig erscheinen. Aber auch diese Erfahrung hat ihre Grenzen. Das zeigt die neue Bedeutung von Herkunfts- und Nachbarsprachen, etwa von Arabisch im Elsass und Portugiesisch in Luxemburg.
Mit dem Beitrag von Sabine von Oppeln sind wir wieder in der Grenzregion, diesmal bei ihren sozialpolitischen Besonderheiten. Wie dieser Beitrag zeigt, ist Sozialpolitik ein guter Seismograf dafür, wie es um Europa steht. Die sozialpolitischen Belange Gesamteuropas zu beachten, wie es Albert Raasch schon immer tut, setzt voraus, egoistische nationale Interessen zurückzustellen. Gerade mit Corona, so von Oppeln, ist Solidarität in sozialpolitischer Hinsicht zu einer Kernfrage für ein einiges Europa geworden.
Mit Norbert Gutenberg überschreiten wir – zumindest ich – eine Brücke von einem (mir)noch recht vertrauten Ort didaktischer Anwendung, der Sprecherziehung, zu einem Ort mit dem Namen Sprechwissenschaft, wo (mir) die meisten Begriffe völlig neu sind. Hier ist nicht der Satz die entscheidende Kategorie, sondern der Sinnschritt und die Sinnintention, aus der er sich ergibt. Und nicht die Satzgrammatik bestimmt den Sinnschritt, sondern die Erfordernisse des „reihenden“ Sprechens, also (in meiner Interpretation) der gesprochenen Alltagssprache.
Georges Lüdi geht aus von den „additiven Modellen“ von Mehrsprachigkeit, wie sie etwa noch das Konzept des europäischen Sprachenportfolios des Europarats geprägt haben. Die „integrativen Modelle“, die er ihnen gegenüberstellt, waren lange verpönt als Sprachenmischung, gerade auch in seinem Herkunftsland, der viersprachigen Schweiz. Dem gegenüber demonstriert er mit dem Ausschnitt aus einer empirischen Untersuchung ein Konzept von Mehrsprachigkeit, die sich als „sozio-kognitiver“ Prozess entwickelt.
Eynar Leupolds geht hinter Saarbrücken zurück auf Albert Raaschs Professur in der Romanistik an der Universität Kiel, wo der Autor ihn 1969 als frisch eingeschriebener Student kennenlernte. In den kommenden Jahren erlebte er, wie Albert Raaschs wissenschaftliche und publizistische Arbeiten sowie sein sprachenpolitisches Engagement im Hochschul-, Schul- und Volkshochschulbereich die Entwicklung und Profilierung des Faches Angewandte Linguistik einerseits und ihre Anwendung auf die Fremdsprachendidaktik andererseits maßgeblich beeinflussten – bis hin zur Entwicklung neuer Lernmethoden wie der „Tandem-Methode“.
Der Beitrag von Hans Jürgen Krumm betont „in Anlehnung an die Überlegungen von Albert Raasch“ zur Verhinderung von Bildungsnachteilen die Notwendigkeit der besseren Verankerung der Sprachen von Kindern aus zugewanderten Familien im Bildungssystem als „Begegnungs- und Nähesprachen“. Wie dies zu erreichen ist, zeigt er mit der Vorstellung seines Mehrsprachigkeitscurriculums, das im Auftrag des österreichischen Unterrichtsministeriums entwickelt wurde.
Rudi Camerer und Jürgen Quetz widmen ihren Beitrag dem Thema Mediation im Companion, dem gerade erst (2020) auch auf Deutsch erschienenen neuen Begleitband zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) Albert Raasch, weil er es ist, den sie vor sich sehen, wenn sie gemäß Companion Team Management als wichtiges Bezugsfeld für Kompetenzen der Mediation beschreiben. Hinführend zeigen sie, wie sich das Konzept des Companion im Vergleich zum GeR geändert hat, wird doch mit dem Konzept von Mediation erstmals auch die Beziehungsebene als eine Ebene kommunikativen Handelns einbezogen. Wie gerne schließe ich mich ihrer Widmung an!
Saarbrücken, im Juli 2020 Bärbel Kühn