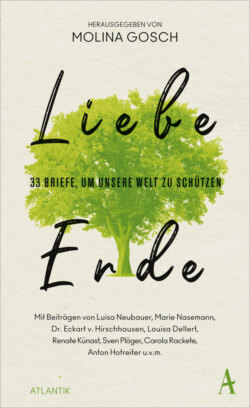Читать книгу Liebe Erde - Группа авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Luisa Neubauer
ОглавлениеIch muss euch warnen, in diesem Text1 kommt keine Generation gut weg. Aber am Ende können wir alle Frieden schließen, versprochen. Hang in there with me.
Okay. Ab und zu, wenn ich einen Vortrag oder eine Rede halte, bedankt man sich danach bei mir mit einem kleinen Buch. Ich meine nicht irgendein Buch, sondern ein ganz bestimmtes. Es heißt »Das hier ist Wasser« von David Foster Wallace. Mittlerweile habe ich also eine fröhliche Auswahl an Exemplaren davon zu Hause. Das Buch, das aus nur einer einzigen brillanten Rede des US-amerikanischen Autors besteht, beginnt mit einer Geschichte über Fische im Wasser. Und die geht etwa so: Es schwimmen zwei junge Fische im Wasser. Dann kommt ein alter Fisch vorbei und nickt und sagt: »Morgen, Jungs, wie ist das Wasser?« Die beiden jungen Fische schwimmen weiter, da guckt der eine den anderen irritiert an und fragt: »Was zum Teufel ist Wasser?«
Und die Moral? Zunächst logisch, die Jungen sind, wie so oft, blind für das Wesentliche, nehmen für geschenkt, was da ist, hinterfragen nicht. Was ist schon Wasser? Und es stimmt, es ist wahnsinnig leicht, die Dinge für gegeben zu erklären. Nicht nachzufragen, aufzuhorchen. Wir Jungen sind Teil einer Generation, die Krisen lange kaum kannte, die einzigartig unerfahren und unerprobt in Sachen Krise ist. Wir sind Teil einer Generation, die ein geeintes Deutschland und ein weitgehend friedliches Europa erlebt hat. Mehr als das, wir sind auch Generation Interrail, und wir müssen eine Europareise – im Gegensatz zu unseren Eltern – nicht als symbolischen Akt der Post-War-Völkerverständigung zelebrieren, nein, wir können das einfach feiern, uns feiern, und das Leben und die Sangriapreise in Valencia. Europa, wie Wasser. Und es geht weiter, unsere Währung war fast immer stabil, außenpolitische Krisen hatten vor allem die anderen. Wir sind viele junge Menschen, die im wachen politischen Leben nur eine einzige Kanzlerin kennen, und sie ist der Inbegriff von Wasser, unaufgeregt, wenig Kanten, erhitzt sich nur langsam. Aber es ist noch mehr, was uns so selbstverständlich wie Wasser serviert wurde: das Backpacken auf Bali, das Roadtrippen an der australischen Ostküste, Regenjacken in Peru für die einen, für 15 Euro über den Wolken nach Rom für die anderen, party all night long. Der 50-Outfits-Kleiderschrank, von Primark für die einen oder von Zara für die anderen, dazu Schuhe in Weiß. Baby, wieso liebst du diesen Typ mit den Nikes, singen RIN und Bausa dazu, im Takt. Wenn du dich anstrengst, kann aus dir alles werden. Und vor allem kannst du alles haben. Die Nikes genauso wie ein freies Leben.
Alles da, immer da, immer mehr da. Wie Wasser. Und ja, wir wissen, es geht nicht allen gleich gut. Es geht manchen in dieser wohlständigen Gesellschaft, in dieser wohlständigen Generation, richtig schlecht. Aber es könnte anders sein, das ist die Erzählung. Denn wir leben doch im Sozialstaat, alle können es schaffen, alle können, wenn sie nur wollen. Auch das ist ein Versprechen unserer Generation, Chancen haben alle. Ergreift sie, der Ozean ist groß, kommt ins Wasser, traut euch.
Man fragt uns, was wir einmal werden wollen, und wir antworten in den Kategorien Höher, Weiter, Schneller. Und in der Kategorie »ich«, denn »ich« kann mir das ja nicht so sehr vorstellen, acht Stunden im Büro, nein, nur im Team, was Kreatives, vielleicht, remote. Was sich für »mich« richtig anfühlt halt. Ich und du im Wasser, alles geht.
Die Geschichte, die jetzt folgt, handelt von Dankbarkeit, von Privilegien und der Feststellung, dass nichts selbstverständlich ist. Oder so: Das Wasser ist eine Illusion. All das, was uns umgibt, ist Resultat von Arbeit und Schaffenskraft und Energie. Das allermeiste dafür haben, logischerweise, Generationen vor uns getan. Der Appell ist eingängig, macht die Augen auf, Kinder, seid dankbar und nehmt nichts für geschenkt.
Das Problem ist nun: Wie macht man das Wesentliche sichtbar? Wie funktioniert es, das Reflektieren der scheinbaren Selbstverständlichkeiten, wie erkennt man Wasser? Da helfen schon zwei Fragen, anwendbar in jeder möglichen Situation. Die eine heißt: Was ist hier passiert, bevor ich hergekommen bin, was war, bevor ich war? Und die zweite Frage lautet: Was passiert, wenn ich gehe?
Die Geschichte, die nicht erzählt wird, ist eine andere, und sie handelt von einem Status quo, einer Normalität in der Krise. Denn das Wasser ist eine Illusion, aber die Sicherheit, die Beständigkeit, die Stabilität eben auch. Oder anders: Als sich die Fische im Meer treffen, haben sie allesamt Plastik im Bauch.
Generationen vor uns haben, wissentlich und unwissentlich, eine Welt für uns vorbereitet, die auf den ersten Blick eine Offenbarung und auf den zweiten Blick eine Zumutung ist.
Es wurde ein Wohlstand erarbeitet, der nur so lange einer ist, wie man mit aller Kraft die Augen verschließt vor den Kosten, dem Leid, dem Elend, auf denen er aufbaut. Man präsentiert uns eine Freiheit, die als ein Recht auf Zerstörung interpretiert wird. Es werden uns Möglichkeiten aufgezeigt, die an der Krisenrealität zerschellen. Es kann zwar alles aus dir werden, nur ist die Klimakrise schneller. Kind, bereise die Welt, bevor wir sie komplett kaputt gemacht haben.
Das bringt uns in einen Konflikt, unweigerlich. An multiplen Krisen, an ökologischen, aber auch ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen, an beispiellosen Gerechtigkeitsdefiziten der Postmoderne, hängt sich so der Fortschrittsglaube der Menschheit auf. Es wird eben nicht alles immer einfach nur besser.
»Alles wird gut« ist kein Naturgesetz, das machen Naturgesetze gerade deutlich.
Nun befinden wir Jungen uns in einer unbequemen Lage. Ein Großteil dieser Gesellschaft hat den Großteil ihres Lebens damit verbracht, aktiv oder passiv dazu beizutragen, dass wir im schnellen Schritt planetare Grenzen erreichen. Die Antwort auf die Frage »Was war, bevor wir hier waren?« lautet also: vor allem harte Arbeit, Versöhnung und einige Kriege, um den Westen zu verteidigen, und ein Ökologisch-über-die-Stränge-Schlagen, das sich Jahrzehnt für Jahrzehnt selbst übertrumpfte.
Und jetzt kommen wir und erklären, dass das nicht reicht. Wir entziehen uns nicht nur dem blinden Glauben an sich selbst optimierende Systeme, schlimmer noch, wir stellen die Systemfrage. Wir befinden den Status quo für inakzeptabel, denn er denkt unsere Zukünfte nicht mit, und die Gegenwarten von vielen anderen auch nicht, von Dutzenden Ausländern schon gar nicht.
Zurück zu den Fischen im Meer. Klassischerweise würde man von jungen Fischen erwarten, dass sie aufmerksam dem alten zuhören, dass sie sich umgucken, sich fragen, was vor ihnen war und was nach ihnen kommt, und feststellen, dass es kein Nichts gibt, und hurra, es werde Wasser. Aber in diesem Moment sind wir jungen Menschen schon einen Schritt weiter. Wir stellen nicht nur fest, dass es Wasser gibt. Wir gucken uns um, wir fühlen, wir hören auch denen zu, die man so lange ignoriert hat, und wir stellen fest, dass wir in einem versauten Ozean schwimmen, dass Plastik kein Freund ist und unsere Art akut vom Aussterben bedroht ist. Wir wagen eine radikale Zustandsbeschreibung. Und wir gehen den nächsten Schritt: Wir hinterfragen, warum das so ist – und vor allem, warum es so bleiben sollte. Und noch einen Schritt weiter: Wir hinterfragen, was unsere Rolle dabei ist, welche Rolle wir einnehmen können, wenn es darum geht, den Status quo zu verändern, wenn es darum geht, Krisenrealitäten zu bewältigen. Und es stellt sich heraus, dass alle Teil des Problems sind, solange sie sich nicht aktiv dafür entscheiden, Teil der Lösung zu werden. Und: Niemand ist ersetzbar. Das sagt sich sehr leicht, ist aber härter, als es klingt. Die Beharrungskräfte sind gigantisch.
Seit etwa zwei Jahren verbringe ich jeden Tag in der Woche mit dem Ende der Klimakrise. Und ich habe, wenig überraschend, einiges gelernt, unter anderem, den Status quo infrage zu stellen, die ökologischen Krisen als nicht mehr aushaltbar zu beschreiben, Klimagerechtigkeit einzufordern, Normalität als Krise zu bezeichnen. All das stellt eine Gegenwart infrage, die von vielen, auch noch lebenden Generationen, lange als Idealzustand (plus/minus) gewertet wurde.
Oder anders: Ein bedeutsamer Teil der Gesellschaft hat seine Hauptaufgabe darin gefunden, die Gegenwart so weit zu verklären, bis sie in die Geschichte passt, die man sich selbst gerne erzählen möchte, über die Leistungen, die man erbracht hat, den Beitrag, den man geleistet hat, für einen starken Markt und ein Land, das so reich und wohlständig ist.
In dieser Rechnung haben ausschließlich jene ein Beschwerderecht, die den Laden mit aufgebaut haben. »Leiste erst mal etwas in deinem Leben, bevor du dich beschwerst«, ungeschlagen in den Top Ten meiner Twitter-Kommentare. Und jetzt kommen wir und erklären, dass es so nicht weitergehen kann.
Das reicht aber noch nicht, und das ist eine andere Sache, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe.
Das große Problem liegt nicht darin, dass es nicht genug Leute gäbe, die bereit wären, eine Krisenrealität zu beenden. Das große Problem liegt auch nicht darin, dass es nicht genug Mittel gäbe, um eine sozialökologische Transformation einzuleiten. Das Problem ist auch nicht die Demokratie, denn die ist deutlich widerstandsfähiger, als manche zu hoffen wagen.
Nein, das Problem sind die Mauern in den Köpfen der Menschen. Wir können es uns kaum mehr vorstellen, wie es wäre, ungefährdet in sauberem Wasser zu schwimmen. Und noch weniger wollen wir uns vorstellen, dass es auf uns persönlich ankommen könnte.
Wir können sie uns kaum vorstellen, die klimagerechte Welt, die friedliche Welt, die sichere Welt. Und wir können uns auch nicht recht vorstellen, wie wir dahin gelangen sollen. Wir erleben eine Imaginationskrise, eine Krise der Vorstellungskraft, und sie kommt zum denkbar unglücklichsten Zeitpunkt, in einer Zeit, in der wir so dringend kognitive Kräfte mobilisieren sollten.
Wieso fragt man dich, was »du denn werden willst«, und nicht, »in welcher Gesellschaft du einmal leben willst«? In Zeiten, in denen die Überzeugung herrscht, man habe den Optimalzustand erreicht und etwaige negative Externalitäten seien notwendiger Teil der Rechnung und müssten toleriert werden, selbst wenn sie brüllen und toben und die Wände zum Wackeln bringen, in diesen Zeiten reicht es nicht, auf bessere Zeiten zu warten.
Es braucht ein neues Bewusstsein, damit wir uns davon nicht ablenken, einnehmen, abschrecken lassen. Und es braucht uns, die wir uns immer wieder fragen, in was für einer Welt wir leben wollen, was wir dafür brauchen und wie wir dahin kommen. Fragt euch nicht, was ihr werden wollt, sondern welcher Form von Wirtschaftssystem ihr eure Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollt und wofür.
Besiegt die utopische Verödung! Lasst uns Utopien träumen und Visionen spinnen. In einer Gesellschaft, die weitgehend davon überzeugt ist, dass man im Großen und Ganzen den richtigen Pfad eingeschlagen hat, selbst wenn der Wegweiser neonleuchtend auf »Abgrund« zeigt, wird uns niemand retten – außer wir selbst.
Es reicht nicht zu erklären, dass es so nicht weitergehen kann, wenn wir selbst schon keine Vorstellung davon haben, wie es stattdessen weitergehen kann. Wie sollen wir andere überzeugen, jenseits leerer Versprechen und begrünter Slogans den ersten Schritt zu gehen?
Geht weiter, als man euch den Weg zeigt, denkt weiter, als euch das 20. Jahrhundert lehrt. Und dann, in dem Augenblick, in dem wir Jungen uns zusammen mit den Älteren befreit haben von den Verklärungen der gestrigen Gesellschaft, in dem Augenblick, in dem wir uns anfreunden mit der Radikalität der Situation, der Welt, der anhaltenden Zerstörung, der andauernden Ignoranz, in dem Augenblick machen wir einen essenziellen Schritt: Wir befreien uns von der Last der Verleugnung. Wir stellen fest, wie anstrengend es ist, das wahre Ausmaß der ökologischen Zerstörung ununterbrochen auszublenden.
Es ist anstrengend, diese Welt, diese um 1,2 Grad erwärmte Welt, für lebensfähig zu deklarieren, während es brennt, schmilzt und flutet, während Arten aussterben und Lebensgrundlagen schwinden. Freiheit heißt auch, sich frei zu machen von den Mythen des letzten Jahrhunderts. Und die Krisen für das zu nehmen, was sie sind: existenziell. Die größte Bedrohung unserer Möglichkeiten, unserer Freiheiten, unserer Sicherheit, unserer Zukunft.
Was danach kommt? Alles. Wir haben schließlich nichts zu verlieren außer unserer Zukunft und die unserer Kinder und Enkel. Und zu gewinnen? So vieles. Vor allem das Wissen, dabei gewesen zu sein, als wir anfingen, uns selbst zu retten. Als wir anfingen, uns in die Augen zu gucken und uns ganz ehrlich zu fragen, welche Rolle wir in diesen großen Krisen übernehmen. Nichts sollte uns aufhalten können, die Zukunft zu erdenken und zu gestalten, in der wir gerne leben wollen. Wir sind die Generation Klimakatastrophe, aber wir müssen es nicht bleiben. Niemand ist ersetzbar. Und eines Tages werden wir in die Ferne gucken, werden den Wind und die Wellen rauschen hören, wir werden den Horizont sehen und das weite Blau. Und wir werden an die Fische denken und an damals, als wir nicht weggeguckt haben, als wir so dringend gebraucht wurden.
Luisa Neubauer (*1996) studiert Geografie und Ressourcen-Management in Göttingen. Sie ist Klimagerechtigkeitsaktivistin bei Fridays for Future und organisiert die Streiks in Deutschland mit. Sie setzt sich für Generationengerechtigkeit und gegen weltweite Armut ein. www.luisaneubauer.com