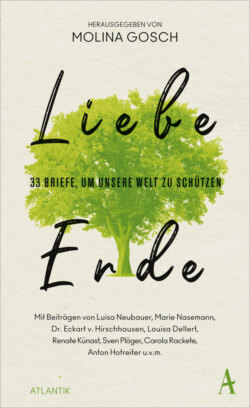Читать книгу Liebe Erde - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Quang Paasch
ОглавлениеIch wollte nie Klimaaktivist werden – dennoch sitze ich jetzt hier und schreibe einen Brief an die Erde oder besser gesagt an die Gesellschaft. Wie komme ich zu dieser Gelegenheit bzw. woher komme ich? Diese Frage wird mir oft gestellt. Eine Antwort könnte sein: nicht aus der Klima- und Umweltbewegung – ich bin da eher zufällig reingestolpert. Dennoch bin ich jetzt einer der Pressesprecher*innen von Fridays for Future. Außerdem bin ich geborener Berliner, Jahrgang 2001, Arbeiter*innenkind und habe den sogenannten Migrationshintergrund. Seit ich denken kann, erfahre ich Diskriminierungen aufgrund meines Nichtweißseins. Rassismus ist eine Facette meiner eigenen Lebensrealität, die mich früh politisierte. Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima waren keine Themen, die mich als Kind interessiert oder geprägt haben. Konkreten Handlungsbedarf sah ich in der Problematik der sozialen Gerechtigkeit. Als jungem Menschen, der mit dem Internet aufgewachsen ist, entgingen mir nicht die täglichen Meldungen von neuen globalen Krisen und Missständen. Wie konnte ich da also still bleiben und nichts tun? Schließlich bin ich zu einem aufgeklärten Demokraten erzogen worden – so zumindest der Anspruch der Kultusminister*innen an die Schulen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Politische Partizipation und soziales Engagement sind für viele Schüler*innen nicht selbstverständlich. Es ist ein Privileg, Zugang zu Wissen zu haben und sich dann auch noch für ein Thema einsetzen zu können. Wenn es keine Sensibilisierung und Aufklärung gibt, wird auch kein Bewusstsein geschaffen, das zum Handeln führen könnte. Obwohl die Wissenschaft seit 40 Jahren vor den Folgen der globalen Erwärmung warnt, ist die Aufklärung über die Klimakrise kein zentraler Bestandteil der Schul-Curricula geworden. Dementsprechend waren Klima- und Umweltaktivist*innen für mich eine Nischenerscheinung und nichts weiter als »die Ökos«.
Der Wendepunkt kam erst nach meinem Abitur im Jahr 2018. Als ich von der damals 15-jährigen Greta Thunberg hörte, die für dieses mir fremde Thema vor dem Parlament streikte, wurde ich erst so richtig aufmerksam. Typisch für die Generation Z habe ich meine Recherche zum Klimawandel im Internet begonnen. Ich realisierte nun die Dringlichkeit der Klimakrise. Greta Thunberg hat mich mehr aufgeklärt und mobilisiert als irgendeine Lehrkraft zuvor. Der Klimawandel war plötzlich doch nicht so weit weg. Zuerst war ich wütend und traurig über das Nichthandeln der Menschen, aber ich verspürte auch Zuversicht und Tatendrang. Ich hoffte, mit dem Aufruf zum ersten Klimastreik in Berlin am 14. Dezember 2018 etwas ändern zu können. Nach einigen euphorischen, aber wohl auch naiven Wochen stellte ich jedoch fest, dass ein paar Klimastreiks allein nichts bringen – außer Lob und Kritik aus allen Ecken der Gesellschaft. Die Vorstellung, die Welt mit unseren Protestaktionen retten zu können, hatten sicher viele von uns jungen Menschen und angehenden Klimaaktivist*innen.
Fridays for Future hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre professionalisiert und zu einer ernstzunehmenden Klimabewegung etabliert. Dabei haben wir das Rad nicht neu erfunden. Schon seit Langem haben engagierte Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Betroffene versucht, uns auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam zu machen – doch richtig gehört wurden sie nie. Es brauchte anscheinend Kinder und Jugendliche, um den Diskurs in die sogenannte Mitte der Gesellschaft zu bringen. Wie absurd ist es, dass erst die Provokation junger Menschen, freitags die Bildung zu verweigern, zum Umdenken geführt hat? Wer immer noch nicht verstanden hat, dass Fridays for Future sich nicht in der Rolle der Expert*innen sieht, hat unsere gelebte Demokratie nicht verstanden. Wir verstehen uns als Sprachrohr der Wissenschaft, aber auch als Klimagerechtigkeitsbewegung. Klimaschutz geht nämlich nur zusammen mit der sozialen Gerechtigkeit – in Deutschland, in Europa, weltweit.
Unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem basiert auf der Ausbeutung prekär lebender Menschen und auf der Diskriminierung marginalisierter Gruppen. Deswegen sitzen wir in der Klimakrise auch nicht alle in einem Boot. Die Lebensumstände, verfügbaren Ressourcen und sozialen Hintergründe der Menschen sorgen dafür, dass nicht alle gleichermaßen betroffen sein können. Der globale Norden profitiert von der Ausbeutung anderer Länder. Die Ressourcen und die CO2-Emissionen sind global ungleich verteilt. Dieser historischen Verantwortung, eine Folge von Kolonialismus und Industrialisierung, müssen wir uns bewusst werden. Wenn Menschen im globalen Süden die Umwelt zerstören, dann tun sie das, weil sie finanziell abhängig vom globalen Norden sind. Die Plantagen und Fabriken dort produzieren die Waren für Lebensstil und Luxus von uns Europäer*innen. Wir beuten somit nicht nur Natur und Umwelt, sondern auch Menschen aus. Hinzu kommt, dass wir vermutlich die nötigen Ressourcen haben werden, um zum Beispiel schwimmende Städte zu errichten – die Länder des globalen Südens leiden aber schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels und werden sich auch in Zukunft nicht allein retten können.
Um all diesen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken, brauchen wir eine grenzen- und gesellschaftsübergreifende Solidarität und Aufklärung. Wir müssen uns vom rein individualistischen Denken lösen und das Kollektiv ins Zentrum stellen. Die Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr tragbar. Unser globales Handeln muss an ein kollektives Wirgefühl geknüpft werden. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Kolonialgeschichte aufarbeiten und diskriminierende Denkmuster reflektieren. Lasst uns den Diskurs über Macht- und Ressourcenverteilung beginnen und die Gerechtigkeitsfrage stellen – nur so schaffen wir es, radikale Veränderungen demokratisch zu vollziehen. Es geht nicht darum, den »Schwachen« zu helfen, sondern die Bedingungen dafür zu schaffen, dass keine*r in dieser Welt benachteiligt wird. Dieses Wirgefühl darf aber nicht zu der Illusion führen, wir hätten Gleichheit erreicht. In unserem historisch gewachsenen kulturellökonomischen System kann es keine vollständige Gleichberechtigung geben.
Ebenso brauchen wir eine sozialökonomische Transformation hin zu einer nachhaltigen und gerechten Welt. Ein rein gesellschaftlicher Wandel wird nicht ausreichen. Weder rettet uns das Umdenken einzelner Bürger*innen, noch wird der Markt es schon von selbst regeln. Klima- und Umweltaktivist*innen haben endlich die Diskursverschiebung und den Kulturwandel angestoßen. Jetzt brauchen wir auch konsequente Maßnahmen der Entscheidungsträger*innen. Die Verantwortung kann nicht bei einzelnen Menschen liegen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen Hand in Hand agieren, um die Klimakrise gemeinsam anzugehen.
Wir sollten uns davor hüten, einer Spirale der Hoffnungslosigkeit zu verfallen – ja, die Klimakrise ist eine große und komplexe Herausforderung. Die Faktenlage wirkt erdrückend, die Zeit drängt und die Frage der sozialen Gerechtigkeit scheint das Ganze noch zu erschweren. Doch der lange Atem von Fridays for Future zeigt uns vor allem eins: Veränderung ist möglich. Wir gehen weiterhin auf die Straße, weil wir die Hoffnung in unsere Demokratie nicht aufgeben. Genau jetzt haben wir noch die Zeit, das Ruder herumzureißen und auf allen Ebenen etwas zu verändern. Business as usual kann nicht mehr unser Lebens- und Handlungsmotto sein. Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels bedeutet nämlich nicht, dass die Welt gerettet ist – es sind immer noch 1,5 Grad zu viel –, aber wir verhindern irreversible Schäden an Mensch und Natur, die eine stärkere globale Erwärmung mit sich bringen würden.
Keine*r von uns ist perfekt – eine absolut diskriminierungsfreie, gerechte und nachhaltige Lebensweise kann und wird es in unserem jetzigen System nicht geben. Vielleicht aber brauchen wir diese Utopie einer Gesellschaft, um die Klimakrise auf struktureller und systemischer Ebene schnell und effektiv anzugehen. Dafür sollten wir aufstehen und kämpfen. Lassen wir das reine Individualverhalten hinter uns und zeigen wir uns solidarisch mit marginalisierten Gemeinschaften. Reflektieren wir unsere Privilegien. Bringen wir den Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit zusammen und vergessen wir dabei nicht, auf unsere zeitlichen und mentalen Kapazitäten zu achten. Keine*r soll auf dem Weg dahin ausbrennen oder ausgeschlossen werden. Lasst uns gemeinsam dazulernen, Mitmenschen aufklären, den Druck erhöhen und nach einer solidarischen, gerechten und nachhaltigen Welt streben.
Quang Paasch (*2001) ist Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland und Berlin und seit dem allerersten Klimastreik dabei. Er studiert Sonderpädagogik und Politikwissenschaften an der FU Berlin.