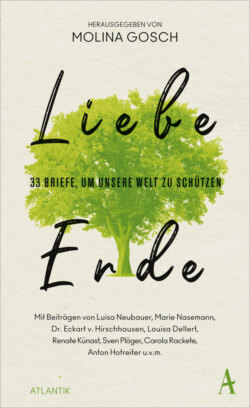Читать книгу Liebe Erde - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dr. Eckart v. Hirschhausen
ОглавлениеLiebe Mitmenschen oder liebe Erdenbewohner,
ich glaube, dass jede Generation ihr Aha-Erlebnis hat, ein Ereignis, das sie die Welt mit anderen Augen sehen lässt. Für mich war das der Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986. Ich war damals 19, hatte gerade mit dem Medizinstudium angefangen und trampte von Berlin nach München. Zuerst stand ich an der Autobahn und wusste nicht, wo ich hinfahren sollte. Diese radioaktive Wolke konnte ja überall hin. Im Radio wurde berichtet, wo sie sich gerade ausbreitet und in welche Richtung sie wahrscheinlich weiterzieht. Das Gefühl von absoluter Hilflosigkeit, von Ohnmacht, weil wir uns auf keinem Weg der Strahlung entziehen können, hat sich eingebrannt. Und hat meine Generation politisiert. Ich war in Wackersdorf am Zaun und in der Nähe von Gorleben im Zelt, um mit Freunden aus der Varieté-Welt mit fröhlichem Quatsch gegen den Irrsinn anzulachen.
Und dann versandete diese »Erweckung« bei mir und vielen anderen wieder, andere Dinge wurden wichtiger, alltagsrelevanter – bis 2018.
In Deutschland wurden in diesem Jahr an vielen Orten Temperaturen um die 40 Grad erreicht. Und wieder hatte ich dieses fiese Gefühl, nirgendwohin fliehen zu können. Diesmal sind es Sonnenstrahlen, aber wieder ist es die blanke Physik, die uns in unserer Physis bedroht. Und wieder ist das Problem menschengemacht. Der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber hat sein Vermächtnisbuch über die Erderwärmung »Selbstverbrennung« genannt. So fühlt es sich an: Wir legen uns selber auf den Grill. Und freuen uns noch darüber, dass wir uns den Flug nach Malle sparen können, wenn es bei uns auch so heiß ist.
2018 war für mich das Jahr, in dem ich am eigenen Leib erlebte, wie bedrückend Hitze ist, wenn sie bleibt. Wenn sie stehen bleibt, weil kein Lüftchen am Boden und kein Jetstream in der Höhe das Wetter ändert. In jenem Rekordsommer gab es so gut wie kein Entkommen. Dieses Gefühl der Unausweichlichkeit empfinde ich körperlich und psychisch als bedrohlich. Ich wundere mich, wie meine Generation, die mit Antiatomkraft, Waldsterben und Friedensbewegung aufgewachsen ist, derart dabei versagen konnte, das Wissen um die Grenzen des Wachstums in Politik und eigenes Handeln umzusetzen.
2018 hatte ich zudem eine persönliche Begegnung mit Jane Goodall, die mich sehr prägte. Die berühmte Schimpansenforscherin und Umweltaktivistin fragte mich ganz direkt: »Wenn der Mensch die intelligenteste Art auf dem Planeten ist, warum zerstört er dann sein einziges Zuhause?«
Ich musste dreimal schlucken. Denn die Antwort ist nicht leicht.
Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler*innen auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen und die globale Erwärmung vorhergesagt, aber sie wurden von der Politik und der Gesellschaft weitgehend ignoriert. Die Wissenschaft ist einfach nicht durchgedrungen. Studien um Studien, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen sind folgenlos in Schubladen und auf Festplatten vergammelt. Eines meiner Lieblingsplakate von Fridays for Future fragt: »Why get an education when nobody listens to the educated?« Was nutzt einem Bildung, wenn keiner auf die Gebildeten hört?
Es gibt ein Foto, das ich gerne auf Vorträgen zeige. Darauf sieht man einen brennenden kalifornischen Wald, davor spielen Menschen Golf. Das Bild beschreibt unsere Idiotie recht genau. Wir sind das einzige Wesen der Natur, das in die Zukunft schauen kann und ein Konzept von Endlichkeit hat – und verhalten uns dennoch erschreckend kurzsichtig. Wie laut müssen Menschen werden, um eine stille und schleichende Katastrophe wie die Klimakrise in die Mitte der Gesellschaft zu holen?
Wenn es eine ärztliche Pflicht ist, Leben zu schützen, auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und gegebenenfalls auch schlechte Nachrichten zu überbringen, frage ich mich: Wo sind die Gesundheitsberufe beim Thema Klimakrise? Ich habe Medizin studieren dürfen. Ich wurde auch in Notfallmedizin ausgebildet. Aber kurioserweise hat mir in diesen sechs Jahren keiner etwas über den größten Notfall der Menschheit erzählt, nämlich dass wir dabei sind, uns selber abzuschaffen. Allergien nehmen zu. Infektionskrankheiten aus den Tropen können sich über Mücken in Europa verbreiten. Die meisten Pflegeheime und viele Krankenhäuser haben keine Klimaanlagen, und wenn die Sonne die Innenräume aufheizt, kann im wahrsten Sinne keiner einen kühlen Kopf bewahren, um für andere da zu sein. Und, und, und. Auf viele dieser Konsequenzen sind wir im Gesundheitswesen kaum vorbereitet.
Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die Gesundheit im 21. Jahrhundert. Das ist nicht meine private Meinung, sondern Konsens in der internationalen Fachwelt – von der Initiative »Lancet Climate Countdown« über den Weltärztebund bis zur Europäischen Akademie der Wissenschaft. Doch viele Menschen, vermutlich auch in Deutschland, haben die Dimension, in der unsere Existenz bedroht ist, noch nicht begriffen. Schließlich sind ja erst mal andere Länder betroffen. Mit bald zehn Milliarden Erdenbewohnern und einer Überhitzung, die für geschätzte 400 Millionen Menschen in weiten Teilen Afrikas zur Fluchtursache werden wird, müssen wir anders denken, handeln und mitfühlen.
Der Umgang mit den Herausforderungen von Klimawandel und Nachhaltigkeit kann als die große »moralische Revolution« des 21. Jahrhunderts verstanden werden – bei der wir leider kollektiv erst am Anfang des Prozesses stehen. Dabei bleiben uns nur noch wenige Jahre, um etwa in der Energieversorgung die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle komplett hinter uns zu lassen. Momentan verheizen wir jeden Tag die Energie, die Mutter Erde in über 1000 Jahren gespeichert hat. Es bedarf einer internationalen Vereinbarung, die Vorräte von Kohle, Öl und Gas, die noch in der Erde schlummern, dort zu belassen. Nur dann haben wir überhaupt eine Chance, das »Hothouse Earth« zu vermeiden, die komplette Überhitzung inklusive der überschrittenen Kipppunkte. Wenn wir wüssten, was wir wirklich brauchen, würden wir dann weniger verbrauchen?
Dabei hat zum Beispiel die Generation meiner Eltern schon nachhaltig gelebt, bevor es dieses Wort überhaupt gab. Auch, weil es weniger gab. Meine Eltern sind als Flüchtlingskinder aus dem Baltikum in ein kleines Dorf in Baden-Württemberg gekommen. Sie hatten wenig; deshalb haben sie versucht, dieses wenige wiederzuverwenden. Mein Vater lief barfuß zur Schule, um die Schuhe zu schonen. Das Essen wurde oft aus Resten gekocht, um nichts wegzuwerfen. Schulhefte wurden mit Bleistift beschrieben, damit man alles ausradieren und die Seiten ein weiteres Mal vollschreiben konnte. Als ich auf die Welt kam, hat ein Nachbar meine Mutter ins Krankenhaus gefahren. Meine Eltern hatten kein Auto. Das war kein bewusster Konsumverzicht, sie konnten es sich einfach nicht leisten. Aber es ging auch ohne. Das Wort »Upcycling« gab es nicht, aber es war klar, dass man nichts wegschmeißt, was noch brauchbar ist. Auch kein Essen.
Heute gibt es »nachhaltige« Turnschuhe, und die Hersteller rühmen sich, dass unter den unzähligen Paaren, die sie ständig in neuen Formen und Farben rausknallen, auch ein paar sind, die aus recyceltem Plastik bestehen. Dabei wird etwas sehr Offensichtliches übersehen: Das nachhaltigste Paar Turnschuhe, das es gibt, ist das, das es schon gibt. Weil du es schon hast! Mein Vater hat noch sein Originalpaar Adidas Rekord, hellblau mit weißen Streifen – wahrscheinlich wäre es bei eBay mehr wert als in seinem Schrank. Er war kein großer Sportler, hätte aber auch nicht eingesehen, ein neues Paar zu kaufen, wenn es das alte noch tut.
Und meine Eltern hatten nie das Gefühl, nicht auf den Malediven gewesen zu sein, etwas verpasst zu haben. Auch auf Mallorca war mein Vater nie. Er ist wahrscheinlich der nachhaltigste Mensch in unserer Familie. Seine Lebens-CO2-Bilanz in über 85 Jahren ist niedriger als die seiner Enkel mit 18.
Die Erfahrung, dass alles Materielle plötzlich weg ist, dass man froh ist, das nackte Überleben gesichert zu haben, hat auch meine Generation noch geprägt. Meine Geschwister und ich haben eine gemeinsame Skepsis gegenüber Statussymbolen. Das erste Auto unserer Familie war ein gebrauchter orangefarbener Passat, der nicht mal ein Radio hatte, was dazu führte, dass unser Entertainment aus der Mundorgel bestand. Deswegen kann ich bis heute viele Volkslieder auswendig.
Warum ich das erzähle? Die Erde hat Fieber, und das Fieber steigt, unser Planet steuert auf ein Multiorganversagen zu. Eine harte Diagnose. Je mehr ich mich über den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit informiere, desto ungeduldiger werde ich. Mit meinen Sorgen bin ich aber nicht allein. Die machen sich viele Wissenschaftler und verantwortliche Menschen schon lange. Wir müssen die Welt neu erfinden. Und uns gleichzeitig erinnern.
»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!« Stimmt. Aber hilft uns eine Polarisierung in »ihr« und »wir« weiter?
Ja, meine Generation, die ins Wirtschaftswunder hineingeboren wurde, hat über die Verhältnisse konsumiert, Ressourcen verbraucht und das lange für selbstverständlich gehalten. Wir sind so reich wie keine Generation vor uns. Und so bedroht. Aber die Generation der Großeltern weiß noch eine Menge von dem, was wir heute wiederentdecken können: selber kochen, Reste verwerten, auf Gemeinschaftserlebnisse als Glücksbringer setzen und mal ein Buch lesen – mit sehr geringem Energieverbrauch, aber großen Möglichkeiten, zwischen den Seiten in ferne Welten zu reisen. Fahrrad fahren, Fleisch am Sonntag, Urlaub im Schwarzwald. Doch bevor zu viel schiefe Spießernostalgie entsteht: Nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. Aber was habe ich bei einem Shopping-Wochenende in New York wirklich über die Welt gelernt?
Fridays for Future hat das Thema Klimakrise auf eine geniale Art und Weise vorangebracht. So dringt endlich dieses Wissen in die Mitte der Gesellschaft, schreckt auf, schreckt ab und mobilisiert im besten Fall unsere besten Seiten. Als Politiker nach den »Profis« verlangten, haben 28000 Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschrieben, um als »Scientists for Future« in der Bundespressekonferenz zu erklären: Das Anliegen der jungen Menschen ist vollkommen berechtigt. So etwas hatte es noch nie gegeben. Diesen Aufbruchsgeist gilt es jetzt aufrechtzuerhalten. Denn die Beharrungskräfte und Lobbyinteressen sind enorm. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um überhaupt etwas zu drehen. Drängen wir auf die politische Willensbildung, denn diese ist momentan langsamer als das Bewusstsein in der Gesellschaft.
Die humorvolle Beschäftigung mit dem Gesundheitswesen ist bisher meine Lebensmaxime gewesen. Jetzt ist es die Bewahrung der Schöpfung, die Idee, mit Fridays for Future, Scientists for Future und Health for Future dafür zu sorgen, dass es noch weitere Generationen geben wird, die diesen Planeten so schön vorfinden, wie wir das getan haben. Jene, die derzeit auf der Straße sind, sind klug und engagiert. Wenn sie erleben, dass nichts passiert, obwohl sie so viele sind, dann geht einer ganzen Generation der Glaube an die Demokratie flöten. Wie also kommen wir vom Wissen zum Tun, von der lähmenden Hoffnungslosigkeit zu strategischem Handeln?
Das Klimaabkommen von Paris ist zumindest ein Anfang. Auf das Auto zu verzichten ist unter Großstädtern heute wieder angesagt. Aber es reicht nicht, wenn einige ihren Lebensstil ändern. Politische Schritte sind dringend notwendig. Es braucht eine Abgabe auf Kohlendioxidemissionen. Die Luft zu verdrecken darf nicht umsonst sein. Wir brauchen ein Tempolimit auf der Autobahn. Da brauche ich als Arzt keine zweite Meinung. Mit einem Tempolimit hätten wir weniger Tote und Verletzte, weniger Abgase in den Lungen und weniger Stress. Unsere menschliche Gesundheit, die Gesundheit der Umwelt und des Planeten sind viel enger miteinander verknüpft, als wir uns das lange klargemacht haben.
Humor kann helfen. Mit Humor kann man Widersprüche reflektieren. Ein Beispiel aus meinem Bühnenprogramm: Stellen Sie sich vor, es gibt an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch, das Sie kaufen, ab sofort einen Eimer mit 20 Liter Gülle verpflichtend dazu. Den müssen Sie mit nach Hause nehmen. Und die Kassiererin sagt: »Das haben Sie mitverursacht. Ach, das wussten Sie nicht? Jetzt wissen Sie es. Wollen Sie einen Deckel, oder geht das so? Viel Spaß beim Grillen!«
Wenn ich das sage, lacht das Publikum und versteht: Ja, Fleisch zu essen hat einen enormen versteckten Preis, der uns am Kühlregal nicht gezeigt wird. Ich bin dafür, bei Lebensmitteln einen CO2-Abdruck kenntlich zu machen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Rindfleischsuppe zehnmal so viele Treibhausgase erzeugt wie eine Gemüsesuppe. Der Verbraucher fragt sich dann hoffentlich: Schmeckt mir die Rindfleischsuppe denn wirklich zehnmal so gut? Nö.
Aber was geschieht stattdessen? Eine Abwehrdiskussion wird losgetreten: Die Ökospinner wollen uns das Fleischessen, das Fliegen oder das Autofahren verbieten. Dabei geht es tatsächlich nicht ohne staatliche Vorgaben. Ein Einzelner kann nicht dafür sorgen, dass Fliegen teurer wird als Bahnfahren. Das wäre keine »Diktatur«, sondern ein Ehrlichmachen von Preisen.
Jeder weiß: Rad zu fahren ist sowieso gesünder, als gestresst mit dem Auto im Stau zu stehen. Für einen selbst wie für alle anderen. Ich atme lieber die Abgase von zehn Radfahrern ein als die von einem SUV. Was hat es mit »Verzicht« und »Ökodiktatur« zu tun, wenn wir Gesundheit und Gemeinwohl voranstellen? Welche Freiheiten wird ein Kind haben, das heute geboren wird, wenn es einmal 30, 50 oder 80 Jahre alt ist?
Als Arzt war mir schnell klar, warum die Idee von einem ständigen Wirtschaftswachstum im Kern krank ist. Sie ähnelt dem Krebs: Auch er wächst auf Kosten der Umgebung, bunkert alle Ressourcen für sich und tötet das Leben, das ihn nährt. So doof muss eine Zelle erst mal sein. Und bösartig. Es gibt im menschlichen Organismus nichts, was dauerhaft auf Wachstum angelegt ist. Selbst die meisten Parasiten und Krankheitserreger sind schlau genug, ihr Wachstum so zu dosieren, dass sie ihren Wirt nicht umbringen, sondern mit ihm weiterleben können. Aber wie können wir anders handeln?
Verhalten ändert sich, wenn sich der politische Rahmen ändert. »Bei sich anzufangen« hat 30 Jahre nicht funktioniert. Wie Michael Kopatz vom »Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie« sagt: »Schluss mit der Ökomoral«! Wir brauchen coole Gesetze, ehrliche Preise für Energie, ein Ende der Subventionen für eine zerstörerische Landwirtschaft und, und, und. All das kann ich nicht ändern, indem ich den Strohhalm und die Plastiktüte weglasse. In unserem Grundgesetz steht etwas von »körperlicher Unversehrtheit«, aber nichts von einem Recht auf »Auf Autobahnen so schnell fahren, wie ich will«. Was für ein absurder Freiheitsbegriff. Wie unfrei ist ein Leben in Hitze, mit neuen Infektionskrankheiten, mit mehr Allergien, Dürre, einem toten Wald und Hunger? Wir Ärzte können Fieber senken, aber keine Außentemperatur. Unser Körper hält auf Dauer maximal 41 Grad aus. Ende Gelände. Wir können Sauerstoff auf Intensivstationen nur in Flaschen abfüllen, wenn er vorher im Meer und im Wald gebildet wurde. Nichts von dem, was Gesundheit als Allererstes ausmacht, ist »hergestellt« – es ist von Mutter Natur geschenkt: saubere Luft, Wasser, etwas Essbares und erträgliche Temperaturen. Unser gesamter teurer Medizinapparat ist ohnmächtig, wenn wir planetare Grenzen und Kipppunkte überschreiten. Corona hat uns gezeigt, dass Wildtiere uns mit ihren Erregern lahmlegen, wenn wir ihnen keinen Platz zum Leben lassen.
Wenn Politik auf Virologen hören kann, warum nicht auch auf Klimawissenschaftler und Ärzte? Denn wie der wunderbare Physiker Harald Lesch immer wieder betont: »Physik ist nicht verhandelbar. Naturgesetze warten nicht auf demokratische Entscheidungen.«
In der Politik wird gerne davon gesprochen, dass etwas »alternativlos« sei. Das Einzige, was tatsächlich alternativlos ist, ist dieser Planet. Er ist der einzige Ort im ganzen bekannten Universum, wo wir leben können. Als vor 50 Jahren Menschen auf dem Mond landeten, sahen sie, wie schön es auf der Erde ist. Und wie dünn und fragil der Himmel ist – die Atmosphäre, die uns umgibt und am Leben hält.
Politik müsste also viel mutiger sein. Es gibt so viele Beispiele dafür, dass gute Gesetze große Wirkung zeigen. Als das Rauchen in Kneipen verboten wurde, gab es einen enormen Aufschrei. Doch heute sind alle froh darüber, sogar die Raucher. Und Herzinfarkte, Schlaganfälle und Asthma gingen spürbar zurück. Viele Länder haben Tempolimits eingeführt, und ihre Ökonomien sind nicht daran kaputtgegangen. Das Verbot von FCKW hat das Ozonloch schrumpfen lassen, durch die Entschwefelung von Benzin und Industrieabgasen ist das Waldsterben ausgeblieben.
Welche Erfolgsgeschichten erzählen wir weiter? Einer meiner liebsten TED-Vorträge ist der des Psychologen und Ökonomen Per Espen Stoknes, der wunderbar die kommunikativen Hürden aufzeigt und wie man sie überwindet: »How to transform apocalypse fatigue into action on global warming« heißt die empfehlenswerte Rede. Seitdem rede ich auch nicht mehr von »Umwelt«, sondern von Mitwelt. Ich habe ja zu Hause auch keinen Umbewohner. Es geht auch nicht darum, das »Klima zu retten« – sondern uns!
Jeder Deutsche hat einen ökologischen Fußabdruck, der weit über dem globalen Durchschnitt liegt. Aber was ist mit unserem ökologischen Handabdruck? Was können wir selber ändern, wo können wir politisch und gesellschaftlich aktiver werden? Worauf haben wir Einfluss, wer kennt wen, der jemanden kennt, der etwas ändern kann? Wir sind eins der reichsten Länder der Welt, wir sind eins der kreativsten, wir sind eine offene demokratische Gesellschaft, haben freie Meinungsäußerung, Presse- und Versammlungsfreiheit. Wir leben aktuell so satt und sicher wie noch nie in der Menschheitsgeschichte – und alle diese Fortschritte stehen heute auf dem Spiel. Deshalb tragen wir zugleich eine hohe Verantwortung, nicht nur weil wir historisch schon jede Menge Treibhausgase freigesetzt haben, sondern auch weil sich viele Länder fragen: Wie machen es denn die Deutschen? Und gute Ideen lassen sich schneller verbreiten als je zuvor.
Was man machen kann, ist zunächst einmal, miteinander zu reden, in jeder Familie, in jeder Kollegenschaft, in jeder Kirchengemeinde und in jedem Fußballverein, und eine Haltung zu finden. Ja, auch im Fußball, denn wie willst du bei 40 Grad noch rennen? In Spanien beginnen die Fußballspiele erst abends, weil es am Nachmittag viel zu heiß ist. Wenn die Sportschau verlegt werden muss, weil um 15.30 Uhr alle aus dem letzten Loch pfeifen und kein Anpfiff möglich war, dann wissen Millionen weitere Menschen in Deutschland: Die Klimakrise ist echt. Und sie ist hier. Nicht nur in Afrika und der Arktis.
Die eigene Gesundheit und die der Familie liegt den allermeisten näher als ein Eisbär oder ein Kind in Bangladesch. Warum nutzen wir nicht ein positives »Framing«, das verdeutlicht, dass weniger Stress, weniger Fleisch und weniger Auto uns sowieso guttun? In welcher Welt wollen wir leben? Und wie viel Spaß darf dabei sein? Klar sind die 17 Nachhaltigkeitsziele wichtig. Bin ich voll dafür. Aber geht es nicht auch ein bisschen einfacher: dass Leben etwas mit Freude zu tun hat – und mit Widersprüchen, die wir selber nicht völlig auflösen können? Die Ärzte gegen den Atomkrieg hatten ein sehr lustiges Plakat: »Eine Atombombe kann dir den ganzen Tag ruinieren.« Wir brauchen mehr Humor in der Kommunikation, damit wir uns über uns selber wundern können. Aus einem schlechten Gewissen heraus ändern wir uns weniger als aus der Einsicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder uns für ziemlich dämlich halten werden, wenn wir so weitermachen. Dabei machen sie es uns ja vor, wie man mit Witz demonstrieren kann: »Klima ist wie Bier – zu warm ist scheiße!«
Mein Wunsch für jetzt und die Zukunft: Wir brauchen ein Zusammenstehen für eine lebenswerte Zukunft über Generationen und Fachdisziplinen hinweg, keinen neuen Generationenkonflikt. Wir müssen den Fokus auf den Zugewinn an Lebensqualität richten statt auf die Diskussion, wem man welches seiner Lieblingsspielzeuge wegnimmt. Wir brauchen bei aller Ernsthaftigkeit und der Einsicht in die Beschränktheit der eigenen Mittel mehr Humor, Leichtigkeit und Optimismus, dass wir an dieser größten Gefahr der Menschheit immer noch wachsen und sie abwenden können. Ganz im Sinne von Karl Valentin: »Wenn es regnet, freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch!«
Der amerikanisch-afrikanische Historiker Kwame Anthony Appiah spricht mit Blick auf wichtige zivilisatorische Menschheitsumbrüche von »moralischen Revolutionen«. Und egal ob es um die Abschaffung der Sklaverei oder die Einführung des Frauenwahlrechts oder die weltweite Verbannung von atomaren Waffen geht, immer wieder tauchen in diesen Prozessen ähnliche Stadien auf. Zuerst findet jeder, dass alles bleiben muss, wie es ist. Dann fangen Einzelne an zu zweifeln, ob der Status quo wirklich so zwingend, gottgegeben oder »alternativlos« sein muss. Nach und nach bricht sich das neue Denken gegen heftigen Widerstand Bahn bis zu dem sehr spannenden Punkt, an dem man hinter einer kollektiven Erkenntnis nicht mehr zurückkann. Und alle sich im Rückblick fragen: Wie konnten wir das jemals für akzeptabel halten?
Ich wünsche mir sehr, dass Sie als Leser dieser Zeilen Mut schöpfen, noch deutlicher, öffentlicher und politischer die Zukunft zu gestalten. In diesem Sinne freue ich mich, Teil dieses Aufbruches zu sein, und wünsche uns allen viel Inspiration, Ausdauer und Mut!
Ihr Eckart
Dr. Eckart v. Hirschhausen (*1967) ist Arzt, Fernsehmoderator und Schriftsteller. Er setzt sich in vielfältiger Weise für Gesundheit und Klimaschutz ein, so ist er ein bekannter Vertreter der Scientists for Future und gründete jüngst die Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen. www.stiftung-gegm.de