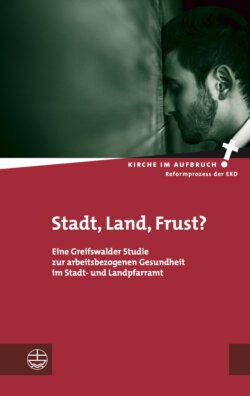Читать книгу Stadt, Land, Frust? - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Ländliche Räume in der praktisch-theologischen Forschung
ОглавлениеTrotz der noch einigermaßen übersichtlichen praktisch-theologischen Forschung zum Thema »Land« ist kein einheitlicher Begriff für ländliche Räume auszumachen. Einerseits sind Arbeiten zu nennen, die der bundesdeutschen Raumordnung folgen und die Heterogenität der ländlichen Räume betonen sowie besonders periphere, ländliche Räume betrachten.21 Andererseits sind Publikationen zu nennen, die in Kenntnis der Raumordnung eher einen traditionellen Landbegriff verwenden bzw. mit dem Landbegriff lediglich als Metapher arbeiten.22
Insgesamt überwiegen die Problemanzeigen für (periphere) ländliche Räume. Hier folgt die praktisch-theologische Forschung im Großen und Ganzen der Raumordnung, die in ländlich-peripheren Gebieten eher Problemgebiete sieht. Diese Problematisierung hängt natürlich mit der verwendeten Kategorisierung ab: dünne Besiedelung, Abgelegenheit und Strukturschwäche als Indikatoren ergeben keinen Fokus auf blühende Landschaften, die es auch gibt.23 Am umfassendsten und treffendsten wurden die Problemlagen von Alex/Schlegel beschrieben:24
– Soziologisch gesehen laufen in peripheren, ländlichen Räumen Prozesse verschärft ab: Demographischer Wandel führt zu Überalterung, Binnenmigration und Unterjüngung. Peripherisierung bezeichnet einen Prozess der umfassenden Schwächung und Abkopplung dieser Räume. Dies wird über großflächige Schrumpfung wahrgenommen. Auch die Kirche ist hier mit der Aufgabe des Rückbaus ihrer Strukturen konfrontiert, wobei »Kirchen in diesen Räumen in etwa 2–3 × so schnell schrumpfen wie die Bevölkerung an sich.«25
– In diesen Regionen ist die Kirche jedoch auch von außen gefordert: »Die Peripherisierung entlegener Gebiete appelliert an das gesellschaftliche, pädagogische und kulturelle Handeln der Kirche, vor allem aber an die gute Nachricht von der Auferstehung Jesu Christi.«26 In der Studie »Landaufwärts« konnte gezeigt werden, wie stark kirchliche Initiativen sind, die ihr missionarisches und diakonisches Potential entfalten.27 Hier konnte nachgewiesen werden, dass gegen alle Erwartungen gerade an der Peripherie Neues entsteht, das Bedeutung für die Zukunft der ganzen Kirche haben kann. Die in dem EKD-Papier aufgestellte These des simplen Rückgangs aller kirchlichen Angebote in besonders abgelegenen Räumen gilt damit als widerlegt.
– Insofern die kirchlichen Strukturen maßgeblich von der Anzahl der Kirchenmitglieder in einem Gebiet bestimmt werden, führen die Dynamiken in peripheren Lagen zur Überdehnung und Ausdünnung der kirchlichen Strukturen.28 Einfach gefragt: Wenn der Rückgang der Kirchenmitglieder weiterhin anhält, für wie viele Predigtstätten, Kirchen und Friedhöfe kann ein Pfarrer manchmal mit und manchmal ohne weitere Verwaltungskraft zuständig sein? Nur weil die Kirchenmitgliederzahlen rückläufig sind, verschwinden ja weder Kirchengebäude, noch wird die Fläche kleiner, auf der die Kirchenmitglieder leben.
– Insofern Dorfkirchen selten aufgegeben werden, verschlechtert sich das Verhältnis der Gemeindegliederzahl zu den Kirchengebäuden rapide. Damit wird die Finanzierung und Erhaltung der teilweise immer seltener genutzten Gebäude erschwert.29
– Im Bereich des Ehrenamts kommt es zu Engpässen, Konkurrenz und möglicher Überlastung bei den Ehrenamtlichen.30
– Im Bereich der hauptamtlichen Mitarbeiterschaft – insbesondere unter Pfarrern, die im Zweifelsfalle ohne weitere Mitarbeiter auskommen müssen – wird aufgrund der zusätzlichen Belastung durch den strukturellen Umbau und der notwendigen Neuausrichtung der Arbeit ein erhöhtes, arbeitsbedingtes Stresslevel befürchtet.31 Diese Befürchtung wird durch Forschungsergebnisse aus den ländlichen Regionen der Anglikanischen Kirche in England genährt.32
– Insgesamt ist Kirche herausgefordert, sich neu auf diese Situationen einzustellen und neue Normen für Wertschätzungen dessen, was möglich und geboten ist, zu entwickeln.33
Der Ablauf und die Auswirkung derartiger komplexer und gleichzeitig laufender Prozesse wurden jüngst von Meyer/Miggelbrink vom Leibniz-Institut für Länderkunde im Kirchenkreis Altenburg untersucht.34 Es wurden die im Jahr 2000 angestoßenen Strukturreformen nachvollzogen, die auch eine Änderung bzw. Anpassung des Finanzgesetzes mit sich brachten. Ein wesentlicher Faktor für die Strukturplanungen ist die Abnahme der Gemeindegliederzahlen, die zwischen 2008 und 2011 um 26 % zurückgingen. Die Pfarrstellen wurden von 58 (1993) auf 17 (2013) reduziert.35 Für das Pfarramt bedeutet dies Folgendes:
»Es erscheint logisch, dass bei einer wachsenden Anzahl zu betreuender Kirchengemeinden je Pfarrstelle die für diese Handlungen zur Verfügung stehende Zeit nicht automatisch steigt. Vielmehr sinkt faktisch die Zeit für Handlungen jenseits der zentral gesehenen sonntäglichen Gottesdienste durch vermehrte Fahrzeiten und -wege sowie stärker werdende Absprachen.«36
Besonders für das Gemeindepfarramt zeigt sich hier eine Abhängigkeit von der Umgebung, da Strukturreformen sofort eine Änderung des »Arbeitsplatzes« bedeuten. Die immer größere Ausdehnung der Gebiete, für die man verantwortlich ist, kann nicht spurlos an den Haupt- und Ehrenamtlichen vorübergehen. Meyer/Miggelbrink stellen zu diesen Entwicklungen die Frage, was sich als Erstes ereignen werde: »Pfarrer_innen- oder Gemeinde-Burnout?«37 Insofern diese Prozesse nicht ohne Konflikte verlaufen und manche institutionellen Vorgaben in der Kommunikation schwer transparent zu machen sind, beobachten Meyer/Miggelbrink:
»Wir haben diesbezüglich eine starke Ohnmacht festgestellt, sowohl bei Hauptwie Ehrenamtlichen. Insbesondere der Umstand, dass gesamtgesellschaftliche Prozesse – Schrumpfung und Säkularisierung – mit einer durch die EKD und die EKM getragenen kalkulatorischen Logik zusammentreffen, erzeugt bei ›Planenden‹ und ›Beplanten‹ im Kirchenkreis das allseitige Gefühl, selbst nicht in einer gestaltenden Position zu sein: Hauptamtliche müssen Träger_innen von Einsparungen sein, sind jedoch auch deren Auswirkungen sowie den Vorwürfen Ehrenamtlicher ausgesetzt. Ehrenamtliche wiederum würden gerne intervenieren, sehen sich aber einerseits einer wachsenden Intransparenz ausgesetzt, die sie andererseits aufgrund der Komplexität und des schnellen Verlaufs der Anpassungsprozesse auch durch vermehrtes Engagement nicht aufklären können.«38
Mit dieser Beobachtung werden von Meyer/Miggelbrink (Frustrations-)Prozesse beschrieben, die in der Forschung als »Peripherisierung« bezeichnet werden. Kühn/Weck haben eine Analyse dessen, was Peripherisierung ausmacht, kürzlich umfassend erarbeitet und dargestellt.39 Insgesamt machen Kühn/Weck vier wesentliche Dimensionen in Peripherisierungsprozessen aus: Abwanderung, Abkopplung, Abhängigkeit und Stigmatisierung.40 Abwanderung ist ein allgemeiner, sozioökonomischer Indikator für die Strukturschwäche einer Region.41 Es wird damit angezeigt, dass es einen brain drain gibt (junge, qualifizierte Menschen gehen) und eine schrumpfende und überalterte Bevölkerung zurückbleibt.42 »Eine ›Abkopplung‹ von Städten und Regionen bedeutet, dass sich ihre Integration in die übergeordneten Regulierungssysteme von Markt und Staat lockert und Zugänge dazu erschwert werden.«43
Durch Abkopplung wird vor allem die Innovationsfähigkeit geschwächt.44 Abhängigkeit bezeichnet die Sachlage, dass peripherisierte Räume von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft außerhalb abhängig sind und so eine fehlende Autonomie die eigenen Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt.45 Mit Stigmatisierung kann sozialpsychologisches Hemmnis beschrieben werden, welches Prozesse aller Art vor Ort erschwert.
Beispielsweise wäre die von Meyer/Miggelbrink festgestellte »Ohnmacht« der Dimension »Stigmatisierung« zuzurechnen. Stigmatisierung ist keinesfalls nur eine negative Zuschreibung an bestimmte Räume von außen, sondern auch ein Phänomen, welches in Problemregionen als eine Art »Selbst-Stigmatisierung« anzutreffen ist. So konnten Steinführer/Kabisch ein Auseinanderfallen von Binnen- und Außenimage der stark von Peripherisierung betroffenen Stadt Johanngeorgenstadt in Sachsen feststellen.46 Während Urlaubsgäste ein positives Bild der Stadt haben, schätzen sich die Bewohner samt ihren Möglichkeiten sehr negativ ein. Die hohe Bewertung der eigenen Probleme sowie geringe Aussichten auf Besserung wirken sich negativ auf die Möglichkeit von konstruktiven Veränderungsprozessen aus (»Ohnmachtsgefühl«).47 Wirth/Bose sprechen hier von einer »Peripherisierung im Kopf«.48 Dieses mentale Phänomen beobachtete Matthiesen in einem anderen Forschungsprojekt im deutsch-polnischen Grenzgebiet Brandenburgs.49 Matthiesen fasst zusammen:
»An diesem Syndrom aus Angst, Verzweiflung und Überforderung, von Trotz und Fluchttendenzen, gemischt mit weiterhin durchaus anschlussfähigen Formen von Renitenz und lokalem Stolz, von Einsatzwillen und Innovationsbereitschaft scheinen nun externe Lernangebote auf örtlicher und teilregionaler Ebene folgenlos abzufließen.«50
Neben dem objektiven Rückgang bzw. Schrumpfungsprozessen spielt offenbar die subjektive Einschätzung der Akteure vor Ort, die als »Ohnmachtsgefühl« oder »Peripherisierung im Kopf« beschrieben werden kann, eine wesentliche Rolle in der Wahrnehmung der Lage und bezüglich der Verbesserungsmöglichkeiten.
Dies wirft auch die Frage auf, inwiefern Pfarrer in diesen Gebieten unter erhöhten Arbeitslasten zu leiden haben – entweder als Personen, die diesbezüglich selbst belastet sind oder als Verantwortliche, die es in Sachen ehrenamtlicher Unterstützung besonders schwer haben.
Anhand der hier dargestellten, derzeit ablaufenden Vorgänge wird die Komplexität der Problematik von kirchlichem Rückbau unter gesellschaftlichen Veränderungen sowie deren Auswirkung auf haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende bestenfalls angedeutet. Die praktisch-theologische Forschung steht hier erst am Beginn der Erfassung und Unterscheidung von komplexen gesellschaftlichen Prozessen und deren Bedeutung für die Kirche als Ganze. Offensichtlich ist jedoch, dass die Frage nach der Gesundheit und Erschöpfung im kirchlichen Dienst nicht allein Thema der Pastoraltheologie oder des Personalmanagements sein kann, sondern Kirchentheorie und Organisationsentwicklung mit bedacht werden müssen, wenn es darum geht, die Situation für die Mitarbeitenden zu verbessern.