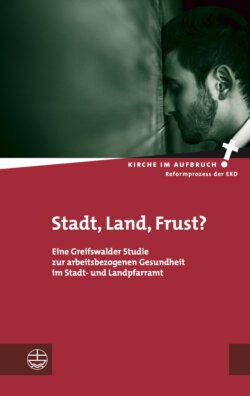Читать книгу Stadt, Land, Frust? - Группа авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geleitwort
ОглавлениеDas Thema einer »Kirche in der Fläche« ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen für unsere Kirche und deshalb seit etlichen Jahren im Blick der EKD. 2011 fand die erste Landkirchenkonferenz in Gotha statt. Zuvor erschien 2006 das Impulspapier »Kirche der Freiheit«. Es war mit dem Verdacht behaftet, das Land vergessen zu haben und allein die leuchtenden urbanen Zentren zu propagieren. Was für das Impulspapier auch tatsächlich galt, gilt nicht für die EKD-weite Aufmerksamkeit. Denn eine Arbeitsgruppe war bereits eingesetzt, 2007 wurde mit dem EKD-Text »Wandeln und Gestalten« ein erstes Grundsatzpapier zu missionarischen Chancen und Aufgaben in ländlichen Räumen veröffentlicht1, woraufhin 2009 der Rat der EKD »Kirche in der Fläche« zu einem Schwerpunkt erklärte: Die Zukunft der Kirche explizit in ländlich-peripheren Räumen wird seitdem von der EKD als Herausforderung reflektiert, verbunden mit der Hoffnung, dass Lösungen, die hier gefunden werden, exemplarische Bedeutung besitzen für Kirche auch an anderen Orten unter anderen Vorzeichen.
Unterdessen haben wir vier Land-Kirchen-Konferenzen und eine Reihe von Fachtagungen organisiert. Von Beginn an begleitet uns eine gleichbleibend hohe Aufmerksamkeit und Akzeptanz (»Gut, dass es das gibt!«). In den Landeskirchen genoss und genießt das Thema unterschiedliche Priorität. Mittlerweile finden regionale Land-Kirchen-Konferenzen statt (so z.B. in der Kooperation der Landeskirchen von Baden und Württemberg; in der Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es Werkstatttage »Kirche in ländlichen Räumen«; in der Nordkirche, Sprengel Schleswig und Holstein, kam zum zweiten Mal eine »Kirchen-Konferenz zur Wirklichkeit und Zukunft von Kirche in den ländlichen Räumen« zusammen; auch Landessynoden haben unterdessen das Thema als Schwerpunkt ihrer Arbeit aufgegriffen: die Evangelische Landeskirche Anhalts, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern).
Die EKD sieht sich in diesem Themenfeld auch zukünftig als Dienstleisterin und wird für die Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen weitere vernetzende und impulsgebende Formate anbieten. Mit der Studie »Freiraum und Innovationsdruck« haben wir zudem 2016 eine breite Feldforschung ausgewählter Gemeindeprojekte im ländlichen Raum vorlegen können.2 Als die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland an die EKD mit der Idee einer »Befragung zur physischen und psychischen Gesundheit im Landpfarramt« herantrat, haben wir das gern aufgegriffen und die Studie gemeinsam mit dem Greifswalder Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeerneuerung, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands als Partner betrieben.
Denn eines der wichtigsten kircheninternen Themen in den kommenden Jahren ist die zukünftige Gestalt des Berufsbildes Pfarrer, nicht nur im Blick auf das Land, aber da im Besonderen. Denn Beispiele von Kirche in ländlichen Räumen erweisen sich als Vorreiter von wichtigen Innovationen/Veränderungen für die Kirche überhaupt. Wir stehen hier vor weiteren tiefgreifenden Veränderungen. Die Veränderungen in den ländlichen Räumen haben etwas Kontingentes. Radikale Alternativen brechen auf, wo Lücken Freiräume geschaffen haben. Was zunächst mehr wie eine vorsichtige Anpassung an Veränderungen aussieht, kann eine überraschende Veränderungsdynamik in Gang setzen.
In den vergangenen Jahren stand vielfach die Frage nach angemessenen Gemeindeformen in peripheren Räumen im Zentrum. Die V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zeigt, dass – in allen Veränderungen – der Pfarrberuf auf lange Sicht weiterhin ein »Schlüsselberuf« der evangelischen Kirche bleiben wird. Wie ist die Arbeit zu gestalten bei einer Verantwortung für fünf oder sogar zehn Gemeinden? Welche Bedingungen sind förderlich, welche hindern im Blick auf die Arbeitszufriedenheit? Welche Chancen liegen in dem veränderten Miteinander von Haupt- und Ehrenamt?
Die hier vorgelegte Studie lebte von den ersten konzeptionellen Überlegungen bis zur Drucklegung von der Beteiligung und dem Engagement vieler. Großer Dank gebührt deshalb dem Projektteam des IEEG (Prof. Michael Herbst, Anja Hanser und Benjamin Stahl) sowie Jürgen Schilling vom Kirchenamt der EKD. Dankbar sind wir zudem für die Förderung und Begleitung seitens der Landeskirchen Hannovers und Mitteldeutschlands. Für die Kommentierung aus sehr unterschiedlichen Perspektiven geht der Dank an Gabriele Ahnert-Sundermann, an Dr. Peter Böhlemann, Dr. Martin Grabe, Philipp Elhaus, Dr. Gunter Schendel, Michael Lehmann, Dr. Thomas Schlegel und Jürgen Schilling. Und schließlich hat die Evangelische Verlagsanstalt die Publikation in Person von Frau Dr. Weidhas und Frau Sina Dietl sehr freundlich und kompetent betreut.
Hannover im Februar 2019
OKR Dr. Konrad Merzyn