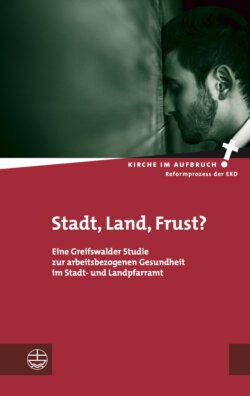Читать книгу Stadt, Land, Frust? - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Überlastung im Pfarramt?
ОглавлениеAuch in Deutschland geraten angesichts der beschriebenen Wandlungsprozesse die Kirchen unter Druck. In der Regel reagieren sie darauf mit Regionalisierungsprozessen, um Strukturen zu vereinfachen und (im Normalfall) zu zentralisieren. In diesen Prozessen geraten dann bald die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchen in den Fokus. Wagner-Rau fragt in ihrem pastoraltheologischen Beitrag bezüglich der Pfarrer: »Wo ist der Punkt erreicht, an dem die Belastungen und Ansprüche über das hinausgehen, was zu leisten ist?«70 Sie macht deutlich, wie schwierig es ist, das Kleinerwerden zu akzeptieren, ohne zu resignieren:
»Anzuerkennen, dass das Maß der vorhandenen Ressourcen und veränderte strukturelle Bedingungen sich auf die Handlungsmöglichkeiten auswirken, hat nichts mit Resignation zu tun. […] Weniger Pfarrerinnen und Pfarrer können in Zukunft auch insgesamt weniger Arbeitszeit zur Verfügung stellen.«71
Auch Karle nimmt wahr, »daß viele Pfarrerinnen und Pfarrer schon nach wenigen Jahren [s. c. im Dienst, BS] über Identitätskrisen und Symptome des ›burnout‹ klagen«.72 Alex/Schlegel halten allerdings fest, dass diese Fragen und Herausforderungen für das Pfarramt »so gut wie nicht aufgearbeitet« sind.73
Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von Pfarrern gibt es mehrere, allerdings sind Untersuchungen zur Arbeitsgesundheit kaum anzutreffen.74 Rohnke nimmt für sich in Anspruch die erste »Belastungsanalyse i. S. des § 5 ArbSchG« vorgenommen zu haben.75 Hinsichtlich der Verwendung von Inventaren zur Erfassung des Phänomens »Burnout« gibt es bisher im deutschsprachigen, protestantischen Raum nur zwei Studien.76 Keine dieser Studien beachtet die ländlichen Räume mit ihren spezifischen Herausforderungen gesondert.
Schaut man auf das Thema »ländliche Räume« und »Pfarramt«, sind die empirischen Studien ähnlich dünn gesät. Aspekte des Landes spielen in der Auswertung der Studien zur Berufszufriedenheit im Pfarramt allenfalls bei Becker und bei Magaard/Nethöfel eine Rolle.77 Allerdings müssen die Stadt-Land-Unterscheidungen dieser Studien angesichts der Heterogenität ländlicher Räume als wenig differenziert eingeschätzt werden, so dass nicht sicher ist, was hier mit der Kategorie »Land« erfasst wird.78 Grundsätzlich hält Becker als »Kernergebnis« fest: »Die Pfarrstellen unterliegen nach der empirischen Datenlage regionalen und wahrscheinlich auch lokal-individuellen Begebenheiten.«79 Ob es einen Unterschied aufgrund regionaler Begebenheiten bei Pfarrern gibt und ob diese sich auf Belastungsindikatoren auswirken, soll in unserer Studie überprüft werden.
Als Indizien für eine Mehrbelastung der »ländlichen« Pfarrer lässt sich der für diese Gruppe »typische« Wunsch nach einer »grundsätzlich […] geringere[n] Belastung« im Vergleich zu Pfarrern aus anderen Gebieten deuten.80 In ähnlicher Weise spricht auch die Nutzung von Urlaubstagen und Freizeitausgleich für eine mögliche Mehrbelastung der »ländlichen« Pfarrer bei Magaard/Nethöfel. Nach deren räumlichen Kategorisierungen wird sichtbar, dass Landpfarrer seltener ihren Urlaubsanspruch einlösen oder einen freien Tag pro Woche nehmen – lediglich in der Kategorie »1/2 Arbeitstag pro Woche frei« sind die Landpfarrer vorn.81 Dies lässt auf ein Verhalten schließen, welches hinsichtlich der sog. Work-Life-Balance nicht förderlich ist.
Zusammenfassend heißt das: In der Forschungsliteratur wird eine starke Überlastung der Mitarbeiterschaft behauptet. Die Gründe für die Überlastung werden vor allem in den Strukturanpassungsprozessen gesucht, die in ländlich-peripheren Räumen in besonderem Maße zu finden sind. Bisher gibt es jedoch keine belastbare Forschung, die diese Kombination aus Belastungserkrankungen und ländlich-peripherer Umgebung untersucht. Gleichwohl gibt es Indizien für einen solchen Zusammenhang zwischen Umgebung und Belastung.