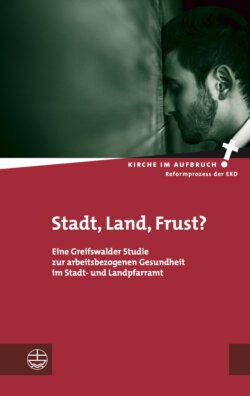Читать книгу Stadt, Land, Frust? - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 Entwicklung von GIPP I – Erfassung von »Stadt« und »Land«
ОглавлениеIn unserer Studie »Stadt-Land-Frust?« haben wir »Ländlichkeit« so präzise wie möglich erfasst. Die Erfassung dessen, was bei uns als ländlich gilt, ist mehrdimensional. Im Wesentlichen lassen sich drei Dimensionen ausmachen:
1. Statistische Marker für die äußere Abgrenzung der Ländlichkeit.
2. Subjektives Empfinden von Ländlichkeit.
3. Angaben zur kirchlichen Situation vor Ort (SIT).
Diesen Teil unseres Fragebogens bezeichnen wir als GIPP I.82 Mit GIPP I sind alle Items gemeint, die den Unterschied zwischen Stadt und Land aufklären und bestimmen helfen. Dieses multidimensionale Inventar GIPP I durchlief einige Entwicklungsstufen:
In unseren Pretests verwendeten wir Karten, die wir auf Grundlage der BBSR-Kategorisierungen erstellt hatten.83 Insofern die Befragung in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (EVLKA) und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) durchgeführt wurde und die Daten des BBSR nur für politische Gemeinden aufbereitet sind, wurden Karten für die jeweiligen Bundesländer des Befragungsgebietes erstellt: Zwei Karten für Niedersachen (Ost und West, damit der Maßstab nicht zu klein wird), je eine Karte für Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und den Ostteil von Brandenburg, da die betreffenden Kirchen in allen diesen Bundesländer gebietsmäßig vertreten sind.84
Jedem Probanden wurden die Karten zu »Ländlichkeit« (Abb. 3) und »Lage« (Abb. 4) vorgelegt. Die Raumkategorien des BBSR wurden in diesen Karten auf Ebene der politischen Gemeinde aggregiert und in einem Maßstab vorgelegt, der die Identifizierung des eigenen Dienstortes möglich machte. Jeder Proband konnte dann auf der Legende ankreuzen, welcher Raumkategorie sein Dienstgebiet mehrheitlich angehört: bspw. »ländlich«, »teilweise städtisch« oder »städtisch» (Abb. 3) und auf der nächsten Karte »(sehr) peripher« oder »(sehr) zentral« (Abb. 4). So wurde es möglich, jeden Probanden einer definierten Umgebung zuzuweisen.85
Abbildung 3: »Ländlichkeit«
In der EKM wurde eine Vollerhebung durchgeführt. Eine Auffälligkeit bezüglich des Ostens ist hier zu nennen: Es gibt in der EKM kaum sehr zentrale, städtische Gebiete. Damit sind Probanden aus dieser Gebietskategorie auch kaum vertreten.
Für die EVLKA, die wesentlich mehr Pfarrer im Dienst hat, musste eine Auswahl getroffen werden, um zwei gleichgroße, vergleichbare Stichproben zu erhalten. Aus Gründen der kirchlichen Organisation konnten in Hannover nur ganze Kirchenkreise angefragt werden. Bei der Auswahl der Kirchenkreise wurde darauf geachtet, möglichst sehr zentrale, städtische und sehr periphere, ländliche Gebiete zu bevorzugen, um die Extremgruppen gegenüberstellen zu können. Insgesamt wurden in der EVLKA 29 Kirchenkreise in die gesamte Befragung (inklusive Pretest I und II) einbezogen (Abb. 5).86
Abbildung 4: »Lage«
Nach Erhebung und Auswertung unserer Pretests zeigte sich im Ergebnis, dass die Probanden keine Unterschiede hinsichtlich Belastungen und Ressourcen aufwiesen, wenn man ihre Verteilung im Raum auf Grundlage der Karten als Unterscheidungskriterium anlegte. Dieser Befund ließ zwei Rückschlüsse zu: Entweder gibt es keinen Belastungsunterschied zwischen städtischen und ländlichen Pfarrern oder die Erfassung der Räumlichkeiten war nicht präzise genug. Insofern wir uns in der Pretestphase befanden, entschieden wir uns GIPP I zu erweitern und zu präzisieren.
Abbildung 5: Punkte kennzeichnen die befragten Kirchenkreise der Landeskirche Hannovers.
Für diese Präzisierung und Erweiterung führten wir Interviews mit Experten aus dem kirchlichen und akademischen Bereich durch.87 Nach Auswertung unserer Expertenbefragungen kamen wir zu dem Schluss, dass die Karten auf Datengrundlage der BBSR-Raumkategorien für unsere Belange eventuell nicht trennscharf genug waren. Dies hatte mehrere Gründe: Zum einen waren uns die Cutoffwerte bzw. Kategoriengrenzen unbekannt sowie evtl. nicht ausdifferenziert genug und zum anderen sind in den Kategorisierungen des BBSR verschiedene Maße integriert.88 In unseren Experteninterviews wurden wir mehrfach darauf hingewiesen, dass der simpelste und aussagekräftigste Indikator schlicht die Bevölkerungsdichte ist. Deswegen entschieden wir uns, für die Unterscheidung von Stadt und Land dieses Maß zu nehmen (Abb. 7).89
Aus der Forschung ist weiterhin bekannt, dass die Lage im Raum und damit auch die Abgelegenheit von Orten eine wichtige Rolle spielt. Die Kategorien des BBSR sind auf Oberzentren ausgerichtet. In sehr ländlichen Gebieten können jedoch schon Städte eine infrastrukturelle Oasenfunktion besitzen, die nicht als Oberzentrum klassifiziert werden können. Somit erschien uns die Lage in Abhängigkeit von Oberzentren allein als eine Makroebene, die für unsere Zwecke ein zu grobes Raster vorgab. Deswegen entschieden wir uns, die Lage in Abhängigkeit von Mittelzentren zu erheben (Abb. 6).90
Der Indikator »Mittelzentrum«, der mit den INKAR-Materialien des BBSR zur Verfügung gestellt wird, ist mit einem Defizit belastet. Es gibt in Deutschland keine einheitliche Definition dessen, was ein Mittelzentrum ist und welche Infrastrukturen vorgehalten werden müssen, um als Mittelzentrum zu gelten.91 Mittelzentren werden in den jeweiligen Landesentwicklungsplänen der Bundesländer festgelegt. Eine gewisse Ähnlichkeit von Mittelzentren kann jedoch angenommen werden mit der Ausnahme des Bundeslandes Thüringen, in dem »sich noch heute das historische Erbe aus der Zeit der kleinteiligen Strukturen [zeigt]«.92 So kommen in Thüringen auf drei Oberzentren 32 Mittelzentren. Im Vergleich mit anderen Regionen haben Menschen in Thüringen kurze Wege ins nächste Mittelzentrum.93 Jedoch kann nicht jedes Mittelzentrum die – zugegebenermaßen wenig klar definierten – Anforderungen an Mittelzentren erfüllen. Das heißt, dass die kleinen Mittelzentren nur die Infrastrukturen vorhalten können, die sich auch finanziell tragen. Und dies schränkt deren Versorgungsleistungen ein.94 Für 9 von 32 Mittelzentren in Thüringen ist demnach festzuhalten, dass sie schon 2010 ein »geringes Leistungsspektrum« aufwiesen und »ihre eigentliche Rolle also gar nicht mehr erfüllen [konnten]«.95
Diese Feststellung hat zwei Konsequenzen für unsere Abgrenzung von Stadt und Land: zum einen ist festzuhalten, dass es keinen besseren Indikator auf dieser Ebene gibt, und zum anderen bedeutet das, dass unsere Probanden in der Tendenz eher als ländlich einzuschätzen sind, wenn man sie aus der Perspektive von gut erreichbaren Infrastrukturen betrachtet.
In der Tendenz zeigt sich, dass dünn besiedelte Gebiete mit abgelegenen Gebieten übereinstimmen. Mit Henkel kann man davon ausgehen, dass eine Besiedlungsdichte von unter 200 Ew/km2 für ein ländliches Gebiet spricht.96 Die Entfernung zu den Mittelzentren beträgt auf dem deutschen Festland nicht mehr als ca. 40 Pkw-Minuten – Fahrzeiten, die weit größer sind, bedeuten, dass man sich auf einer Insel in der Nordsee befindet. Deutschland ist damit alles andere als eine Infrastrukturwüste!
Wir wollten nun wissen, welcher Kartensatz (BBSR-Kategorisierungen oder unsere nachgearbeiteten Karten zu Bevölkerungsdichte und Entfernung zu Mittelzentren) hilfreicher ist, um zwischen Stadt und Land zu unterscheiden und haben deswegen die unterschiedlichen Karten mit den Angaben der Probanden zu den Items verglichen: »Ich arbeite auf dem Land« und »Ich arbeite in der Stadt«. Im Auswerten der Ergebnisse hat sich gezeigt, dass für den ländlich-peripheren Bereich eine sehr hohe Prozentzahl der Probanden auch angibt, dass sie »auf dem Land arbeitet«. Etwas unterschiedlicher ist die Zustimmung bei denen, die sich auf zentralem und städtischem Gebiet befinden. Darum konzentriert sich die Darstellung nun auf diese letztgenannten Kategorien.
Abbildung 6: Erreichbarkeit der Mittelzentren in Autominuten.
In sehr zentraler Lage (vgl. Abb. 4/BBSR-Kategorie), in der eine hohe Zustimmung zu dem Item »Ich arbeite in der Stadt« zu erwarten ist, bestätigen die Probanden diese Vorhersage mit hoher Zustimmung. 64 % der 77 Probanden, die sich auf sehr zentralem Gebiet befinden, sagen von sich: »Ich arbeite in der Stadt.«
Diese Werte sollen mit der Erfassung über die Fahrzeit in Pkw-Minuten zu den Mittelzentren verglichen werden (Abb. 6). Auch hier sagen 64 % der – allerdings – 203 Probanden, die ein Mittelzentrum in 0 bis 1 Minute mit dem Pkw erreichen, dass sie »in der Stadt arbeiten«. Hier zeigt sich, dass der Ausgangspunkt bei den Mittelzentren eine größere Zahl an »Städtern« erfassen kann. Ginge man nur von den Oberzentren aus, dann wäre die Anzahl der »Städter« um ein Drittel geringer.
Abbildung 7: Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km2.
Im »überwiegend städtischen Gebiet« (Abb. 3/BBSR-Kategorie) befinden sich 197 Probanden. Davon schätzen rund 60 % ein, dass sie »in der Stadt arbeiten«.
Vergleicht man das mit der Karte »Bevölkerungsdichte« (Abb. 7), zeigen sich folgende Relationen: Bei einer Bevölkerungsdichte von 293 Ew/km2 und mehr sagen von den 164 Probanden, die diesem Dienstgebiet zugeordnet werden konnten, 71 %, dass sie »in der Stadt« arbeiten. Würde man die Kategoriengrenze weiten und auf die 252 Probanden schauen, die in einem Dienstgebiet sind, das mehr als 180 Ew/km2 umfasst, würden immer noch 61 % angeben, dass sie »in der Stadt« arbeiten. Auch hier zeigt sich die selbst erstellte Karte als besser, denn die Prozentzahl derer, die angeben in der Stadt zu arbeiten, ist in allen Fällen höher als bei der Karte »Ländlichkeit« (Abb. 3/BBSR-Kategorie).
Die selbst erstellten Karten erweisen sich damit als sensitiver und für die Zwecke der Unterscheidung zwischen Stadt- und Landpfarramt hilfreicher. Diese Karten werden deswegen herangezogen, um in unserer Studie die Gruppe der peripher-ländlichen von den zentral-städtischen Pfarrern zu unterscheiden. Die Kategorisierungen des BBSR, die ihren Wert in der Beschreibung großer Raumzusammenhänge haben, können deswegen im Zusammenhang unserer Studie vernachlässigt werden.