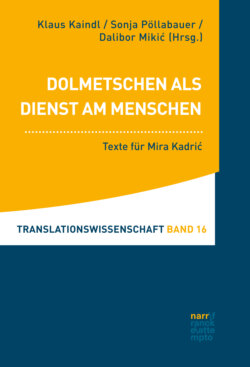Читать книгу Dolmetschen als Dienst am Menschen - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Pionierarbeit im Dialogdolmetschen
ОглавлениеEin wichtiges Bindeglied zwischen den Asylsuchenden und den Einheimischen bzw. den zuständigen Behörden wird üblicherweise im sprachlichen Bereich gesehen, also im Erlernen der fremden Sprache, aber auch im Übersetzen und Dolmetschen, vor allem im Dialogdolmetschen. Diese Thematik ist in der wissenschaftlichen Arbeit von Mira Kadrić von besonderer Bedeutung, weil sie zu den PionierInnen in Forschung und Lehre des Dialogdolmetschens gehört. Am Anfang ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in den 1990er-Jahren verstand man unter Dolmetschen fast ausschließlich das Konferenzdolmetschen, und zwar innerhalb der großen Weltsprachen. Selbst das Gerichtsdolmetschen war an den Ausbildungsinstituten ein Randthema. Mit ihrer Dissertation, zuerst 2000 als Dolmetschen bei Gericht. Anforderungen, Erwartungen, Kompetenzen erschienen (vgl. auch die überarbeitete Neufassung Kadrić 2019), leistete sie einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung für die Thematik im deutschsprachigen Raum. Im Laufe ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit wurde das Spektrum auf community interpreting, also das Dialogdolmetschen, erweitert, inklusive die damit verbundene Didaktik des Dolmetschens, wie in ihrem Buch Dialog als Prinzip (2011) beschrieben wird. Später kamen Bereiche, die sich mit „ausgesuchten ‚Bedarfssprachen‘“ (Scheidl 2020) befassten. Ein Höhepunkt auf diesem Gebiet war im Wintersemester 2016/17 die Einführung des Universitätslehrgangs „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ am Zentrum für Translationswissenschaft in Wien, mit den Sprachen Arabisch, Dari/Farsi und Türkisch; weitere Sprachen (derzeit Albanisch und als Erweiterungsstudium in Planung Kurdisch) kamen hinzu. Diese postgraduale Weiterbildung in „seltenen“ Sprachen für DolmetscherInnen u.a. im Justizbereich, bei Polizei und Asylbehörden war überfällig – und es war Mira Kadrić Verdienst, diese in die Universitätslandschaft integriert zu haben (s. auch Reichart 2020).
Inzwischen ist die Fachliteratur zum Thema Dialogdolmetschen (sowie in verschiedenen Ländern das praktische Angebot) für Außenstehende nicht mehr überschaubar: Das muss gewürdigt werden, kann aber in diesem Beitrag nicht angemessen erörtert werden. Stattdessen möchte ich mich auf kulturelle und soziale Aspekte konzentrieren und zwei konkrete Fälle beschreiben, die zeigen sollen, wie wichtig die Zusammenarbeit – und damit die transkulturelle Kommunikation – zwischen NGOs, Behörden und einheimischen BürgerInnen einerseits und Asylsuchenden andererseits für das Gelingen ihrer Integration und letztendlich für die Qualität des künftigen Zusammenlebens in Europa wäre. Beide Fälle stammen aus Vorarlberg, einem Land mit einer langen Geschichte menschlicher Zu- und Abwanderung, mit allen möglichen Folgen.