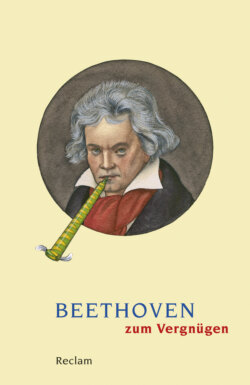Читать книгу Beethoven zum Vergnügen - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеLudwig van Beethoven galt schon zu seinen Lebzeiten als höchst ernsthafter Mensch und Komponist. Noch heute sieht man ihn – allerdings oft sehr einseitig – unter diesem Generalvorzeichen. Die immer wieder abgebildeten authentischen Portraits, mehr noch die romantisch überhöhten Bildnisse aus dem späteren 19. Jahrhundert spiegeln diese Ernsthaftigkeit wider, oft in überzeichneter Form und bis zur Verkniffenheit gesteigert, während in Wirklichkeit wohl mehr der Widerwillen, einem Portraitisten länger zu sitzen, dahinterstand. Eine komplexe Künstlerpersönlichkeit wie Beethoven war allerdings alles andere als homogen und stromlinienförmig. Zwar zog er sich schon in seiner Jugend des Öfteren zurück, wollte für sich sein. Ab dem 28. Lebensjahr verstärkte seine zunehmende Schwerhörigkeit diese Tendenz, zog Misstrauen und Scham und in der Folge soziale Isolation nach sich. Bettina Brentano beschrieb er 1811 den Pendelschlag mit den Worten: »Rauschende Freude treibt mich oft gewalthätig wieder in mich selbst zurück.«
Beethoven hatte aber auch eine ganz andere Seite und behielt sie ungeachtet aller Belastungen bis zu seinem Lebensende. Ja, man kann ohne in Spekulationen verfallen zu müssen, konstatieren, dass gerade sein Humor es ihm ermöglichte, seine künstlerische Schaffenskraft und die menschlichen Tragödien seines Lebens in Balance zu halten. Humor war manchmal sozusagen die bessere Alternative zur Verzweiflung. Daher kann man Beethoven als Mensch und als Künstler besser verstehen lernen, wenn man seinen Humor, der sich in gelöster Stimmung, vor allem aber auch als ausgleichendes Momentum in schwierigen Situationen hervortat, unter Zuhilfenahme der eigenen Phantasie auszuloten versucht. Das sahen übrigens schon seine Zeitgenossen so.
Beethoven war humorvoll, gesellig, legte großen Wert auf Freundschaft und gerade gegenüber Freunden und Vertrauten schlug sein Humor in Form von Wortspielen, Verballhornungen, Ironie, Sarkasmus und Übermut machmal fast erbarmungslos zu. Diese Seite seiner Persönlichkeit soll in der hier vorlegten Auswahl seiner Texte im Zentrum stehen. Sie speisen sich aus dem reichen Fundus von knapp 1800 Briefen, die von ihm überliefert sind. (Das Wort »Vergnügen« taucht übrigens auffallend oft im Briefwechsel auf, manchmal allerdings lediglich als Höflichkeitsfloskel.) Trotz dieser nicht unbeträchtlichen Anzahl an nachweisbaren Briefen (es wird insgesamt deutlich mehr gegeben haben) tat sich Beethoven nach eigener Aussage mit dem Korrespondieren schwer. Das konnte ganz unterschiedliche Gründe haben – angefangen von emotionalen Hürden, angesichts von Heimweh und Sehnsucht nach den alten Bonner Freunden, bis zu regelrechten inneren Blockaden, weil er partout nicht die richtigen Worte finden konnte, mit denen er seine Empfindungen angemessen hätte ausdrücken können, oder bei schwierigen, ihn belastenden Themen oder ihm peinlichen Absagen. »[D]em Compositeur Beethoven ist Briefschreiben und Rechnen etwas odioses«, ließ Georg August Griesinger im April 1802 den Leipziger Musikverleger Christoph Gottfried Härtel wissen. Die Korrespondenz zeigt den Komponisten, der schon zu Lebzeiten als »musikalischer Jean Paul« tituliert wurde, als Briefschreiber, der die damaligen Normen kannte und dementsprechend je nach Adressaten unterschiedliche Schreibstile berücksichtigte. Wie Sieghard Brandenburg gezeigt hat, verwendete Beethoven nach Maßgabe der Rhetorik den niederen, mittleren und höheren Stil. Gedruckte Ratgeber in Bezug auf das Verfassen wirklich jeglicher Zweckbestimmung von Briefen (bis hin zum »Bewerbungsschreiben eines Witwers mit zwey Kindern an ein lediges Mädchen« samt Antwortschreiben des Mädchens) waren damals weit verbreitet (der unter dem Pseudonym Franz Xaver Samuel Riedel erschienene Wiener Sekretär für alltägliche Fälle des gemeinen Lebens erlebte zu Lebzeiten des Komponisten mehr als 15 Auflagen!). Beethovens Lehrer Christian Gottlob Neefe hatte im Februar 1785 im 45. und 46. Heft der Bonner Wochenzeitschrift Beiträge zur Ausbreitung nützlicher Kenntnisse einen Artikel über »Etwas von der Kunst, Briefe, besonders freundschaftliche und scherzhafte, zu schreiben. Nebst einigen Mustern« veröffentlicht, den sein 14-jähriger Schüler vermutlich zu Gesicht bekam. Er warnt darin ausdrücklich davor, stereotype Briefe zu verfassen, da sie, als unnatürlich empfunden, nie ihre Wirkung erzielen könnten und greift dabei bis auf Cicero und Plinius zurück. Beethoven, der eine bescheidene Schulbildung besaß, hatte sich schon 1783 im Falle der Erstausgabe seiner ersten drei Klaviersonaten WoO 47 in Bezug auf die Abfassung der Widmungsadresse an Kurfürst Maximilian Friedrich Formulierungshilfe eingeholt. Er ließ sich auch später in wichtigen Fällen beraten, etwa wenn es um das Schreiben an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. ging, mit dem er die Widmung der 9. Sinfonie unterbreitete und um deren Genehmigung bat. In den allermeisten hier ausgewählten Briefen ist Beethoven aber denkbar weit von solch konventionellen Vorgaben entfernt. Vergnügen resultiert ja aus Abwechslung und individueller Phantasie. Wie differenziert der Komponist beim Briefschreiben vorging, ist schon an der gelegentlichen Hinzufügung eines »von« bei Adressen an Bürgerliche zu erkennen, manchmal ein Zeichen besonderer Hochachtung, sozusagen eine vom Herrscher im Reich der Tonkunst ausgesprochene Nobilitierung, manchmal ironisch gebrochen, manchmal geradezu provokant (für Tobias Haslinger: »an Herrn von Tobias. Edler v. Haß – lin – ger.«).
Die hier getroffene Auswahl berücksichtigt ferner Eintragungen in den sogenannten Konversationsheften – jenen Heften, die Beethovens Gesprächspartner in seinen letzten zehn Lebensjahren verwenden mussten, um dem Schwerhörigen ihre Fragen und Antworten mitzuteilen. Ein längerer Ausschnitt aus dem Konversationsheft, das am 2. September 1825 benutzt wurde, gewährt unmittelbaren Einblick in die – in diesem Fall ausgesprochen lustige – Lebenswelt des Komponisten. Auch die Erinnerungen von Zeitgenossen bieten manch amüsanten Bericht. Alle diese Dokumente ergeben zusammen ein äußerst buntes Bild, das oft so gar nicht jenem entsprechen will, das viele simplifizierend vom Komponisten der 9. Sinfonie und der späten Streichquartette im Sinn haben. Aber der humorvolle Beethoven ist auch in manchem seiner – oft als durch und durch ernsthaft apostrophierten – Werke erst noch in der Breite zu entdecken, man denke nur an die frühe Streicher-Serenade op. 8, die Klaviersonate op. 14 Nr. 2 oder die späten Diabelli-Variationen op. 120. Auch die Klaviersonate Nr. 31 Nr. 1, die Prometheus-Variationen op. 35 und die 8. Sinfonie op. 93 sind hier zu nennen und gleich in mehrfacher Hinsicht das Lied Aus Goethes Faust op. 75 Nr. 3, das »Flohlied«. In ihm schreibt der Komponist im Klavierpart am Ende Fingersätze vor, die den Floh knicken und den Pianisten zwicken. Beethoven ist hier ganz bei sich. Fragt man sich, was der 22- bis 24-Jährige bei seinem Lehrer Joseph Haydn gelernt bzw. sich abgeschaut hat, dann wird man nicht zuletzt Humor, Witz und Überraschungseffekte in der Musik nennen. Schon in Bonner Tagen sollte das Ritterballet WoO 1 den Bonnern Vergnügen in der fünften Jahreszeit bieten – und seinem Förderer Ferdinand Graf Waldstein zudem das besondere Vergnügen, als Autor (auch der Musik) geführt zu werden. Die erste Aufführung fand am Faschingssonntag statt und zwar durch den »hiesigen Adel und in altdeutscher Tracht«.
In unserem Zusammenhang ins Bild zu rücken sind außerdem von Beethoven vertonte einschlägige Liedtexte, vor allem aber auch die meist wenig bekannten vergnüglichen Texte, die er als Musikalische Scherze oder Scherzkanons vertont hat. Nur so steht uns ausreichend vor Augen, wie vielgestaltig Beethoven das weite Feld der Musik zwischen größter Ernsthaftigkeit und schrägstem Humor zu bearbeiten wusste. Es kommt einem dann das geflügelte Wort Johann Nestroys aus seiner Posse mit Gesang Einen Jux will er sich machen in den Sinn: »Das is classisch«. Berücksichtigt wurden schließlich auch Texte, die der diesbezüglich wählerische Komponist nur zu vertonen beabsichtigte – so die Sprichwörtersammlung Ignaz Franz Castellis, der ein Zentralgestirn des Humors und Juxes im von Restauration, sprich Überwachung und Zensur, geprägten biedermeierlichen Wien war. Humor war damals nicht einfach unbeschwertes Vergnügen, sondern oft doppelbödig bzw. die einzige Möglichkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen, für das man – ernsthaft formuliert – sicherlich unangenehme Bekanntschaft mit der Obrigkeit gemacht hätte. 1794 formulierte Beethoven das so: »[M]an darf nicht zu laut sprechen hier, sonst giebt die Polizei einem quartier.« Tatsächlich geriet er einmal in die Fänge des Überwachungsstaates, wurde schließlich aber doch als harmloser Sonderling eingestuft. Im März 1820 findet man unmittelbar nach einer Skizze zum Kanon Hofmann sei ja kein Hofmann WoO 180 mit dem Text »nein, nein ich heiße Hofmann u bin kein Hofmann sondern ein Elend[er] schuft« einen Eintrag des den Komponisten gelegentlich beratenden Zeitungsredakteurs Joseph Carl Bernard: »Czerny hat mir erzählt, daß der Abbee Gelinek sehr über sie geschimpft hat im Camel [Gasthaus »Zum schwarzen Cameel«]; er sagt, Sie wären ein zweyter Sand, sie schimpften über den Kaiser, über den Erzherzog, über die Minister, sie würden noch an den Galgen kommen.« (BKh 1, 339) Beethoven auf einer Ebene mit dem Burschenschaftler Karl Ludwig Sand, dem Mörder Kotzebues, der als engstirnig und verbohrt, aber seinen demokratischen Idealen treu dienend galt! Tatsächlich könnte der eine oder andere Konversationshefteintrag von Beethovens Hand (er antwortete in der Regel mündlich) auf den dringenden Rat von Freunden zurückgehen, die vermeiden wollten, dass Beethoven sich im öffentlichen Raum, z. B. in Gasthäusern ideologisch (und akustisch) weit aus dem Fenster lehnte. Karl Holz ließ Beethoven im Januar 1826 wissen: »Die Polizey kostet hier das meiste; es gibt hier keinen Tisch im schlechtesten Bierhause, wo nicht so ein verkappter Spürhund säße.« Die Zensur sah er differenziert. Im November 1825 hatte Holz – auf die Vor-Metternich’sche Zeit bezogen – in ein Konversationsheft notiert: »Kaiser Joseph [II.] hat sogar viele Bücher verbothen, weil er wußte, daß sie dann erst recht gelesen werden. Sonnenfels [Joseph Sonnenfels, ein berühmter, in der Monarchie sehr einflussreicher Staatsrechtler, Widmungsträger von Beethovens Klaviersonate op. 28] hat so ein Buch geschrieben, und durch diesen Kniff wurde es allgemein verbreitet.« (BKh 8, 187)