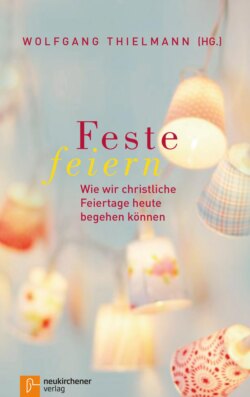Читать книгу Feste feiern - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLichtfest
Irmgard Schwaetzer, geboren 1942, ist Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und damit die zweithöchste Repräsentantin des Protestantismus. Sie war Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Bundesbauministerin.
Foto © Andreas Schoelzel
„Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe“ – Weihnachten beginnt für mich mit diesen Worten aus dem 24. Psalm, die am 1. Advent gesprochen und gesungen werden. Advent – Vorbereitung auf die Geburt des Gottessohns, das Christkind, den Retter der Welt. Advent – das Warten auf die Ankunft des Lichts in dieser Welt, wie der Prophet Jesaja sagt: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht“ (Jesaja 9,1). Advent: darin liegt die Aufforderung, aus unserem Kokon von Gedanken, Problemen und Sorgen herauszukommen, uns selbst und die Welt anzusehen, achtsam zu sein. Dazu gehört für mich die Zeit für eine kurze Meditation über den Impuls aus dem Adventskalender „Andere Zeiten“ oder für eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Dazu gehört auch die Zeit für einen Besuch bei meinem ältesten Bruder, der weit entfernt lebt, Zeit für Freundinnen und Freunde beim Adventscafé oder – selten – auf dem Weihnachtsmarkt. Viel Zeit brauche ich für die Weihnachtskarten. So wächst mit jeder angezündeten Kerze im Adventskranz die Vorfreude.
Den Weihnachtsabend erlebe ich am liebsten in ganz großer Runde im Gottesdienst im Berliner Dom, in „meiner“ Gemeinde. Im Hören auf die Weissagungen aus dem Alten Testament, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, eine Predigt, die den Bogen von der Schrift zum Hier und Jetzt schlägt. Und vor allem: im Singen der wunderbaren alten Weihnachtslieder: „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn …“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir’s wohlgefallen …“, auch dies strahlende „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!“ So erlebe ich die wunderbare Zusage Gottes, uns nie allein zu lassen.
Gott kommt als Mensch in unsere Welt, teilt unser Leben, teilt unser Glück und unser Leid. Dies erfasst nicht unser Verstand, nur unser Glaube. Und dennoch wird in den Lesungen und Predigten deutlich, dass diese uralte Geschichte mitten in der realen Welt stattfindet, wurde die Heillosigkeit der Welt und die Sehnsucht nach dem heilsamen Erscheinen Gottes in der Welt so deutlich:
wenn der Evangelist Lukas die Geburt Jesu in die Zeit einordnet, in der „Quirinius Statthalter in Syrien war“ – schon damals ein von Aufständen und Kriegen gezeichnetes Land (Lukas 2,2);
wenn am 1. Weihnachtstag unsere Nähe zu Gott in der Gotteskindschaft sichtbar wird, der wir unser Leben und Tun verdanken, und der Briefschreiber Johannes uns an das Unrecht erinnert, das durch unsere Lieblosigkeit überall in der Welt sichtbar und erfahrbar wird (1. Johannes 3,1–6);
wenn am 2. Weihnachtstag das Sehnsuchtsbild vom offenen Himmel, der die aufnimmt, die aus der Trübsal kommen, Trost verspricht und gleichzeitig an den ersten Märtyrer Stephanus erinnert wird, der uns heute die verzweifelte Situation der Christen im Vorderen Orient so drängend nahebringt (Offenbarung des Johannes 7,9–12).
Das ist viel Stoff dafür, unser Reden, unser Leben und unser Handeln zu überdenken.
Eigentlich war mir die Musik zu Weihnachten immer mindestens so wichtig wie die Geschenke. Singen und Musizieren gehörten in meiner Kindheit und Jugend zum Heiligen Abend. Wir waren fünf Geschwister, vier Jungen und ich als Jüngste das einzige Mädchen, alle musikalisch, aber mit unterschiedlicher Neigung, dies auch in einem Chor oder an einem Instrument zu praktizieren. Solange wir drei jüngeren Geschwister klein waren, sangen wir von unserer Mutter am Klavier begleitet, später wurden dann auch vierstimmige Sätze mit Klavier- und Cellobegleitung geübt und musiziert, wobei mir schon sehr früh die Altstimme zufiel, weil meine Mutter einen wunderbaren Sopran hatte.
Sobald meine Brüder eigene Familien gründeten, ging diese Tradition zu Ende. Ich selbst habe noch viele Jahre in unterschiedlichen Kirchenchören, später auch an der Harfe meine Freude am Singen und Musizieren zu Weihnachten praktiziert. Meine Stimme allerdings ist von den Jahren deutlich mitgenommen. Das beeinträchtigt die Freude aber nicht.
Seit ich wieder allein lebe, ist es mir wichtig, Weihnachten die Gemeinschaft von Menschen zu suchen, die wie ich allein leben, auch von Menschen, die einen Verlust betrauern oder in der Gefahr stehen, sich von Einsamkeit überwältigen zu lassen. Mit diesen Menschen verbringe ich gern in größeren oder kleineren Runden Zeit an den beiden Weihnachtsfeiertagen, manchmal auch am Heiligen Abend. Das allerdings muss sorgfältig vorbereitet werden. Der Heilige Abend ist für jeden mit so vielen Erinnerungen an ganz eigene Erlebnisse und Traditionen verbunden, dass ein anders gestaltetes Beisammensein eventuell die heimlichen Erwartungen enttäuscht. Das kann alles betreffen: den Gottesdienst, die Musik, den geschmückten Baum, das Essen, den Geschmack der Plätzchen. Ich selbst bin ja auch nicht frei von Erwartungen und Erinnerungen. Deshalb widerstehe ich heute allen Einladungen zum „Familienfest“ meiner noch lebenden Brüder, der Nichten und Neffen. Sie haben ihre eigenen Traditionen für „ihr“ Weihnachtsfest entwickelt.
So lange ich Vorsitzende der Gemeindeleitung am Berliner Dom war, war ich selbstverständlich dort: am frühen Nachmittag zu den ersten, mit Weihnachtsbesuchern überfüllten Vespern, die alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden vor große organisatorische und emotionale Probleme stellt. Dann aber auch wieder zu den beiden letzten Gottesdiensten am Heiligen Abend um 22 Uhr und um Mitternacht, um die Mitarbeitenden, die mit ihren Familien zu Hause feiern wollen, zu entlasten. Zudem ist die Stimmung im Mitternachtsgottesdienst immer besonders, fröhlich und doch still. Dazwischen ist Zeit, die Kerzen am Weihnachtsbaum anzuzünden, die Weihnachtspost zu lesen, mich an den mir zugedachten Worten zu freuen, und auch Geschenke auszupacken.
So halte ich es jetzt auch noch, obwohl ich am Dom keine Leitungsverantwortung mehr habe. Die Feiern dort sind inzwischen so vertraut: die Gesichter der vielen Menschen, auf denen sich – wenn sie hinausgehen – der Widerschein der Weihnachtsgeschichte ablesen lässt, die Inbrunst, mit der das „O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“ zum Schluss des Gottesdienstes gesungen wird; die Jungen des Staats- und Domchores, bei denen man ein wenig die Aufregung und ganz viel Vorfreude auf die Bescherung spürt; die Sängerinnen und Sänger der Domkantorei und die Dombläser, die sich auf den Weg gemacht haben, um sich und anderen Weihnachtsfreude zu bereiten; die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in der Kälte an den Eingangstüren Liedblätter verteilen und später am Ausgang die Kollekte für „Brot für die Welt“ sammeln und zwischendurch Streit um freigehaltene Plätze in den Bankreihen schlichten müssen, und die in den kurzen Ruhepausen im Gemeinderaum ihre Erwartungen austauschen. All das ist für mich weihnachtliche Gemeinschaft, das Licht Gottes in der Welt.
Doch auch andere Möglichkeiten der Gemeinschaft am Heiligen Abend sind für mich reizvoll, mit Menschen in einer der vielen diakonischen Einrichtungen in meiner Nähe.
Nach dem zweiten Feiertag ist Weihnachten natürlich noch nicht vorbei. Silvester und Neujahr – Bilanz und Aufbruch, Dank und Hoffnung. Und dann erst müssen ja am 6. Januar die Heiligen Drei Könige – im Matthäus-Evangelium die „Weisen aus dem Morgenland“ – zur Krippe kommen. Wenn zu Beginn der Adventszeit die Krippe – eigenhändig aus Bethlehem nach Berlin gebracht – aufgestellt wird, warten nur Ochs und Esel auf das Geschehen. Es ist die Zeit der Vorbereitung: Josef und Maria, aber auch die Könige sind ja noch unterwegs und deshalb nicht zu sehen. Mit der Geburt Jesu kommen die Schafe und der Hirte zum Krippenstall mit der Heiligen Familie, die Könige schauen noch aus der Ferne zu. Am 6. Januar, dem Fest der Erscheinung des Herrn in der Welt, dem Fest Epiphanias, haben sie ihr Ziel erreicht: Sie verharren in Anbetung mit ihren Geschenken vor dem Kind. Wenn der Tannenbaum, diese Tradition aus der deutschen Romantik, längst abgebaut ist, bleibt die Gemeinschaft der Krippe beieinander, nach evangelischem Jahreszeitenkalender bis zum letzten Sonntag nach Epiphanias, nach katholischem Brauch bis zum 2. Februar, dem Fest Mariä Lichtmess 40 Tage nach Weihnachten, abgeleitet aus jüdischen religiösen Regeln. Erst dann ist der Weihnachtsfestkreis abgeschlossen. Dann treten wir ein in die vor-österliche Zeit. Nur der Stern, der an der Spitze des Tannenbaums während der Weihnachtszeit den Weg weist, findet während des ganzen Jahres einen Ort in meiner Wohnung.