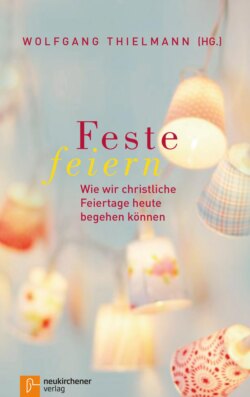Читать книгу Feste feiern - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSing’s auf Anglikanisch – versandkostenfrei, ohne Like-Button
Alexander Brüggemann, geboren 1968, wurde in einer lebendigen katholischen Gemeinde im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) sozialisiert. Er studierte Geschichte und Theologie und arbeitet als Redakteur bei der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn.
Engländer feiern zu Weihnachten fröhlich Geburtstag – den wichtigsten von allen.
Ich bin katholisch. Mein Weihnachten sollte klar sein. O du fröhliche. Papstmesse. In dulci jubilo. Stille Nacht, immer so gemacht, seit 1818. Ich will ja auch gar nicht widerwillig sein oder über Gebühr bockig. Doch ich fürchte, irgendwann ist irgendwas in mir gestorben an diesem Geburts-Tag. War es das Marzipan Anfang September? Das klotzblöde Hohoho im Radio? Die Null-Prozent-Weihnachtsfinanzierung mit extra breiten Winterreifen schon zum Auftakt der Herbstferien? Süßer die Kassen nie klingeln wohnt hier nicht mehr. Haut mir ab mit eurer Zuckerwatte, euren Youtube-Filmchen und dem Christkind, gebettet ins Amazon-Paket mit Plastikdämmung. Hier unterschreiben.
Zum Glück habe ich einen Rettungsanker gefunden. Falsch: zwei eigentlich. Irgendwann kurz nach 2000 muss das gewesen sein. Ich nenne sie seitdem meine beiden Zündstufen auf dem Weg zum Heiligabend. Und beide sind englisch, ziemlich englisch sogar. Die erste Zündstufe findet etwa Mitte Dezember statt und heißt „Festival of Nine Lessons and Carols“. Ein liturgisches Highlight: Bei diesem traditionellen Adventsgottesdienst wechseln neun Schriftlesungen aus dem Alten und Neuen Testament ab mit den schönen englischen Weihnachtsliedern, die aus vollem Herzen mitgesungen werden. Diese Tradition wird 2018 genau 100 Jahre alt. War die Idee, die Männer aus der Kneipe zu locken mit einer neuen, gesangsbetonten Form der Liturgie, die sogar auf Moralpredigten verzichtet? Oder war es ein akademischer Spleen, entsprungen einem professoralen Hirn des ehrwürdigen King’s College in Cambridge? Sei’s drum – heute ist es eine seit 1918 weltweit von der BBC übertragene Tradition, die Engländer überall auf der Welt über die Frequenzen des Staatssenders empfangen können – ob im tiefsten Afrika oder mitten auf Nordpol-Expedition.
Ich selbst warte nicht auf das BBC-Original aus Cambridge, sondern feiere mit der lokalen anglikanischen Gemeinde in Bonn, deren Chor sich größte Mühe gibt mit der Auswahl anspruchsvoller Lieder und ihrer Performance. Der Funke springt über, und eine glückliche Feiergemeinde bleibt hinterher noch bei Mince-Pie (Süßgebäck) und Glühwein zusammen. Die Bonner anglikanische Gemeinde hat kürzlich ihr 175-Jahr-Jubiläum gefeiert – denn ihre Wurzeln sind weit älter als Nachkriegsbesatzung und Bundeshauptstadt. Sie sind literarischer und touristischer Art. Am Anfang stand die Rheinromantik.
Und das kam so: Die Erfindung der Dampfmaschine hatte im ausgehenden 18. Jahrhundert die Grundlage für die Entwicklung von Massentransportmitteln gelegt. Dampfschiff und Eisenbahn eröffneten die Ära des Tourismus. Die Rheinromantik, kräftig befördert durch die „Rheinreise“ von 1835, den ersten Reiseführer von Karl Baedeker (1801–1859), brachte damals zahlreiche Briten (teils dauerhaft) nach Bonn. „Kings and governments may err, but never Mr Baedeker“, so hieß es: Könige und Regierungen können sich irren, aber niemals Herr Baedeker.
(Die Anglikaner, ganz grob gesagt eine Zwischenform zwischen Katholizismus und Protestantismus, sind vor allem in England, dem Commonwealth sowie in früheren britischen Kolonien beheimatet. Die anglikanische Kirche entstand, als sich König Heinrich VIII. im Streit um seine Ehescheidung von Rom lossagte und eine englische Staatskirche gründete – mit sich selbst als Oberhaupt. Nachdem die beiden Weltkriege und damit die deutsch-britische Kriegsgegnerschaft die Gemeinde schwächten, kamen in der britischen Besatzungszeit und der „Bonner Republik“ Botschafts- und Militärangehörige sowie Journalisten neu hinzu. Traditionell enge Beziehungen gibt es bereits seit den 1870er-Jahren zur altkatholischen Kirche, deren Bischof in Bonn ansässig ist. Die anglikanische Gemeinde heute ist international bunt gemischt. Viele sind mit einem deutschen Partner verheiratet, manche auch beruflich hier. Es gibt Mitglieder aus Indien, Taiwan, Jamaika, Wales und Schottland. Hinzu kommen einige anglophile Deutsche und solche, die ihrer eigentlichen Gemeinde den Rücken gekehrt haben.)
Vor allem in der Adventszeit gibt es gute Gelegenheiten, anglikanisches Leben kennenzulernen – etwa beim traditionellen Weihnachtsbasar mit britischen Lebensmitteln wie Christmas Pudding, Chutneys und Currys, selbst gemachten Marmeladen, Knallbonbons („Christmas Crackers“), mit englischen Büchern, Weihnachtskarten und Selbstgenähtem. Ich liebe Skurriles – vor allem, wenn es das, was ich ohnehin gut finde, durch neue Facetten bereichert. Und das trifft noch mehr auf meine „zweite Zündstufe“ zu.
Eine Kollegin nahm mich vor vielen Jahren mit zu einem Konzert einer deutschen Folkband, das immer am Abend des 23. Dezember stattfindet und überschrieben ist mit „Weihnachts- und Segenslieder aus dem Alten England“. „Die englische Weihnachtstradition ist nicht so schwer und ernst wie die deutsche“, meint der Folkmusiker Claus von Weiß. „Und sie hat nicht diesen Depri-Touch, wie das bei uns manchmal der Fall ist. Da wird kräftig Geburtstag gefeiert – und zwar der wichtigste von allen.“ Diese weihnachtliche Fröhlichkeit zieht von Weiß, im richtigen Leben mittlerweile Berufsschulpfarrer im Ruhestand, und seine beiden Mitstreiter von „Morris Open“ seit Jahrzehnten an. Mit seinen mal schrägen, mal freudestrahlenden, mal stillen „Christmas Carols“, mit englischen Weihnachtstänzen, Segensliedern und Aventüren nimmt das Trio das deutsche Publikum mit auf eine adventliche Brauchtumsreise. Die gesungenen Überlieferungen erzählen von Prahlern, Bösewichten und Magiern, von skurrilen Legenden und Gebräuchen. Etwa im Lied „Cherry Tree Carol“, das von der schwangeren Maria auf dem Esel berichtet, die – von einem übellaunigen Josef geführt – durch einen Obstgarten reitet und Lust auf frische Kirschen bekommt. Doch Josef weist ihre Bitte barsch zurück, unter Verweis auf sein Zipperlein. Solle sich doch der darum kümmern, der ihr das Kind angehängt habe. Gesagt, getan: Das noch ungeborene Jesuskind bittet Gottvater, seiner lieben Mutter das Kernobst zu beschaffen – und ein Windstoß biegt den höchsten Ast des höchsten Baums bis zu ihr herunter. Gern erzählt und singt von Weiß auch die Geschichte von „Herod and the Cock“. Demnach aß der römische Statthalter Herodes gerade ein halbes Hähnchen, als er von den drei Weisen aus dem Morgenland die „Frohe Botschaft“ von der Geburt eines neuen Königs erhielt. „Wenn das wahr ist, dann soll dieser Hahn hier aufstehen und wieder zu krähen anfangen“, soll er entsetzt ausgerufen haben – und der Hahn „schüttelte die dicke Soße ab und krähte“. Solcherlei Sagen und Gestalten gibt es ungezählte, und ebenso viele uralte Gebräuche, die – teils noch heidnischen Ursprungs – die britische Advents- und Weihnachtszeit bereichern.
Dazu gehören auch die Wassail-Sänger. Sie ziehen mit einer leeren Schüssel von Haus zu Haus und singen gegen heiße oder kalte Starkgetränke und einen kleinen Imbiss Segenslieder für das „Haus“, also für den Hausherrn, seine Frau und das ganze Gesinde. Das hat einen durchaus sozialen Hintergrund: Im Mittelalter wurden viele Handwerker in der Winterzeit arbeitslos und versuchten, sich mit Naturalspenden oder dem „wassail penny“ durchzuschlagen. Oder das sogenannte „Morris Dancing“, jene ausgelassenen Tänze am „Boxing Day“, dem zweiten Weihnachtstag. Immer wieder versuchten Fürsten und Regierungen, dem Feierbrauch durch Verbote beizukommen; so etwa der Puritaner Oliver Cromwell. Dennoch: Bis heute können am Boxing Day durchaus „die Luftschlangen ausgepackt werden“, so von Weiß. Eine vergleichsweise „heftige Fröhlichkeit“.
Doch die meisten Lieder und Bräuche bleiben nicht in der Schräge stehen. In ihnen steckt eine ursprüngliche, tiefe christliche Frömmigkeit. Etwa, wenn in „The Carnal and the Crane“ eine Krähe und ein Kranich in mehreren Strophen intensiv und sachkundig über die Theologie von Weihnachten, die Göttlichkeit Jesu und die Rolle Marias in der Heilsgeschichte disputieren. Oder wenn die Jungfrau Maria bei der Verkündigung des Engels vom Englischen in lupenreines Kirchenlatein wechselt und antwortet, sie sei die „ancilla domini“; und „secundum verbum tuum fiat mihi“ – ihr, der Magd des Herrn, geschehe also nach Seinem Wort. Jedes Weihnachtsprogramm von „Morris Open“ endet mit dem Freudenlied „Shepherds arise!“ (Steht auf, ihr Hirten). Dann legt auch von Weiß ein wenig von seiner missionarischen Zurückhaltung ab. „’Tschuldigung, dass ab und zu der Pfarrer in mir rauskommt“, sagt er dann: „Aber wenn Sie die Geschichte von Weihnachten nicht mehr so ganz drauf haben, dann schlagen Sie doch einfach im Buch zum Lied nach oder gehen in eine der großen Kirchen. Die helfen Ihnen gerne weiter.“ So mache ich es. Nach diesem Konzert am Abend des 23., bei dem schottisches Christmas Ale serviert wird, kann Weihnachten werden. Es steht nun buchstäblich vor der Tür; riecht schon nach Stall, nach Weihrauch, Ochs und Esel und nicht nach Duftkerze und Verpackungsmaterial. Jetzt darf auch der Baum ins Wohnzimmer und sich noch ein bisschen aushängen, bevor er am Heiligabend geschmückt wird.
Ich bleibe katholisch. War nie die Frage. Aber zu Weihnachten nehme ich mir meine religiöse Bastelstunde: Das Christkind war ein Engländer – und es hatte eine Menge kurioser Gäste. So viel habe ich bis heute verstanden.