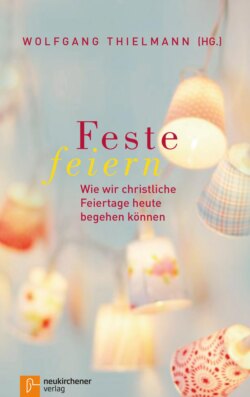Читать книгу Feste feiern - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGeleitwort
Heinrich Bedford-Strohm, geboren 1960, ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Foto © ELKB-Rost
Ende Oktober 2017 kam in Deutschland eine Stimmung auf, wie sie sonst nur zu Weihnachten und Ostern zu spüren ist. Der bundesweite Sonderfeiertag zum Reformationstag unterbrach den Alltag. Viele Menschen freuten sich über einen geschenkten freien Tag. Aber viele nutzten ihn auch, um den Anlass für diesen freien Tag mitzufeiern. Lange Schlangen vor den Kirchen bildeten sich überall in Deutschland. Niemand hatte diesen Andrang erwartet, darauf zu hoffen gewagt. Natürlich war das ein ganz besonderer Feiertag. Aber dass an Feiertagen die Kirchen voll sind, kennen wir auch sonst. In den vergangenen Jahren waren die Gottesdienste zu Weihnachten und Ostern regelmäßig gut besucht. Ist das ein neuer Trend? Sicher ist in jedem Fall: Kirchliche Festtage sind ganz offensichtlich tiefer im gesellschaftlichen Gedächtnis verankert, als es der immer wieder angestimmte Abgesang auf die verschwindende christliche Prägung unseres Landes hätte erwarten lassen. Ob die Sehnsucht nach heilsamer Unterbrechung eines immer rastloser werdenden Lebens nicht in Wahrheit wächst? Provozieren die Härten einer auf volle Verfügbarkeit des Menschen setzenden globalisierten und digitalisierten Ökonomie nicht geradezu eine Gegenreaktion? Das Anliegen des vorliegenden Buches, den Spuren der christlichen Festtage im persönlichen und gesellschaftlichen Leben nachzugehen, ist also hochaktuell.
Die jüdisch-christliche Tradition hat eine kostbare soziale und kulturelle Errungenschaft hervorgebracht: „Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleichwie du“ (5. Mose 5, 13–14). Dieses soziale Schutzgebot hat Eingang in die Sozialkultur unserer Gesellschaft gefunden. Es ist eine wertvolle soziale und kulturelle Errungenschaft, die es zu schützen gilt. Sonn- und Feiertage gehören zu den fundamentalen Beiträgen des Christentums zur Kultur unserer Gesellschaft. In ihrer humanisierenden Funktion sind sie eine Chance für eine Gesellschaft im Wandel und dienen der Gesellschaft im Ganzen. Sie sind kein Überbleibsel einer vergangenen Epoche. Sonn- und Feiertage geben dem Zeitempfinden einen Rhythmus und gewähren einen regelmäßigen Freiraum. Auf diese Weise verhelfen sie zu dem notwendigen Abstand vom Alltag. Sie bieten einen Raum, sich die wichtigen und entscheidenden Fragen bewusst zu machen: Wer bin ich? Wohin gehe ich? Aus welcher Quelle lebe ich? Wofür lohnt es sich zu leben? Sie bieten ebenso Raum für herausgehobene, festlich gestaltete Begegnungen mit anderen.
Vor diesem Hintergrund bin ich sehr dankbar für das gemeinsame Engagement von Kirchen und Gewerkschaften für den Sonntagsschutz in Deutschland. Gerade in den Feiertagen wird die lebensdienliche und soziale Dimension unserer religiösen Tradition greifbar. Sonn- und Feiertagsruhe markieren eine wesentliche Grundlage für die Rekreationsmöglichkeiten des Menschen und zugleich für ein gelingendes soziales Zusammenleben, so urteilte das Bundesverfassungsgericht 2009. Weiter heißt es: „Die Gewährleistung von Tagen der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung ist darauf ausgerichtet, den Grundrechtsschutz – auch im Sinne eines Grundrechtsvoraussetzungsschutzes – zu stärken, und konkretisiert insofern die aus den jeweils einschlägigen Grundrechten folgenden staatlichen Schutzpflichten.“ Zu den großen Gefahren einer sich immer schneller drehenden Wirtschaft gehört, dass die Ökonomie von der Dienerin zur Herrin wird. Nicht der Mensch ist für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft ist für den Menschen da. Deswegen haben die Menschen einen Anspruch auf verlässliche Zeiten, in denen sie nicht der Wirtschaft dienen müssen. Wir haben in Deutschland viel materiellen Wohlstand erreicht. Dafür können wir dankbar sein. Und es ist wichtig, dass wir daran arbeiten, dass dieser materielle Wohlstand auch wirklich allen zugutekommt. Aber als Land insgesamt ist die Steigerung des materiellen Wohlstands nicht mehr das Wichtigste. Das viel wichtigere Ziel heute ist neben einer gerechteren Verteilung die Steigerung des Beziehungswohlstands. Die Menschen brauchen Zeit füreinander, sodass die sozialen Beziehungen neue Kraft bekommen. Niemand muss sich wundern, wenn Familien auseinanderbrechen, weil es keine Tage mehr gibt, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass alle Zeit haben. Der Sonntag ist eine solche Zeit und er soll es bleiben.
Ich danke Wolfgang Thielmann für die Initiative zu diesem Buch im Jahr 2018, in dem die EKD auf die Bedeutung der christlichen Feiertagskultur hinweisen will. Den Autorinnen und Autoren gilt mein besonderer Dank. Ihre Beiträge zeigen, wie sehr die christliche Feiertagskultur die Menschen und ihr Miteinander in unserem Land bis auf den heutigen Tag prägt.
Vorwort:
Warum feiern wir?
Wolfgang Thielmann, geboren 1954,
ist Journalist, Publizist und Pastor.
Bis heute kann ich kaum beschreiben, was es ausmachte. Für ein paar Stunden tauchten wir in eine andere Welt ein. Mit einer Gruppe Journalisten besuchte ich eine Siedlung in der Nähe der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Ein christliches Hilfswerk hatte sie übernommen und für behinderte Frauen, Männer und Kinder eingerichtet. Die Siedlung war in einen flachen See gebaut. Häuser und breite Laufgänge dazwischen standen auf Stelzen, ohne Geländer. Ab und zu sprangen Kinder ins Wasser. Sie konnten stehen. Aber ich mochte mir nicht vorstellen, wie sauber das Wasser war. Auf der Veranda vor einem Haus bereiteten Vater, Mutter und eine blinde Tochter von vielleicht fünfzehn Jahren das Mittagessen zu. Von einem quer einmündenden Laufgang kam uns ein Mann entgegen. Ein Oberkörper, der auf einem Skateboard saß und sich mit den Händen abstieß. Er lachte uns aus vollem Hals entgegen. Die wenigsten, die uns begegneten, konnten ein für unsere Vorstellungen normales Leben führen. Ihnen fehlten Glieder, sie trugen riesige Narben, sie konnten nur einfachste Dinge tun.
Von den dreien, die das Mittagessen herrichteten, ging Ruhe aus. Freundlich lächelten sie der Journalistengruppe zu.
Wohin wir kamen, die Leute hielten inne und wandten sich uns zu, immer mit einem Lächeln, einem Gruß, ein paar Worten, deren Bedeutung wir nicht verstanden, aber deren Sinn uns sofort aufging: Freundlichkeit, die keine Sprachbarrieren kennt. Willkommenskultur zu erfahren, ist ein technisches Wort für das anrührendste Gefühl, das du haben kannst. Sie freuten sich auf eine fröhliche und zugleich gelassene Art, dass wir da waren. Das Elend, das wir sahen und über das wir berichten sollten, spielte keine Hauptrolle mehr. Wichtig war, dass wir zu Besuch kamen. Und wie wir empfangen wurden.
Das zu erleben, verzauberte uns. Klaus, der Fotograf, der später eine Sportlerin managte. Bernhard, der Stiernacken aus Augsburg, der schon als Kriegsberichterstatter in Afrika gearbeitet hatte. Beat, der Wirtschaftsjournalist aus Zürich. Leute, die jeder Situation gewachsen waren. Die hier traf uns ins Herz. Sie nahm uns gefangen. Wir waren gekommen, um Material zu sammeln für Reportagen aus der Dritten Welt und um Leuten zuhause zu zeigen, wo und wie sie helfen können, damit Menschen etwas bekommen, was ihnen fehlt. Hier bekamen wir geschenkt, was uns fehlte. Wir unterbrachen den Alltag der Leute und sie unseren. Wir gingen über die Bohlen an den schlichten Häusern vorbei. Immer begegnete uns Freundlichkeit. Das Willkommen trug uns durch die Siedlung.
Im Zentrum des Dorfs stand eine Kirche. Die Regie hatte uns so eingeteilt, dass wir zur Gottesdienstfeier eintrafen. Hinter uns hatte sich eine Schlange gebildet und zog in die Kirche ein, als wir Platz genommen hatten. Schwatzend, rufend und singend feierte die Gemeinde die Liturgie mit. Wir verstanden nichts. Aber wir bekamen alles mit. Laut lobten die Leute Gott, inbrünstig fielen sie ins Gebet ein. Lebhaft bestätigen sie jeden Satz des Predigers.
Es war nicht von dieser Welt. Ein paar Momente lang waren Grenzen aufgehoben und wir alle Mitglieder derselben Familie. Und es war richtig, dass der Besuch mit einer Gottesdienstfeier endete.
Leider fehlte etwas, das die Begegnung vollends zum Fest werden ließ: Der Plan verhinderte, dass wir uns zusammen an einen Tisch setzten. Wir wurden schon in einer Mädchenschule ein paar Kilometer erwartet. Es gab daher bloß einen kleinen Imbiss für uns. Wie gern hätten wir mit den Leuten draußen geteilt, hätten Zeit mit ihnen verbracht. Wie gern wären wir länger mit ihnen zusammen gewesen.
Winkend verabschiedete uns die Gemeinde. Wir liefen zurück über die Bohlengänge zu unserem Boot. Am Ende hielt Bernhard, der Kriegsberichterstatter an. Und bat mich, zu beten. Für die Leute hier, aber auch für uns. „Das war ein Fest“, sagte er. „Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“
Mir ist an diesem Fast-Fest klar geworden, warum wir feiern. Vielleicht liegt darin der Sinn der Feste, dass sie uns wegtragen, dass sie uns entführen und anders wieder zurückbringen, weil wir zusammen gelacht und geweint und Erinnerungen erschaffen haben, die uns stark machen. Feste entführen uns aus dem Erwartbaren, aus dem Gewohnten. Feste holen uns auch heraus aus der Angst, nicht angenommen zu sein, unseren Platz erst erkämpfen oder verdienen zu müssen. Das eint Feiern von Weihnachten bis zum Christopher Street Day, vom Kindergeburtstag bis zur Eisernen Hochzeit. Oder bis zur Aussegnung am Ende des Lebens. Deshalb geben sie uns Kraft.
Davon handelt dieses Buch. Ich habe Freunde gebeten aufzuschreiben, wie sie feiern, warum sie es tun, was sie dabei beobachten und was ihnen die Feste geben. Es ist eine Sammlung voller Fantasie, voller Geheimnisse und voller Tradition geworden. Ich wünsche mir, dass sie Leserinnen und Lesern neue Ideen gibt, dass die Autoren Anregungen vermitteln, wie man feiern kann, wie man alte und weniger alte Traditionen aufgreifen kann und sie mit eigenen Ideen anreichert, sodass sie uns in eine neue Zeit begleiten können: In verschiedenen Generationen, mit Familie und ohne. Wie man Kräfte gewinnt, indem man in Menschen investiert, sich trifft und Zeit miteinander verbringt, um zu entdecken, wie viel Kapital im Leben der Menschen liegt, mit denen zusammen wir feiern. Dazu habe ich für jedes Fest eine Einführung geschrieben.
Weil Feste uns Kraft geben, haben Kinder und Erwachsene zum Beispiel den Wunsch, dass Weihnachten nicht aufhört. Deshalb reisen sie in die Weihnachtsdörfer vom finnischen Rovaniemi in Lappland, in der Nähe des Polarkreises, bis ins Erzgebirge mit seinen Schwibbögen und Pyramiden oder das Käthe-Kruse-Weihnachtsdorf in Rothenburg ob der Tauber. Oder ins „Bronner’s Christmas Wonderland“ in Frankenmuth nördlich von Detroit mit 8 000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 1 500 Parkplätzen. Dessen 2008 gestorbener Chef Wallace Bronner sagte: „Das Wichtigste ist, dass wir unsere Herzen dekorieren.“
Deko ohne Herz hat der Schriftsteller Heinrich Böll beschrieben. In seiner Satire „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ prangerte er eigentlich die fehlende Selbstkritik seiner katholischen Kirche im Blick auf die Nachkriegszeit an. Schauplatz ist die Weihnachtszeit. Die schrullige Tante Milla verhindert das Abschmücken des Weihnachtsbaums mit unausgesetztem Schreien. Die Ärzte können ihr nicht helfen. Dann löst ihr Mann, Onkel Franz, das Problem und verordnet ihr und der übrigen Familie die tägliche Feier des Heiligen Abends über zwei Jahre lang. Die „Tannenbaumtherapie“ hilft ihr. Der Engel auf der Tannenspitze flüstert ohne Pause „Frieden, Frieden, Frieden“ und schreddert damit die Familie. Deren Mitglieder kriegen Tobsuchtsanfälle, sie wandern nach Afrika aus, wechseln vom Katholizismus zum Kommunismus. Schließlich lassen sie sich durch arbeitslose Schauspieler und endlich durch Wachspuppen vertreten. Als Einzige geht Tante Milla unversehrt aus der Geschichte hervor. Man kann die Satire als vergifteten Wunsch nach ehrlichen, unverstellten Feiern lesen.
Denn auch Ehrlichkeit gehört dazu. Feste verdecken keine Unversöhnlichkeit und keinen Hass. Sie schmecken falsch, wenn wir Unversöhnlichkeiten mitnehmen und Streit anhäufen. Sie mahnen uns, unser Leben aufzuräumen und Frieden zu machen mit Menschen und mit Zuständen. Ohne Feste könnten wir sie länger mit uns herumschleppen. Und Feste machen uns stark, gegen die Unaufgeräumtheit zu kämpfen.
Die meisten Feste, die wir feiern, haben mit dem Christentum zu tun, das den Kontinent eineinhalbtausend Jahre geprägt hat. Oft hat sich die Kreativität der Menschen gegen die Kirche durchgesetzt. Das anschauliche Weihnachten hat das ältere Ostern entthront, das eigentliche Hauptfest der Christenheit. Die katholische Kirche strich 1969 den Valentinstag aus ihrem Festkalender. Aber eine Koalition aus Liebenden und Floristen hat ihn zu neuem Leben erweckt. Selbst Halloween, der Vorabend von Allerheiligen, mit seinen Gruselmasken weckt Fantasie und treibt das Schreckliche aus, indem wir es nachvollziehen und darüber lachen, wenn wir zusammen sind. Die Kirchen waren so klug, ihren Widerstand dagegen aufzugeben, besonders die evangelische, die Konkurrenz zum Reformationsfest am gleichen Tag witterte. Christen fürchten mitunter, dass der Kommerz, vor allem zu Weihnachten, die Botschaft der Geschichte vom Stall in Bethlehem verdeckt. Deshalb kritisieren sie es, wenn die Supermärkte schon im September Lebkuchen in die Regale stellen. Oder sie protestieren, wenn Atheisten das Tanzverbot am Karfreitag durchbrechen wollen. Doch die Feiern des Christentums sind tief im kulturellen Gedächtnis verankert und unverwüstlich. Eine Mehrheit der Deutschen findet das Tanzverbot richtig.
Neue Generationen feiern aber anders als die alten, weil ihr Leben anders geworden ist. Dieses Buch macht den Reichtum sichtbar, der darin liegt. Es will alte und neue Festtage vorstellen und die, die sie heute begehen. Die sich in die Tradition stellen, indem sie sie aufnehmen und weiterentwickeln, die Neues entdecken, den Strang der Überlieferung vielleicht in Fasern teilen und sie anders wieder zusammenflechten.
Was Fachleute heute das „Kirchenjahr“ nennen, hat sich über Jahrhunderte entwickelt und verändert sich weiter. Das heute katholische Fronleichnamsfest wird seit dem 13. Jahrhundert begangen. Die Trauertage vor der Adventszeit stammen aus dem Mittelalter. 1952 kam der Volkstrauertag dazu.
Öffentliche Feiertage in Deutschland kommen bis auf den 1. Mai und den 3. Oktober aus dem Christentum. Bayern liegt mit 14 gesetzlichen Feiertagen an der Spitze, kein Bundesland hat weniger als neun, und acht feiern alle Länder gemeinsam. Zudem ist Deutschland das einzige Land der Welt, in dem die Feiern und der Sonntag, also die Feier des Wochenbeginns, in der Verfassung verankert sind. Ihr Schutz gelangte aus der Weimarer Reichsverfassung ins Grundgesetz. Der alte Begriff aus dem Text von Weimar trifft es genau, wenn er den Sinn der geschützten Tage beschreibt: Sie dienen der „Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“. Nichts aushalten, nichts aussitzen, sondern aufstehen und feiern. Ganz besonders müssen die Kirchen wachhalten, was Feste bedeuten und was wir an ihnen haben.
Und das Essen gehört dazu. Juden feiern viele ihrer großen Feste am Familientisch, Muslime genauso. Christen gehen in die Kirche. Doch sie setzen sich gern wie alle anderen zusammen und essen. Das kommt auch bei ihnen aus der Religion. Zum Anrührendsten, was über Jesus berichtet wird, gehört, dass er sich bei Ausgestoßenen einlud, an ihren Tisch kam und sich von ihnen bekochen und bewirten ließ. In seinen Gleichniserzählungen kommt, wenn es wirklich wichtig wird, oft ein Festmahl vor.
Die Referenzgeschichte dazu steht schon am Beginn der Hebräischen Bibel, im zweiten Buch Mose. Noch bevor Mose allein auf den Berg steigt, um die steinernen Gesetzestafeln in Empfang zu nehmen, erklimmen die siebzig Ältesten Israels mit ihm gemeinsam die Anhöhe und sehen Gott. Ausnahmsweise dürfen sie ihn in Augenschein nehmen, ohne dass sie vergehen, wie die Erzählungen der Alten androhen. Und sie erblicken einen Moment von überirdischer Schönheit. Nachher können sie nicht mehr erzählen, wie Gott ausgesehen hat. Nur die Umgebung haben sie noch in Erinnerung: „Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist.“
Was kann man danach noch tun, wenn man Gott gesehen hat, wenn man dem Geheimnis des Lebens auf der Spur war? Was die Ältesten taten, hat allen Feiern, die wir begehen, ihr Vorbild gegeben: „Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie.“
Bonn, im März 2018
Wolfgang Thielmann