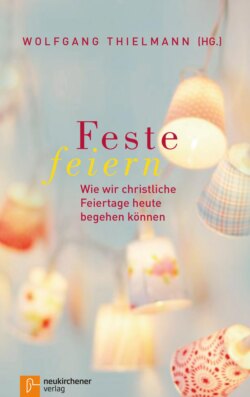Читать книгу Feste feiern - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAdvent
Unsere Feste sind ein Mix. Die Kirche hat einen Anteil daran. Und die Tradition, in der wir aufgewachsen sind und die wir weitertragen. Das nennt man Brauchtum. Und unser Erfinderinnen- und Erfindergeist. Mit dem greifen wir Eindrücke aus der Kindheit und später auf und kombinieren sie mit neuen Ideen, die wir mitbekommen oder die uns selbst einfallen. Wenn es gut läuft, schaffen alle drei zusammen Feiern, in denen wir zuhause sind. Und streifen Fremdheit und Langeweile ab und damit die Teile der Feste, die uns hoffen ließen oder jetzt noch lassen, dass das Fest schnell vorübergeht. Manchmal muss man aber einen unangenehmen Teil ertragen, der anderen gefällt.
In meiner Kindheit war das meine Großtante. Wir Kinder mochten sie. Meine Mutter freute sich darauf, dass sie wieder fuhr. Denn solange sie uns besuchte, fühlte sich meine Mutter im eigenen Haus nicht zuhause. Die Großtante, selbst kinderlos, wusste, wie man Kinder erzieht, und sprach ausgiebig davon. Meine Mutter fühlte sich unter Dauerkritik, erzählte sie später.
Es gibt beim Feiern keine ein für alle Mal feststehenden Bestandteile. Es gab eine Zeit, als noch niemand zu Weihnachten „O du fröhliche“ sang oder „Stille Nacht“, weil die Lieder noch nicht geschrieben waren. Vielleicht werden sie eines Tages abgelöst, weil uns andere mehr zu Herzen gehen.
Und immer hat das Brauchtum zurückgewirkt bis in die Kirche. Der letzte Riesenerfolg beim Rückwirken war der Adventskranz. Er ist kein heidnisches Symbol, das wieder in die Kirche eingewandert ist. Solche gefälschten Herkunftsgeschichten verdanken wir der Nazi-Propaganda. Sie wollte den großen Festen „germanische“ oder „nordische“ Wurzeln unterschieben: Der Weihnachtsbaum zum Beispiel habe aus vorchristlichen Zeiten überlebt. Das ist Unsinn. Die ersten Weihnachtsbäume sind im christlichen 16. Jahrhundert im hessischen Stockstadt und im elsässischen Straßburg bezeugt. Was an Weihnachten nordisch ist, kommt von Ikea.
Auch der Adventskranz ist kein vorchristliches Radsymbol, das für die Unendlichkeit des Lebens steht, wie es manchmal heißt. Erfunden hat ihn Johann Hinrich Wichern, ein umtriebiger Student der evangelischen Theologie. Vom sozialen Elend seiner Zeit gepackt, übernahm er 25-jährig 1833 in Horn vor den Toren Hamburgs, da, wo heute der Autobauer BMW Pferderennen veranstaltet, ein altes Bauernanwesen, das Rauhe Haus, und richtete ein „Rettungshaus“ für Jugendliche aus dem sozialen Brennpunkt Hamburg-St. Georg ein, da, wo heute der Hauptbahnhof steht.
Wicherns Erziehungsprinzip war revolutionär: Zehn bis zwölf Zöglinge leben mit einem Betreuer zusammen, der für sie wie ein „älterer Bruder“ sein soll. Aus diesen Brüdern entsteht später die erste evangelische Diakonenschaft. Schon im Folgejahr nimmt Wichern ein zweites Haus in Gebrauch. Die Betreuung umfasst Schule und Vorbereitung auf eine handwerkliche Lehre.
Um die Jungen für die christliche Leitkultur zu gewinnen, macht Wichern im Advent „Kerzenandachten“. Jeden Tag wird eine weitere entzündet, rot an normalen Tagen, eine dickere weiße an den Sonntagen. 1839 steckt er die Kerzen auf einen Holzreif, den er an einen Kronleuchter hängt. Seine Jungen schmücken den nackten Reifen später mit Tannenzweigen.
Wichern blieb seinem Rauhen Haus verbunden, auch wenn er bald auf Reisen ging, um die überall aufbrechenden sozialen Einrichtungen der evangelischen Kirchen zu vernetzen. Dadurch gab er 1848 in Wittenberg den Anstoß zur Gründung des heutigen Diakonischen Werks mit 450 000 Beschäftigten. Und inspirierte 49 Jahre später Lorenz Werthmann, den ebenfalls umtriebigen Commissarius des (katholischen) Freiburger Erzbischofs Thomas Nörber. Werthmann rief den Caritasverband für das katholische Deutschland ins Leben. Beide sind heute die größten Arbeitgeber in Deutschland nach dem Staat.
Wichern trat, immer noch ohne theologischen Abschluss, 1857 als Dezernent für das Strafanstalts- und Armenwesen ins preußische Innenministerium und zugleich in den Berliner Oberkirchenrat ein. Denn damals wurde die Kirche noch beim Staat verwaltet.
Nach Wicherns Tod 1881 ging der Adventskranz auf seinen Siegeszug gen Süden. Um 1925 soll er, inzwischen mit nur noch vier Kerzen, die Konfessionsgrenze übersprungen haben und in einer katholischen Kirche in Köln gesichtet worden sein. Zehn Jahre später wurden erste Kränze für den Hausgebrauch kirchlich geweiht. In orthodoxen Familien hat der Kranz übrigens sechs Kerzen – weil da die Adventszeit zwei Wochen länger dauert.
Man kann daraus lernen, dass die Kirchen einander viel näher sind, als man vermutet. Und dass das, was unveränderlich festzustehen schein, gar nicht so unveränderlich ist. Vielleicht erfindet eine der Leserinnen dieser Zeilen gerade einen Brauch, den wir in zwei Generationen in ganz Europa übernommen haben.
Alexander Brüggemann stellt ein Beispiel vor, wie er seine Adventszeit neu zusammengestellt hat. Mit Anleihen aus einer anderen Kirche.
Mischen impossible? Von wegen.