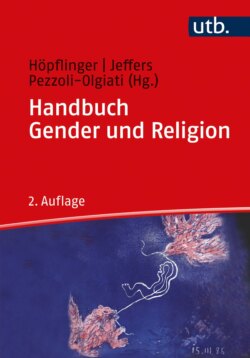Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 78
2 Eine christliche Perspektive auf Ökofeminismus in religiösen Traditionen
ОглавлениеObwohl der Ökofeminismus in vielen religiösen Traditionen einen Beitrag leistet, haben vor allem christliche Ökofeminist*innen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis einen bedeutenden Einfluss ausgeübt. Primavesi,15 Radford Ruether16 und Gebara standen im Vordergrund des ökofeministischen Denkens in religiösen Traditionen, insbesondere im Christentum. Radford Ruethers Analyse konzentriert sich auf die Mechanismen von Ungleichheit und Unterdrückung, die auf kulturellsymbolischer und sozio-ökonomischer Ebene existieren und sich in der Art und Weise widerspiegeln, wie die Umwelt und der Status von Frauen berücksichtigt und behandelt wurden. Verinnerlichte Dichotomien findet man im Christentum in den fortdauernden Assoziationen Frau/Körper und Mann/Geist. Auch Verbindungen zwischen Ökologie, Feminismus sowie ihrer jeweiligen Aneignung und Beherrschung durch patriarchale Systeme werden erforscht. Die Autorin betont die Rolle von Religion in diesem Wechselspiel, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, als eine Kraft der Herrschaft und der Befreiung.17 Sie versucht, Quellen zu finden, die die frauenähnlichen Eigenschaften der Natur aufzeigen und die Missachtung der Natur durch die westliche koloniale Denkweise bekämpfen.18
Ivone Gebara, eine katholische Theologin aus Brasilien, nähert sich diesen Fragen im Christentum aus einer trinitarischen Perspektive: Sie schlägt eine Rekonstruktion der Trinität im Licht der ökofeministischen Theologie vor, um darzulegen, dass ein trinitarisches Modell wertvoller sein kann als das traditionelle westliche Verständnis. Sie vertritt ein Weltbild, das auf einer ganzheitlichen Kosmologie beruht, die sich um hierarchiefreie Beziehungen dreht, nicht nur zwischen Menschen, sondern der gesamten Schöpfung. Ihre Beschreibung der Trinität als Ausdruck der Interrelationalität aller Dinge öffnet das Konzept für eine ganzheitlichere, weniger anthropozentrische Spiritualität.
Die Tragweite dieses Modells ist insofern erheblich, als es das Konzept des Menschen in Bezug auf die gesamte Schöpfung nicht als eine binäre Beziehung, sondern neu als ein integriertes Ganzes auffasst, in dem alles Leben auf einer nichthierarchischen, nicht-patriarchalen Grundlage bewertet wird. Sie sagt: »Alle Menschen bilden die großartige und vielfältige menschliche Symphonie, in der wiederum Vielfalt und Einheit konstitutiver Ausdruck des einzigen Lebensprozesses sind, der uns alle trägt.«19
Ferner, wenn wir die Rolle dieser inneren Vielfalt als Teil unserer eigenen trinitarischen Struktur ernst nehmen, dann werde es unmöglich, irgendeine Vorstellung von Hierarchie, von Über- und Unterlegenheit unter den menschlichen Kulturen zu rechtfertigen. Gebara beschreibt diese Beziehung als wesentlich kosmisch, eine Gemeinschaft, die schlicht und grundsätzlich aufeinander angewiesen ist. Darauf aufbauend hat Gebaras Aufruf zur Theologie praktische Auswirkungen: Diese aktualisierte Auffassung der Trinität mache es unmöglich, solch negative Facetten der menschlichen Natur wie »Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Gewalt und Sexismus«20 zu verkörpern.
Durch dieses neue Paradigma seien wir in der Lage, einen veränderten Sinn für Staatsbürgerschaft zu entwickeln, ohne unsere nationalen Zugehörigkeiten, die integraler Bestandteil unseres individuellen Charakters und unserer Erfahrung seien, verleugnen zu müssen.21 Darüber hinaus seien unsere persönlichen Identitäten untrennbar mit den Identitäten aller, die leben und gelebt haben, mit den Identitäten unserer Zeitgenoss*innen und unserer Vorfahr*innen verbunden. Die eigene persönliche Realität und Autonomie seien von den anderen abhängig. Deshalb sei unser eigenes Selbstverständnis trinitarisch, eine geheimnisvolle Vielfalt, und deshalb müssten wir eine Anthropologie in Betracht ziehen, in der wir alle als Erdbewohner*innen und kosmische Bürger*innen gesehen werden.22
In eine etwas anderen Richtung als Gebara gehen die einflussreichen Schriften des Passionisten Thomas Berry, dessen Fokus auf den kosmischen Christus und seine Immanenz einen Großteil des christlichen Ökofeminismus geprägt hat. Für ihn sind Geburt und Auferstehung Jesu beide mit dem System der Erderneuerung verbunden: Das Leben Christi wurde in den Lebenszyklus der Natur eingewoben.23