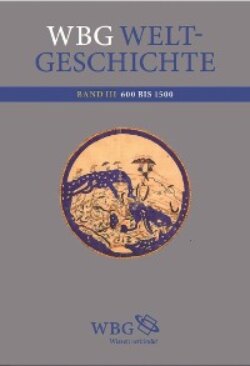Читать книгу wbg Weltgeschichte Bd. III - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Transversale der Oikumene – Indischer Ozean und Mittelmeer
ОглавлениеÜber den Zusammenhang der drei Kontinente des Mittelalters entschieden die Ost-West-Verbindungen zwischen China und Lateineuropa; obschon, mindestens zeitweise, noch Fernwege auf dem Lande zur Verfügung standen, verknüpften diese Antipoden besonders die Schiffe auf dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer. Viele Küstenstädte unterwegs wurden angesegelt, die ihrerseits über große Flussläufe und Straßen weiter auf andere Zentren verwiesen; mit den Waren und Menschen konnten so auch an vielen Stationen Ideen, technische Errungenschaften und Werke mustergültiger Schönheit aus der Fremde an Bord kommen. Da weder die Gegensätze der Religionen noch die Unterschiede der Lebensweisen die Suche nach Wissen, die Neugier auf das Überraschende und das Streben nach Besitz, Genuss oder Gewinn nachhaltig zu hindern vermochten, störten die Kommunikation der Menschen empfindlich nur Herrschaft und Gewalt. Dort, wo die Erdteile aneinanderstießen, am Schwarzen Meer und in der Levante, lag das Scharnier für das Gefüge der mittelalterlichen Welt; eine Schlüsselrolle kam insbesondere dem zu, der die Wasserwege zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean beherrschte, im Osten das Zweistromland und den Persischen Golf, im Westen den Nil und das Rote Meer.
Seewege und Landstraßen
Das hatte schon für die großen Reichsbildungen des Altertums gegolten; nachdem der Achaimenide Dareios I. die Herrschaft der Perser über Ägypten und die Kyrenaika wiederhergestellt hatte (522–520 v. Chr.), ließ er vom Nil zum Roten Meer einen Kanal bauen und den Seeweg von hier nach Indien erkunden, eroberte aber selbst um 518 das Tal des Indus. Seither verkehrten seine Schiffe regelmäßig im Persischen Golf. Der große Makedone Alexander tat es ihm als Eroberer Ägyptens (Gründung Alexandrias 331) und des Pandschab (327) nach. Von der Periode des Hellenismus bis über die Zeitenwende befuhren Inder die Straße von Hormus oder das „blaue Wasser“ bis zum Horn von Afrika, während gleichzeitig die Araber, wie vielleicht schon seit Jahrhunderten, nach Indien segelten und die Verbindung zum Mittelmeer schlugen. Den Römern versperrte zwar das Reich der Parther (250 v. Chr.–226 n. Chr.) vom Euphrat bis zum Indus den Landweg in den Osten, doch ermöglichte ihnen der Gewinn Alexandrias unter Augustus (30 v. Chr.) einen eigenen Verkehr mit Indien zu Wasser. Plinius skizzierte die Route zu den dortigen Häfen, und nach Strabon seien jährlich 120 ihrer Schiffe vom Roten Meer nach der Küste von Malabar (Westindien) aufgebrochen. Die Römer importierten exotische Tiere, wertvolle Steine, Hölzer und Elfenbein, chinesische Seide, Gewürze und Zucker, Baumwolle sowie Früchte des Subkontinents; als Gegengaben hatten sie wertvolle Metalle zu bieten, wie etwa Hortfunde goldener Münzen in Indien belegen. Im 3. Jahrhundert verlor der römische Handel an Bedeutung; von jetzt an bis ins 6. Jahrhundert wurden stattdessen die Griechen beziehungsweise Byzantiner aktiv. Da diesen die Sasaniden die Landstraßen in den Orient verschlossen, bedienten sie sich der Partnerschaft mit dem (seit ca. 330) christlichen Reich von Aksum (Äthiopien). Griechische Händler unterhielten auf diese Weise Geschäftsbeziehungen mit dem Jemen, mit Persien, Indien und Sri Lanka. Lange vor der Zeit Mohammeds hatten die Araber ihre führende Rolle im Indienhandel an die Sasaniden abgegeben. Persische beziehungsweise nestorianisch-christliche Kolonien säumten unter anderem die Küsten von Malabar und Sri Lanka. Vom 5. Jahrhundert an beobachteten chinesische Autoren die Handelstätigkeit der Perser, die damals mindestens bis zur Malaiischen Halbinsel vorgestoßen sein müssen. Nach dem griechischen Händler Kosmas Indikopleustes (523) hätten sich persische Kaufleute mit Chinesen und Leuten „aus den entferntesten Ländern“ in Sri Lanka getroffen.
Muslime als Anrainer des Mittelmeers – Muslimische Eroberung Spaniens
Als 100 Jahre darauf die Araber ihr Reich unter den „vier rechtgeleiteten Kalifen“ (632–661) über fremde Völker ausdehnten, rückten die Muslime „in eine zentrale Position, von der aus sie die beiden großen wirtschaftlichen Einheiten des Mittelmeers und des Indischen Ozeans verbinden konnten“ (André Wink). Rasch hatten sie das Sasanidenreich zerstört und Byzanz neben Armenien im Osten und Tripolitanien im Westen vor allem die Provinzen Syrien, Palästina und Ägypten abgenommen. 712 konnten die Omaijaden aus Damaskus auch das südliche Industal erobern. Man hat gesagt, dass die Muslime jetzt bis zum 11. Jahrhundert alle wichtigen Wirtschaftsrouten zu Wasser und zu Lande kontrollierten, abgesehen nur von der transeurasischen Seidenstraße und vom Handelszentrum Konstantinopel selbst. Indessen konnten sie die See zwischen Spanien und Kleinasien, Europas Süd- und Afrikas Nordufer niemals wie die Römer als mare nostrum, in der „Mitte ihres Landes“ (mediterran), begreifen. Sie waren und blieben ein Anrainer des Mittelmeers. Es nutzte den Arabern nicht viel, dass sie in syrischen und ägyptischen Häfen (Akkon, Tyrus, Tarsus; Alexandria, Rosette, Damiette) Kriegsschiffe stationierten und noch im 7. Jahrhundert die Inseln Zypern, Sizilien, Rhodos und Kreta angriffen, weil sie bei der Einnahme Konstantinopels versagten. So mussten sie sich die Herrschaft Zyperns jahrhundertelang mit dem Kaiserreich teilen, und Kreta, einst Zentrum einer mittelmeerischen Thalassokratie, gewannen sie gar erst 826, bevor es ihnen, ebenso wie Zypern und das syrische Antiochia, schon Mitte des folgenden Jahrhunderts wieder genommen wurde. Auch die erfolgreiche Eroberung Nordafrikas schien noch lange vom Meer her bedroht. Die neue Metropole Kairouan wurde 670 aus Sorge vor der oströmischen Seemacht fern der Küste gegründet, ehe eine Generation später in Tunis ein arabischer Flottenstützpunkt entstand; für den Schiffsbau mussten hierher eigens tausend koptische Familien (aus Ägypten) umgesiedelt werden. Sizilien konnte eine muslimische Partikularmacht erst seit 827 in jahrzehntelangem Kampf erobern; allerdings griff diese auch erfolgreich nach Unteritalien hinüber; selbst die Stadt Rom war zeitweise bedroht. Die Byzantiner widerstanden mit Zähigkeit, und einer ihrer Generäle plante 1038 sogar die Rückeroberung der Insel. Er scheiterte, so dass bald darauf erst die Normannen die muslimische Herrschaft beseitigten und dann auch die langobardisch-sarazenisch-byzantinische Gemengelage in Süditalien durch ihre Reichsbildung aufhoben. Von herausragender Bedeutung erwies sich die muslimische Eroberung Spaniens im frühen 8. Jahrhundert, zumal sie, wie einst bei den Karthagern, auf lange Sicht politische Herrschaft, Migrationen und sonstigen Verkehr über die Meerenge nach Afrika begünstigte. Während sich die Korangläubigen dem Atlantik kaum zuwandten, mussten die Christen erst die Dominanz auf der großen Halbinsel zurückgewinnen, ehe sie und ihre Nachbarn aus Italien seit dem 13. Jahrhundert planmäßig zu Seefahrten jenseits von Cádiz aufbrachen.
Beutezüge von Piraten
Die politische Zersplitterung der muslimischen Welt in Kalifate, Emirate und Sultanate trug, ebenso wie die allmählich erfolgreiche Konversion unterworfener Christen, dazu bei, dass sich Gewalt immer wieder in den Beutezügen von Piraten entlud. Dies gilt etwa für die im Umfeld des Kalifats von Córdoba agierenden Freibeuter, die bis ins späte 10. Jahrhundert die Provence heimsuchten. Korsaren beunruhigten die Adria und Venedig, den engen Verbündeten von Byzanz. Die Küste Dalmatiens wurde aber auch von den Kriegsschiffen und Piraten der Slawen sowie der christlichen Normannen bedroht. Sicher, wie im alten Imperium Romanum, war das Mediterraneum nie, und bis weit ins hohe Mittelalter hinein konnten nur die Flotten der Byzantiner und Muslime die Gesandten, Kaufleute, Pilger und Gelehrten, die Lebenshungrigen und die Exilierten bei ihren Fahrten entlang den Küsten oder – seltener – über das Wasser bis an den Horizont beschützen. Die muslimische Präsenz im Westen wurde geschwächt, als sich das Herrscherhaus der Fatimiden aus Tunesien nach Kairo zurückzog (973), obwohl weder Afrika noch Spanien oder Unteritalien den Christen wieder zugefallen wäre. Kairo, beim alten arabischen Heerlager am römischen Nilkanal gelegen, sicherte bis zum Reich der Mamluken (1260–1517) den Muslimen die Kontrolle über den Wirtschaftsverkehr mit dem Orient; hierher – wenn nicht nach Alexandrien – kamen die Schiffe der Byzantiner und Westeuropäer, um die Schätze Asiens einzutauschen.
Mittelmeerhandel der christlichen „Abendländer“
Am Mittelmeerhandel hatten sich damals schon neben Muslimen und Oströmern sowie den Juden auch die christlichen „Abendländer“ beteiligt, deren Wirtschaft seit der Zeit Karls des Großen einen bemerkenswerten Aufschwung genommen hatte. Je mehr sich das kaiserliche Byzanz aus dem westlichen Mittelmeer zurückziehen musste, umso mehr konnten ehemalige Angehörige des Reiches, wie in Amalfi oder Venedig, die Lücken füllen, aber auch andere Seestädte, Pisa etwa oder vor allem Genua, entfalteten ihre eigene Wirtschaftsmacht. Venedig gelang es mit der Gunst beider Kaisertümer, die Route von der Adria nach Konstantinopel zu kontrollieren und in der ganzen Levante seine Handelshäuser und Kolonien zu errichten; Genua und die anderen italienischen Seestädte taten es ihm gleich, und zwar bis zu den Küsten des Schwarzen Meeres. Die Flotten der „Seerepubliken“ waren sogar in der Lage, die Kreuzritter des Westens zur Rettung des Heiligen Landes über das Meer zu fahren. Als Konstantinopel zum ersten Mal gefallen war (1204), profitierte Venedig am meisten; die Beziehungen zu den westlichen Ländern intensivierten sich aber allgemein durch die Gründung der lateinischen Staaten auf griechischem Boden. Noch im 13. Jahrhundert griff auch die Krone Aragón, nach Auseinandersetzungen mit den Anjou um Sizilien, ins östliche Mittelmeer aus; die Herzogtümer Athen und Neopatras konnte König Johann I. immerhin bis 1388/1390 halten. Weit übertroffen wurden die Spanier allerdings wiederum von der Beharrungskraft Venedigs und Genuas; denn lange nachdem das „Zweite Rom“ durch die Osmanen muslimisch geworden war (1453), behielten die Seestädte noch ihre Kolonien Modon und Koroni (Peloponnes, etwa bis 1500) sowie Chios (Ägäis, bis 1566). Die Vormacht zur See war damals allerdings bereits an die Türken übergegangen; Venedig, das seine Suprematie noch im 14. Jahrhundert in Seeschlachten und -kriegen gegen Genua und auch den König von Ungarn behauptet hatte, unterlag den türkischen Kanonen entscheidend in der Schlacht bei Zonchio 1499.
Handel mit Asien
Als Nachfolger der christlichen Kaiser hatte der Sultan von Istanbul am Ende des Mittelalters die Kontrolle über das Schwarze Meer gewonnen. Wichtiger für den Asienhandel war aber von jeher die muslimische Herrschaft über die Seewege im Süden durch das Kalifat und dann durch das Sultanat von Kairo. Die Verlagerung der muslimischen Hauptstadt von Damaskus nach Bagdad unter den Abbasiden hatte hier seit 762 der alten persischen Verbindung über den Golf die Dominanz gegenüber dem Roten Meer verschafft, das wegen seiner Untiefen gefürchtet war. Über die Hafenstädte Siraf an der persischen Küste und Basra gelangten jahrhundertelang die Handelswaren aus China, der Malaiischen Halbinsel, Indonesien und Indien nach Mesopotamien, wo Bagdad zum größten Hafen der Welt aufstieg. Die Kapitale am Tigris vermittelte die Güter weiter nach Syrien, Ägypten, Nordafrika und in den Westen Europas, in den Norden und Osten aber auch nach Aserbaidschan, Armenien, Isfahan und Chorasan. Ein Wendepunkt wurde bei der Eroberung Bagdads durch die seldschukischen Türken 1055 und dem Verfall der abbasidischen Macht erreicht. Von Kairo aus schalteten sich die Fatimiden Ende des 11. Jahrhunderts in den Indienhandel ein; seit Beginn der Kreuzzüge wurden die orientalischen Gewürze und andere Güter über das Rote Meer nach Kairo und Alexandria umgelenkt, wo christliche Handelsflotten die Waren aufnehmen konnten. Erst recht avancierte das Sultanat am Nil nach der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204) und der Zerstörung Bagdads durch die Mongolen (1258) zum neuen Zentrum nahezu aller Handelsaktivitäten von Indien über Aden nach Europa. Reich durch den Indienhandel wurde Ägypten unter den Mamluken.
Zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert dominierten neben Persern vor allem Araber im westlichen Teil des Indischen Ozeans, obwohl die Islamisierung Indiens um 750 stockte und erst mit Errichtung des Sultanats von Delhi (1206) wieder aufgenommen wurde. Von Siraf aus konnten große Überseeschiffe direkt bis nach China fahren; ein einziger arabischer Kapitän der Zeit soll die Reise siebenmal unternommen haben. In Kanton hatte es schon im 4. Jahrhundert eine Niederlassung arabischer Händler gegeben. Die Kaufleute wurden durch die teilweise glanzvolle Tang-Dynastie (618–906) begünstigt; diese chinesischen Herrscher duldeten viele Religionen, neigten aber selbst dem Buddhismus zu, dessen Klöster auf wirtschaftliche Hilfen der Laien angewiesen waren und den Handel förderten. Perser und Araber brachten neue Obstsorten, wie Granatäpfel, Walnuss, Feigen und Mandeln, nach China; aus Persien wurde auch das Polospiel eingeführt. Umgekehrt haben Ausgrabungen in Siraf Zeugnisse des arabisch-persischen Chinahandels preisgegeben; Keramik der Tang-Zeit gelangte bis zum Kalifenhof von Bagdad. Während eines der wiederholten Aufstände wurde allerdings 879 Kanton geplündert; dabei sollen nach dem zeitgenössischen Bericht des Abu Zaid aus Siraf 120.000 Menschen, die meisten von ihnen Muslime, umgekommen sein.
Einschneidender Wandel in der Ökonomie
Um die Jahrtausendwende vollzog sich im Indischen Ozean ein einschneidender Wandel in der Ökonomie; an die Stelle der direkten Belieferung der Abnehmer durch die Erzeuger trat der Emporienhandel, bei dem die Waren in oft mehreren Stapelhäfen zwischengelagert wurden. Die Emporien wurden am Ort älterer Handelsplätze oder ganz neu gegründet, boten eine große Vielfalt und Menge von Waren an, beherbergten Seefahrer vieler Völker und eine multinationale beziehungsweise plurireligiöse Einwohnerschaft. In diesem System nahm die Bedeutung der arabischen und persischen Händlergruppen seit dem 11. und besonders seit dem 14. Jahrhundert stark ab. So wagten sich die Fatimiden kaum noch über Südindien und Sri Lanka hinaus. An ihre Stelle traten vor allem die Inder, auch sie oft Muslime, aber auch Hindus, Juden und sogar Christen. Eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Relaisstationen scheint der Aufstieg des Chola-Reiches an der Koromandelküste gespielt zu haben. Die ungewöhnlich militanten Könige Rajaraja (985–1014) und Rajendra (1012–1044), dessen Sohn, errichteten eine Hegemonie über den gesamten indischen Subkontinent und unternahmen mehrere Eroberungszüge nach Sri Lanka und den Malediven. Offensichtlich ging es ihnen um die Kontrolle des Fernhandels, zumal China unter den Song (960–1126 bzw. 1127–1279) erneut aufblühte. 1014/1015 entsandten die Cholas erstmals eine Mission nach China, die keine einheimischen Produkte, sondern fast ausschließlich Zwischenhandelsgüter anbot. Das Herrschergeschlecht der Song erkannte das indische Reich daraufhin als „Großen Tributärstaat“ an. Mit den Cholas konkurrierte allerdings das Seereich von Srivijaya in Indonesien, das sich anschickte, die Meerengen in der südostasiatischen Inselwelt unter seine Kontrolle zu zwingen. Rajendra ließ deshalb 1025 Srivijaya durch eine Kriegsflotte angreifen und auf Sumatra, der Malaiischen Halbinsel und den Andamanen ein Dutzend Hafenstädte in Brand setzen. Um Emporien zwischen dem Indischen Ozean und dem Südchinesischen Meer dürften deshalb die Auseinandersetzungen gegangen sein. Unter der Herrschaft der Chola standen an der Malabar-, also der Westküste Indiens auch Niederlassungen jüdischer Kaufleute, die, nach der Überlieferung von Alt-Kairo, mit Glaubensbrüdern in Ägypten korrespondierten. Das expansive Delhi-Sultanat, das sich selbst als al-Hind oder Hindustan schlechthin verstand, eroberte noch im 13. Jahrhundert Gujarat im Nordwesten, wo traditionell die Schiffe aus dem Persischen Golf anzulegen pflegten. Die dortigen Händler traten vielfach ebenfalls zum Islam über, der jetzt von Indien aus nach Südostasien vordrang. Mit der Frequenz der Handelsfahrten und der Größe der Schiffe nahm auch die Zahl der Emporien zu.
Überseehandel der Song
Unter den Dynastien der Song traten die Chinesen zum ersten Mal als bedeutender Partner im Überseehandel in Erscheinung. Abgesehen von Japan und dem Königreich von Champa (Vietnam) waren Malaya und die Küstenstädte von Südindien ihre wichtigsten Anlaufstationen. Schon im 11. Jahrhundert waren sie auf den Gewürzinseln und auf Java präsent. Zentren ihres Handels mit den Arabern waren auf Sumatra Palembang, Aceh (Atjeh) am Eingang der Malakkastraße, die Häfen Borneos sowie Manila auf den Philippinen. Nach den »Aufzeichnungen über die Barbarenländer« aus dem 13. Jahrhundert kannten sie auch europäische Örtlichkeiten, vermittelt indes nur durch Erzählungen arabischer Seefahrer.
Drei große Segmente des Asienhandels
Mindestens seit dem 13. Jahrhundert war der Asienhandel über Arabisches Meer, Indischen Ozean und Südchinesisches Meer durch zwei Grenzzonen in drei große Segmente geteilt, die dem Radius der jeweils verkehrenden Schiffe entsprachen. Der westliche Kreis, überwiegend in der Hand von Muslimen, reichte von den Häfen der Arabischen Halbinsel beziehungsweise von Bagdad oder Kairo bis zur Nordwestküste Indiens (gewöhnlich Gujarat) hinüber, von wo die Händler die Küste nach Süden entlangfuhren; diejenigen, die vom Roten Meer gekommen waren, hatten hingegen Aden oder Had(h)ramaut passiert und segelten direkt nach Malabar. Der mittlere Kreis verband die südliche Küste Indiens mit der Region von Sumatra und Malaya an der Straße von Malakka bis nach Java; bei den Anwohnern handelte es sich, jedenfalls bis ins 14. Jahrhundert, überwiegend um Hindus, obgleich auch der Buddhismus von Bedeutung war. Der östliche Zirkel war der Raum zwischen Indochina und der Nordküste von Java einschließlich der großen Küstenstädte Chinas selbst; hier dominierte der Buddhismus, durchsetzt mit konfuzianischen Einflüssen. Allerdings waren die drei Zonen weniger durch ihre Religionen geprägt als durch die Natur bedingt. Mit ihren Emporien in den Umschlagskorridoren reagierte das Handelssystem auf den jahreszeitlichen Wechsel des Monsuns. Danach konnte man mit dem Südwestwind von Arabien oder Afrika nur zwischen März und Juli nach Indien segeln, musste mit dem Nordostmonsun von Gujarat oder Malabar aber erst nach Mitte Oktober und in jedem Fall vor dem 10. Februar zurückkehren. Entsprechend terminiert war die Segelsaison in beiden Richtungen in den anderen Abschnitten der maritimen Fernhandelsrouten. Wenngleich eine Direktverbindung zwischen Arabien oder Persien und China einschließlich der Rückkehr etwa anderthalb Jahre in Anspruch genommen hätte, konnte durch falsche Windberechnung sehr viel mehr Zeit verloren gehen. Händler, die nur in einer Zone verkehrten, wirtschafteten sehr effektiv, wenn sie je mit dem Wind fuhren und an den Stapelplätzen ihre Ladungen zügig austauschten.
Objekte des Handels
Was nun die Objekte des Handels selbst angeht, so spielten hochwertige Güter geringen Umfangs eine bedeutende, aber nicht die wichtigste Rolle. Unter den Luxusprodukten stand Pfeffer für die asiatischen Märkte (Ostasien und arabisch-persischer Raum) und für den Export nach Europa an erster Stelle; er wurde besonders im Westen Indiens und im Nordwesten Sumatras produziert. Teurer als Pfeffer war Ingwer, der allerdings in erheblich geringerem Umfang gehandelt wurde; er kam von der Malabarküste, von Bengalen und aus Ostafrika. Zimt stammte hauptsächlich aus Sri Lanka, Gewürznelken, Muskatblüten und Muskatnuss von den Gewürzinseln (Ambon, Molukken, Bandainseln). Kostspieliger waren Drogen und Duftstoffe wie Amber, Kampfer und Opium sowie das begehrte Sandelholz von der Insel Timor. Als Tauschmittel der europäischen beziehungsweise der vermittelnden islamischen, jüdischen oder auch armenischen Kaufleute dienten insbesondere Edelmetalle, Gold- und Silbermünzen, aber auch Brokat, Wolle, Korallen und Rosenwasser. China brachte Seide und Porzellan, Indien noch Textilien, Diamanten und Edelsteine, Sri Lanka Perlen in Umlauf: Gold kam aus Sumatra und Ostafrika, das auch Elfenbein und Sklaven lieferte. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert trat der Transport schwerer Massengüter in den Vordergrund. Stark nachgefragt wurde Kupfer, ein traditionelles Exportgut der Levante; begehrt war auch Zinn von der Malaiischen Halbinsel und Sumatra, das entweder nach Westen oder nach China ging. Eisen kam insbesondere vom Dekkan (Indien) und von Orissa, Schiffsbauholz wurde von der Westküste Südindiens in arabisch-persische Gebiete oder auch nach Gujarat verfrachtet. Teakholz aus Myanmar gelangte nach Malakka und an die Koromandelküste. Von Myanmar und Sri Lanka wurden Elefanten für den Kriegsdienst nach Indien verschifft, Pferde lieferten Arabien, Persien und Somalia. Zum Transport der raumgreifenden und schweren Güter kam die Beförderung von Sklaven und Passagieren, vor allem aber von Nahrungsmitteln in großen Mengen. Aden und Hormus mussten ebenso wie die islamischen Städte Ostafrikas und die Küstenorte von Sri Lanka Reis von der Koromandel- oder der Malabarküste beziehen, die Gewürzinseln versorgten Java mit Reis, und auch Malakka war von der Einfuhr von Lebensmitteln abhängig. Das fruchtbare Bengalen war mit seinen ausgedehnten Reis-, Zuckerrohr- und Baumwollpflanzungen sowie seinen großen Pferde-, Kuh- und Schafherden einer der wichtigsten Nahrungsmittelexporteure Asiens überhaupt. Neue Frucht- und Getreidesorten fanden aus Ostafrika oder Südostasien Verbreitung. Ein begehrtes Nahrungsmittel wie Dattelhonig wurde von Arabien bis China transportiert, in einigen Regionen musste aber gar mit Wasser gehandelt werden.
Handelsverkehr zwischen Japan und China
Der Zugang der ostasiatischen Länder und Völker zum interkontinentalen Handel und Kulturaustausch hing im Mittelalter fast ausschließlich am Interesse der Chinesen. China selbst, aber auch Korea konnten zwar die eurasischen Karawanenstraßen nutzen, über die unter anderem der Buddhismus und viel weniger der Islam vordrangen, aber Japan war auf den Schiffsverkehr angewiesen. Seit dem 5. und besonders der Mitte des 7. Jahrhunderts öffnete sich das Inselreich chinesischen Einflüssen, nicht zuletzt durch missionierende buddhistische Mönche. Die Blütezeit der chinesischen Song brachte auch eine Intensivierung des Handels in Ostasien mit sich, der noch weitgehend durch chinesische und koreanische Schiffe abgewickelt wurde. Alles änderte sich, als das Reitervolk der Mongolen aus Innerasien ganz China eroberte (1276–1279) und eine Fremdherrschaft errichtete. Zwar scheiterte die Yuan-Dynastie daran, mit chinesischen Schiffen ein mongolisches Seeimperium zu errichten – die Invasionen Japans, Annams, Champas, Borneos und Javas schlugen bis 1292 fehl –, aber nun wurde Japan zur Errichtung einer eigenen Handelsflotte animiert. In der Zeit des Ashikaga-Shōgunats (1338–1573) und besonders, nachdem in China die Ming zur Herrschaft gelangt waren (1368), setzte regelmäßiger Verkehr zwischen Japan und China ein. Zahlreiche Fahrten dienten vor allem der wirtschaftlichen Förderung von Zen-Tempeln; Verträge zwischen dem Kaiser, der dabei die Fiktion der Tributherrschaft aufrechterhielt, und dem Shōgunat sollten den Umfang des Austauschs genau regeln. Dabei war der maritime Fernhandel für China selbst zweifellos von großem Vorteil; schon Marco Polo, der 1292 für seine Rückreise nach Venedig aus Sicherheitsgründen die See wählte, hatte die Stadt Quanzhou (Zayton) als einen der beiden bedeutendsten Häfen der Welt gerühmt. Er beobachtete hier die Verladung von Pfeffer nach Alexandrien und zahllose Schiffe, die aus Indien Perlen und Edelsteine herbeibrachten. Nur eine Episode blieb viel später die Flotte des Ming-Kaisers Yongle (Chengzu), der seinen Admiral Zheng He, einen muslimischen Eunuchen, siebenmal weiträumige Expeditionen nach Java, Sumatra, sogar in den Persischen Golf und nach Dschidda am Toten Meer unternehmen ließ (1405–1433); Zhengs Kontingent bestand zwar aus 317 Schiffen und 20.000 bis 32.000 Mann Besatzung – die größte Armada in Ostasien bis zum Zweiten Weltkrieg –, doch scheinen die Unternehmungen weniger einen kommerziellen als einen diplomatischen und politischen Zweck gehabt zu haben. Offenbar ging es den Chinesen um die Anerkennung des kaiserlichen Vorrangs unter vermeintlich abhängigen Staaten. Die Ming-Regierung verzichtete danach auf jede weitere Förderung des Seehandels. 1530 beschloss der Kaiser sogar, keine japanischen Händler mehr zu empfangen, und provozierte damit weitere Überfälle japanischer und auch chinesischer Seeräuber auf die Küsten seines Reiches.