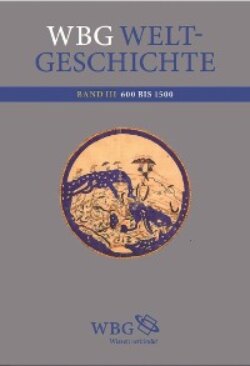Читать книгу wbg Weltgeschichte Bd. III - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Waren und Wissen im Gepäck – Händler und Gesandte, Pilger und Gelehrte
ОглавлениеKeine Bindungen gleicher Intensität – Exotische Reisen der Lateiner
Im Mittelalter zeigten die Routen des Fernhandels einen Zusammenhang zwischen Europa, Afrika bis zur Sahelzone und der südlichen Hälfte von Asien, auf denen freilich bei einem unterschiedlichen Gebrauch durch mehrere Nutzerkreise keine Bindungen gleicher Intensität entstanden. Indische und gar chinesische Händler gelangten im Westen allenfalls bis Ostafrika oder nach Mesopotamien, westeuropäischen Kaufleuten blieb die Subsahara so gut wie verschlossen, Araber segelten kaum einmal jenseits von Gibraltar, byzantinische Kaufleute mieden weitgehend die Landwege ins Innere Europas und Schwarzafrikaner brachte nur das schwere Los der Sklaverei, dann aber jährlich zu Zehntausenden, nach Asien oder Europa. Allerdings haben sich während des frühen Mittelalters, als die christlichen Kaufleute noch durch religiöse Bedenken in ihrer Entfaltung gehemmt waren, besonders die Juden im Fernhandel hervorgetan. Ende des 9. Jahrhunderts wird über vier Wege der jüdischen Rhadaniten berichtet, die ursprünglich aus dem Irak stammten und dann, auch auf Grund ihrer Multilingualität, zwischen Westeuropa beziehungsweise Rom und Indien oder China verkehrten. Wenn die Rhadaniten tatsächlich selbst bis nach Ostasien reisten, ohne andere Händler zu bemühen, hätten sie am ehesten das „Ganze“ der mittelalterlichen Welt aus eigener Anschauung beschreiben können, doch taten sie es ebenso wenig wie andere Autoren. Das gilt auch von den mobilen Muslimen des Mittelalters. Der Geograph Ibn Hawqal aus Nisibis besuchte wohl als Händler und Anhänger einer islamischen Sekte zwischen 943 und 973 Turkestan, Persien, Afrika und Sizilien, beschränkte sich dabei aber auf die Dār al-Islām, also auf die Gebiete unter muslimischer Herrschaft, weil es problematisch war, das „Land der Ungläubigen“ zu betreten; begrenzt wie sein Berichtshorizont sind auch die Karten der sogenannten Balchi-Schule, der er angehörte, da sie zusammengenommen nur das „islamische Reich“ seiner Zeit (sogar ohne al-Andalus) repräsentieren. Selbst der berühmteste muslimische Reisende Ibn Battuta, der in den drei Kontinenten 120.000 Kilometer zurückgelegt hat, achtete darauf, sich nur in vollständig oder wenigstens teilweise islamisierten Ländern aufzuhalten – ganz im Unterschied zu dem christlichen Kaufherrn Marco Polo, der die andersgläubigen oder „heidnischen Länder“ geradezu suchte. Die exotischen Reisen der Lateiner nach seinem Muster waren aber auf das 13./14. Jahrhundert beschränkt. Im „internationalen“ Handel des Mittelalters dominierten also Begegnung und Kommunikation von Menschen benachbarter Völker und Länder.
Das Schachspiel
Die Waren – Rohstoffe, agrarische Produkte oder Erzeugnisse des Handwerks –, die bei großen Entfernungen meist über Ketten von Zwischenhändlern zum Endverbraucher transportiert wurden, konnten die Kultur der Empfängergruppen verändern; besonders gilt dies für den Gebrauch, die Nachahmung oder die Weiterentwicklung fremder Gerätschaften und Artefakte. Berühmt sind die Mutationen, die beispielsweise das Schachspiel auf seinem Weg vom Orient in den Westen erfahren hat. Entwickelt im 6. Jahrhundert in Indien, wurde es über Persien auch dem „Abendland“ übermittelt. Aus der Figur des persisch-arabischen rukh, das heißt des Kamels, wurde nach der lateinischen Fehlübersetzung mit rochus der Turm; den fers, also den Wesir, verstand man hier gar als fiers, also als Jungfrau, Dame oder Königin, und der im Arabischen gebrauchte Elefant (ualfil), der noch im sogenannten Schachspiel Karls des Großen (aus dem späten 11. Jh.) vertreten ist, nahm im Westen die Gestalt eines Menschen an, sei es eines Läufers (im Deutschen), sei es eines Fahnenträgers (in Italien), Narren (Frankreich) oder Bischofs (England). Im Kriegswesen, um ein anderes Beispiel zu nehmen, vermittelten offenbar die Mongolen im frühen 14. Jahrhundert die chinesische Technologie der Feuerwaffen nach West- und Mitteleuropa, die hier um 1360/1380 durch Fortentwicklung der Pfeilbüchse zur mauerbrechenden Steinbüchse revolutioniert wurde.
Gegenstände als stumme Boten – Kunstförderung
Bloße Gegenstände wirkten schon als stumme Boten einer sonst unbekannten Welt, aber besser war es, ihre Geheimnisse durch Entschlüsselung verfügbar zu machen. Den Kaufleuten wird diese Kompetenz in der Regel nicht zugetraut, eher schon den „Diplomaten“, die oft die Qualität (und den Auftrag) von Kundschaftern hatten und – wie nur wenige Händler – weiträumige Reisen ohne Vermittlung anderer selbst übernahmen. Erfolgreiche Herrscher suchten fremde Experten zu gewinnen und machten deshalb gern Gefangene unter den Handwerkern, Künstlern und Gelehrten ihrer unterworfenen Kriegsgegner, wenn sie nicht als Mäzene diese an ihren Hof lockten. Den Arabern verschafften die Eroberung von Samarkand (711) und wohl die Verschleppung chinesischer Techniker nach ihrem Sieg östlich des Jaxartes (Syrdarja) von 751 den Zugang zur fernöstlichen Kunst der Papierherstellung, die sie in wenigen Jahrzehnten über Bagdad, Damaskus und Altkairo in den Westen verbreiteten. Die Unterwerfung des Langobardenreiches 774 durch Karl den Großen lenkte neben ungeheuren Mengen an Gold vor allem Dichter und Gelehrte aus Italien ins Reich nördlich der Alpen, die mit der „Karolingischen Renaisssance“ den Grund für einen „Schatz“ legten, „der ganz Europa, ja die Welt für immer bereicherte“ (Johannes Fried). Fast zur selben Zeit tat es ihm der König von Kaschmir, Lalitaditya-Muktapida (720–756/757), gleich, der trotz der Bedrängnisse durch Araber und Tibeter, aber mit Unterstützung des Kaisers von China, an der „Eroberung der Welt“ (digvijaya) arbeitete. Seine Eroberungen machten Lalitaditya so reich, dass er „als Herr der Erde die Erde golden machte“ und als Patron der Architektur im Kaschmirtal zahlreiche Vishnu-Schreine, aber auch buddhistische Stupas mit goldenen, silbernen, kupfernen und edelsteinbesetzten Idolen und Statuen schaffen ließ. Sein Baustil sollte den raschen Verfall seiner Herrschaftsideen um sechs Jahrhunderte überdauern. Neben Elementen der traditionellen Gandharakunst, die selbst hellenistisch und römisch-parthisch beeinflusst war, und der etwas jüngeren Kunst der Gupta sowie gewissen Anregungen aus China wurden dabei die Vorbilder syrisch-byzantinischer Techniken und Formen entscheidend. Dazu gehörten die Verwendung von Zement und Stahldübeln und der Einsatz römisch-korinthischer Pilaster, römisch-dorischer Säulen, byzantinischer Bögen, Gewölbe und Kuppeln von ungewöhnlicher Spannweite, ferner rechteckige Fenster mit schwerem Gebälk und dreieckige, mit Köpfen und Blumen gefüllte Giebel. Der noch heute stehende, wenn auch später durch muslimischen Ikonoklasmus schwer beschädigte Sonnentempel von Martanda zeigt den römisch-byzantinischen Stil an seinen Ausmaßen und der Fassadengestaltung. Man nimmt an, dass der „König der Könige von Indien“ für seine Bauten auf eine Schule von Architekten und Künstlern aus Syrien, Palästina und Ägypten zurückgreifen konnte, die beim Einfall der Araber 634 bis 638 aus dem Oströmischen Reich geflohen waren. Byzantinische Anregungen haben vor allem um die Jahrtausendwende auch auf die Kunst der lateinischen Christenheit in Westeuropa eingewirkt; das gilt für Skandinavien, England, Frankreich und Italien, vor allem für das Römisch-Deutsche Reich, wo die Gemahlin Kaiser Ottos II., die griechische Prinzessin Theophanu (†991), Mönche beziehungsweise Künstler zum Aufbruch in den Westen animiert hatte. Auf das Vorbild des östlichen Kaiserreichs werden Mosaiken, Wand- und Buchmalereien, Holz- und Steinplastiken, Münzbilder, Emaillearbeiten und andere Kleinkunst, teilweise sogar der romanische Baustil selbst, zurückgeführt, die Kirchenschätze füllten sich aber auch mit Elfenbeinschnitzereien, Reliquiaren, Glaswaren, Seidentüchern, Ikonen und illuminierten Handschriften, die auf ihre Weise Maßstäbe setzten. Neben den Herrschern waren es besonders Bischöfe und Äbte, die zu dieser Zeit die Kunst förderten. Leider lassen sich für die west-östliche Zusammenarbeit nur wenige Namen von Christen nennen. Der Abt Gauzlin von Fleury (1004–1030) sandte eigens Boten ins Reich von Byzanz, die für den Neubau seiner Kirche Künstler und geeignete Materialien aufspüren sollten; tatsächlich wurde Marmor eingeführt, aber über griechische Künstler und die Arbeiten an den Mosaiken im westfränkischen Kloster ist nichts Näheres bekannt. Das Gleiche gilt für die gewölbte Bartholomäus-Kapelle in Paderborn, die bald nach 1025 von den Griechen errichtet wurde; in Essen muss ein anonymer griechischer Kunsthandwerker den siebenarmigen Leuchter geschmiedet haben. Abt Desiderius von Montecassino rief um 1060 Mosaizisten, Maler, Bildhauer, Glasmacher, Elfenbeinschnitzer und Holzbildhauer aus Konstantinopel, während die Amalfitaner Kaufmannsfamilie de comite Maurone seiner Klosterkirche byzantinische Bronzetüren stiftete. Zwischen Spanien und Byzanz waren die Beziehungen schon zur Zeit der Westgoten eng gewesen; im 10. Jahrhundert wollten auch die Kalifen von Córdoba von Kunst und Wissenschaft der andersgläubigen Griechen profitieren. Der Kaiser schenkte ‘Abd ar-Rahman III. (912–961) eine Handschrift der »Materia Medica« des Dioscurides, schickte aber auch den Mönch Nikolaus, der den pharmakologischen Text erklären und übersetzen sollte; Nikolaus blieb dann und starb in Spanien. ‘Abd ar-Rahman erhielt auch 140 Säulen aus Griechenland, mit denen er einen seiner Paläste, vielleicht die berühmte Sommerresidenz Medina Azahara, schmückte.
Ibn ar-Razzaz al-Gazaris Wasserhebemaschine (1354).
Entführungen von Spezialisten
Gewaltsam suchte sich der normannische König Roger II. des wertvollen Knowhows der Griechen zu bemächtigen. Bei seinem Überfall auf das Reich von Byzanz erbeutete er 1147 neben Gold, anderen Edelmetallen und Sklaven Seidenweber und -sticker aus Theben und Korinth, die fortan in den Ateliers von Palermo wirkten. Moderne Techniken, die bisher den Werkstätten beim kaiserlichen Palast am Bosporus vorbehalten waren, wurden auf diese Weise auch im Westen verfügbar. In umgekehrter Himmelsrichtung entführten die Mongolen schon bei ihrem ersten Vorstoß von 1236/1242 nach Europa Menschen mit speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten. Darunter waren Bergarbeiter, wohl aus Siebenbürgen, die in der Dsungarei nach Gold graben mussten, und der bei Belgrad aufgegriffene Goldschmied Guillaume Boucher schuf für den Palast des Großkhans einen Silberbrunnen in Form eines Baumes, der verschiedene Getränke spendete. Natürlich wussten auch weitsichtige afrikanische Herrscher, dass man sich für die Adaptation fremder kultureller Errungenschaften möglichst direkt an die Quelle oder das Zentrum anderer Völker wenden musste. Mansa Musa von Mali jedenfalls kaufte auf seiner grandiosen Reise in Kairo juristische Abhandlungen auf und bewegte weiße Gelehrte, sich am Niger niederzulassen. Den arabischen Dichter und Architekten Es Saheli gewann er dafür, die sudanesische Baukunst weiterzuentwickeln und Timbuktu neu mit Moscheen, Minaretten und Lehmpalästen zu verschönern.
Begegnungen mit Religionen und Kulturen
Viele Reisende des Mittelalters erfüllten mehrere Funktionen und Rollen, sie waren also zugleich Händler und Pilger oder Gesandte, Missionare und Gelehrte. Trotzdem haben sich die Formen des Erwerbs, des Gebrauchs und der Verbreitung des Wissens typologisch deutlich unterschieden. Während etwa ausgesandte Mönche Wissen über die Fremde „sammelten, um es zu verschriftlichen und zu verbreiten, erwarben sich Kaufleute Wissen, um es anzuwenden. Die Mönche transportierten Wissen, die Kaufleute transportierten Waren“ (Marina Münkler). Händler waren daran interessiert, ihr Wissen geheim zu halten, und vermittelten ihre Erfahrungen mündlich; die Kontaktsysteme von Diplomaten, Gelehrten und Missionaren nahmen hingegen am Wissensdiskurs teil, der durch eine traditionsbegründende Verschriftlichung und die Zirkulation des Wissens über ein geschlossenes Kommunikationssystem hinaus gekennzeichnet ist. Auf Fernreisen waren Begegnungen mit Angehörigen anderer Religionen und Kulturen unvermeidlich. Während die Juden, im Mittelalter ein Volk ohne Staat, auf solche interkulturellen Kontakte geradezu angewiesen waren, suchten sie fromme Muslime oft zu vermeiden. Einen Spiegel dieser Ambivalenzen stellt der Bericht des Ibn Dschubair dar. Der Sekretär des Gouverneurs von Granada, der 1183/1185 einen haddsch (Pilgerfahrt nach Mekka) unternahm, segelte auf einem Genueser, also von Christen betriebenen Schiff von Ceuta nach Alexandria und suchte nach Mekka noch Ägypten, den Irak sowie Syrien auf. Den Boden der Kreuzfahrerstaaten betrat er in Begleitung muslimischer Kaufleute, die hier trotz der Kriegszüge Saladins mit den Christen ungehindert Handel trieben. Ibn Dschubair beobachtete eine im Ganzen tolerante Politik der lateinischen Autoritäten gegenüber ihren muslimischen Untertanen, ja sogar Freundschaften zwischen den Christen und ihren muslimischen Nachbarn, die ihn beunruhigten, und musste darüber klagen, dass die eigenen Glaubensbrüder unter fränkischen Herren besser lebten als es umgekehrt der Fall war. Als er im Oktober 1184 von Akkon wiederum mit einem genuesischen Schiff zur Heimreise aufbrach, befand er sich in der Gesellschaft von 2000 christlichen Pilgern, von denen er sich mit anderen Muslimen fernzuhalten suchte. Auch bei seiner Zwischenstation auf Sizilien, also im Reich der Normannen, wunderte er sich über die christlich-muslimische Symbiose: „Ganz Sizilien fließt über von den Anbetern des Kreuzes“, schrieb er, „aber die Muslime leben mit diesen auf ihren Ländereien und in ihren Werkstätten; sie werden von den Christen gut behandelt“, die sie für sich arbeiten ließen. König Wilhelm II. dulde in Palermo ihre religiösen Kulte und ihre eigenen Märkte. Die Moscheen seien so zahlreich, dass man sie nicht zählen könne, an vielen von ihnen werde der Koran unterrichtet. Der Monarch selbst spreche und schreibe Arabisch, zu seiner Verfügung stünden ihm fast nur muslimische Mädchen. Der Ruf des Muezzins sei an seinem Hof beständig zu hören, ja Wilhelm habe die Parole ausgegeben, jeder möge das anbetungswürdige Wesen verehren, das seinen Glauben finde.
Verbreitung des Buddhismus – Dolmetscher
Im Unterschied zu den Kaufleuten konnten sich Diplomaten und Pilger, obzwar es auch hier Ausnahmen gab, bei der Erfüllung ihres Reisezwecks durch andere kaum vertreten lassen und mussten die Ziele selbst ansteuern. Das gilt auch für die Missionare der großen Religionen, die vor ihrer Verkündigung und der Konversion der Völker meistens die Herrscher gewinnen mussten. Ansonsten dehnten sich die Religionen dadurch aus, dass sie auf den von Händlern, Kolonisten oder Gesandten vorgebahnten Wegen schrittweise ihren Wirkungskreis erweiterten; ein Beispiel dafür ist das Vordringen der buddhistischen und später der lateinischen Bettelmönche entlang der Seidenstraße. Hier, wie bei allen Kulturkontakten, stellte sich natürlich die Frage der sprachlichen Verständigung, die sich von dem Problem der Vermittlung unterschiedlicher Geisteshaltungen nicht trennen lässt. So fand der Buddhismus aus Indien seit dem 1./2. Jahrhundert n. Chr. nur allmählich Eingang in China und erlebte auch nach seinem Durchbruch in der Zeit der Sui- und Tang-Dynastien (589–906) immer wieder Rückschläge bis zu seiner endgültigen Marginalisierung unter den Ming-Kaisern (1368–1644). Man hat die Einführung des Buddhismus „zuallererst als eine beispiellose Übersetzungsleistung“ beschrieben: „Hunderte von Schriften mussten aus indischen Sprachen (Sanskrit, Pāli) ins Chinesische übersetzt werden, das durch eine völlig andere Struktur geprägt ist. Sind die indischen Sprachen flektierend, grammatisch analytisch und zu Abstraktionen anregend, so ist das Chinesische assoziativ, konkrete Bildausdrücke aneinanderreihend und eher synthetisch.“ Buddhistische Begriffe wurden anfangs in daoistische, also einheimische Konzepte übersetzt, was zu erheblichen Missverständnissen führte. Im 4. Jahrhundert bildete sich um Kumarajiva eine Übersetzerschule, in der mit großzügiger Förderung aus dem kaiserlichen Haushalt Hunderte von Mönchen arbeiteten. Der Sinisierung des Buddhismus stand die ganz unindische Denkweise der Chinesen entgegen: „Ist der indische Buddhismus im Wesentlichen eine Lehre des Bewusstseinstrainings auf Grund der Erkenntnis der Vorläufigkeit alles Äußeren, der Vergänglichkeit und der Befreiung vom Anhaften an weltlichen Bindungen, so ist die chinesische Mentalität durch Verehrung der Ahnen (also gerade nicht durch Wiedergeburt), die Bedeutung der sozialen Hierarchien und die Rang- und Ordnungsvorstellungen in Kosmos, Staat und Familie gekennzeichnet. Mönchtum als Verzicht auf Familie war den Chinesen völlig fremd, ja suspekt“ (Michael von Brück). Trotzdem hatte der Buddhismus großen Erfolg. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts sollen im nördlichen Wei-Reich allein 30.000 Klöster mit zwei Millionen Mönchen und Nonnen bestanden haben. Das ist umso bemerkenswerter, als umgekehrt die chinesischen Religionen und „Weltanschauungen“ – also Daoismus und Konfuzianismus – nach Westen nicht vordringen konnten. Ähnliche Erfahrungen mit der Verständigung wie die Buddhisten in China machten auch die Franziskaner und Dominikaner bei den Mongolen oder Arabern. Nachdem schon der erste päpstliche Gesandte zum Großkhan, Johannes de Plano Carpini (1245/1247), Klage über die mangelhaften Sprachkenntnisse seines aus Kiew stammenden Dolmetschers geführt hatte, räsonnierten fast alle missionstheoretischen Schriften der Lateiner über das zentrale Problem des defectus linguarum. Der etwas spätere Unterhändler Wilhelm von Rubruk (1253/1255) empfahl dem Papst, einer künftigen Delegation gleich mehrere gut ausgebildete Dolmetscher mitzugeben. Der Minderbruder Johannes von Montecorvino, der 1289 nach Khanbaliq (Peking) kam und völlig isoliert die katholische Mission unter den Mongolen aufnahm, erlernte selbst die tatarische Sprache, um mit seiner Predigt Gehör zu finden, und übersetzte den Psalter sowie das Neue Testament. Ein verheißungsvoller Ansatz für die Auseinandersetzung mit dem Islam war das studium arabicum, das die Dominikaner 1250 in Tunis errichteten, das aber schon beim Kreuzzug des französischen Königs Ludwig des Heiligen 20 Jahre später wieder zerstört wurde. Auch die unermüdlichen Pläne für Dolmetscherschulen für Arabisch und Hebräisch, die Ramon Llull (1232–1316) auf Mallorca und anderswo entwickelte, blieben ohne nachhaltige Wirkung. Der Beschluss des Konzils von Vienne im Jahr 1312, an fünf Universitäten Arabisch- und Hebräischlehrstühle zu errichten, wurde jedenfalls nur halbherzig verfolgt.
Mittelalterliche Judenheit – Einfluss des Islam
Bei den Juden wahrten nach dem Verlust des Tempels in Jerusalem (70 n. Chr.) die weit verstreuten Lehrhäuser die religiöse Überlieferung. Grundlage exegetischer Arbeit und autoritativer Entscheidung durch die Schriftgelehrten war der in Jerusalem und Babylon (um 400 und 500 n. Chr.) entstandene Talmud, eine Sammlung vorher mündlich tradierter Gesetze, die die biblischen Vorschriften selbst ergänzten. Neben den orientalischen Häusern entstanden Jeschiwot (Talmudhochschulen) auch in der näheren Umgebung vieler jüdischer Wohnplätze, so im spanischen Granada, in Lucca, Venosa, Bari, Otranto und Oria in Italien, im französischen Troyes oder in Mainz, Worms und Speyer. Andererseits war jedem Juden das lebenslange selbständige Studium der Bibel und der anderen heiligen Schriften auferlegt, so dass schlechthin jedes Haus zum Ort der frommen Meditation und Auslegung werden konnte. Der größte jüdische Reisende des Mittelalters, Benjamin von Tudela (gest. nach 1173), lässt das heterarchische Netzwerk prinzipiell gleichrangiger jüdischer Gemeinden und Studienorte hervortreten, indem er in seinem »Buch der Reisen« Station für Station seines Itinerars zwischen Navarra und Bagdad akribisch protokolliert. Zum Schulunterricht gehörte bei den Juden die Kenntnis des hebräischen Pentateuchs und seiner aramäischen Übersetzung. Ihr Leben in der Diaspora zwang aber zur Vielsprachigkeit, die ihnen wiederum den Zugang zur Literatur fremder Völker eröffnete. In Byzanz scheint das Hebräische noch vor dem Griechischen auch die Alltagssprache der jüdischen Gemeinden gewesen zu sein, während in Spanien Altkastilisch und in Deutschland Deutsch, in Randregionen auch Französisch oder Tschechisch, gesprochen wurde. Da die mittelalterliche Judenheit weit überwiegend unter muslimischer Herrschaft oder wenigstens in unmittelbarer Nachbarschaft muslimisch geprägter Kulturen lebte, wurde sie vom Islam besonders nachhaltig beeinflusst. Bei den orientalischen und sephardischen (spanischen) Juden geriet das Arabische sowohl zur Alltags- als auch zur Schrift- und Gelehrtensprache. Es drang sogar ins Reden und Schreiben über die geheiligte jüdische Überlieferung ein, obschon vielfach die jüdische Schrift selbst weitergebraucht wurde. Jüdische Gelehrte kannten und zitierten den Koran und die Hadīthen und benutzten arabische Kommentare zu biblischen Texten. Mit der Kenntnis des Arabischen erschlossen sich die Juden die Übersetzungen griechischer oder fernöstlicher wissenschaftlicher und philosophischer Schriften. Der liberale Geist im jüdischen Bildungswesen kommt in einem Bescheid zum Ausdruck, den ein Gaon, also der Führer einer der großen orientalischen Akademien, im frühen 11. Jahrhundert erteilt hat: „Es ist erlaubt, arabische Kalligraphie und Arithmetik in der Synagoge zusammen mit dem Heiligen Gesetz zu unterrichten. Nicht-jüdische Kinder dürfen in der Synagoge ebenfalls studieren um der guten Beziehung zu den Nachbarn willen, obwohl das nicht wünschenswert ist.“ Das Studium der „fremden“ Wissenschaften wurde damit gerechtfertigt, dass schon der Talmud medizinische und astronomische Informationen enthielt, die es zu entschlüsseln galt. Wer aber die Schriften der Mediziner und Pharmazeuten konsultierte und, wie sehr viele der gelehrten Juden, die Heilkunst selbst ausübte, musste auch die philosophischen Schriften der Alten kennen. Die Ausbildungsstätten der anderen Religionen waren den Juden meistens versperrt. Allerdings ist unklar, welche Wirkung das Verbot des abbasidischen Kalifen al-Mutawakkil von 850 hatte, nichtmuslimische Kinder zu den eigenen Schulen zuzulassen. Auch der Besuch der medizinischen Fakultäten an den Universitäten des christlichen Abendlandes war den Juden eigentlich untersagt, wenngleich der jüdische Arzt, Philosoph und Übersetzer Abraham Avigdor aus Arles im 14. Jahrhundert an der medizinischen Hochschule in Montpellier unterrichtet zu haben scheint.
Maimonides – Meir Ben Baruch
Schon die muslimischen Eroberungszüge in Palästina einerseits und in Spanien andererseits haben die Juden des Mittelmeerraums seit dem 7./8. Jahrhundert zu Wanderungen gezwungen; weitgreifende Siedlungsverschiebungen blieben seither, in Abhängigkeit von politischen, religiösen oder sozialen Umbrüchen der Mehrheitsgesellschaften, ihr Schicksal. Die Juden selbst nannten ihre Zerstreuung galuth, also „Verbannung“. Nach Vertreibungen durch Christen oder Muslime – in Byzanz zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert, im Westen Europas seit dem hohen Mittelalter – errichteten die Gelehrten oft im Exil eine neue Schule. Zu den Emigranten der almohadischen Verfolgung in Spanien zählte der in Córdoba geborene Moses ben Maimon, genannt Maimonides (1135–1204), einer der bedeutendsten Denker des Mittelalters überhaupt. Wie die meisten jüdischen Intellektuellen schrieb Maimonides in arabischer Sprache – zum Teil wurden seine Werke später ins Hebräische übersetzt; er kommentierte die Mischna und trug unter Rückgriff auf Aristoteles Wesentliches zur Verselbständigung der Philosophie im Judentum bei. Nach der Eroberung seiner Heimatstadt 1148 durch die Almohaden zog er zunächst nach Fès in Marokko, dann nach Fustat (Altkairo), wo er zum politischen und religiösen Oberhaupt der ägyptischen Juden wurde. Der Ruhm des Rabbis als Mediziner und Pharmazeut übertraf unter seinen Zeitgenossen bei weitem sein Ansehen als Philosoph; in den 70er Jahren war er sogar Leibarzt des ayyubidischen Machthabers Saladin in Kairo. Unglücklicher verlief die Lebenskurve des Gelehrten Meir Ben Baruch, geboren in Worms um 1220. Dieser hatte unter anderem in Nordfrankreich, vor allem in Paris, studiert, wo er Zeuge der christlich-jüdischen Disputation über den Talmud und der anschließenden Bücherverbrennung wurde (1242). Meir hatte sich in Rothenburg ob der Tauber niedergelassen, wo er sich ein überragendes Ansehen durch seine halachischen Entscheidungen, festgehalten in über 1000 Responsen, erwarb. Als König Rudolf von Habsburg den Anspruch auf Leib und Leben der Juden erhob, wollte Meir wie viele seiner Glaubensbrüder das Land verlassen und wohl ins Heilige Land auswandern, auch wenn dem ein Verbot des Königs entgegenstand (1286). Beim Alpentransit wurde er aber aufgegriffen und kam bis zum Ende seines Lebens (1293) nicht mehr frei, obwohl die deutsche Judenheit bereit war, für den berühmten Gesetzesgelehrten ein hohes Lösegeld zu zahlen.
Die Madrasa
Ähnlich wie das Judentum war der Islam eine Religion, die sich ohne institutionelle Hierarchie wie bei der christlichen Kirche durch die Reise (rihla) als Gemeinschaft konstituierte. Grundlegend war schon die Hedschra, also die Auswanderung Mohammeds mit seiner Gemeinde von Mekka nach Medina im Jahr 622 beziehungsweise die der Muslime von Mekka nach Abessinien 615 bis 622 n. Chr. Davon leitete sich die Verpflichtung ab, Länder zu verlassen, in der sich die religiöse Praxis des Islam nicht entfalten konnte. Herausragende Formen der Reisen waren die Pilgerfahrt nach Mekka und Medina (haddsch), die „fünfte Säule“ des Islam, die Devotion vor örtlich oder regional bedeutenden Schreinen (ziyara) und die Suche nach dem religiösen Wissen (talab al-‘ilm). Schon seit den frühesten Zeiten strebten die Muslime an herausragenden Stätten wie in Medina, Kairo oder Fès nach anspruchsvoller Unterrichtung, so dass die „Reise“ bis zum 10./11. Jahrhundert geradezu mit der „Suche nach dem Wissen“ gleichgesetzt wurde; erst seither scheint man rihla im Sinne von haddsch klar von talab al-‘ilm getrennt zu haben. Diese Differenzierung könnte mit der Institutionalisierung des Systems der Medresen zusammengehangen haben, die sich – vielleicht von buddhistischen Klöstern angeregt – vom östlichen Iran aus nach Westen verbreiteten – nicht aber nach al-Andalus. Die Madrasa trat an die Stelle der älteren, rein mündlichen Unterweisung, beruhte auf einer materiellen Ausstattung durch Stiftung, behielt aber die Art der Schulbildung um einen einzigen Lehrer bei, der einer bestimmten Richtung der verschiedenen Rechtslehren anhing. Dementsprechend hat Ibn Battuta auf seiner großen Rundreise weniger auf berühmte, hier und da unterrichtende Gelehrte als auf Gebäude geachtet, in denen das Recht vermittelt wurde oder wo Sufi-Konvente lebten.
Wissenschaftsvielfalt
Da Stiftungen in der Kultur des Islam nur frommen Zwecken gewidmet werden und keinesfalls gegen die Grundsätze des Koran verstoßen dürfen, waren die Lehrinhalte der Medresen auf eine der vier muslimischen Rechtsobservanzen und die zugehörigen theologischen Inhalte beschränkt. Für andere, den Arabern wertvolle Wissenszweige, neben Theologie Philologie, Literatur und Poetik, gab es keine gleichartigen Bildungseinrichtungen. Eine Lehre der „fremden“ Wissenschaften griechischer Tradition oder fernöstlichen Ursprungs war im Prinzip erst recht ausgeschlossen. Wer sich diesen widmen wollte – verboten war es nicht –, der musste es außerhalb der anerkannten Schulen, also privat, tun. Am besten eigneten sich dafür Bibliotheken. Als Patrone freien Lernens und Lehrens betätigten sich die Herrscher, die ihren Höfen dadurch weit ausstrahlende Anziehungskraft verleihen konnten. So schuf der Fatimidenkalif al-Hākim 1005 in seiner Residenzstadt Kairo ein Haus für die Pflege „aller Art von Wissenschaft und Bildung“. Den Mittelpunkt bildete eine einzigartige Sammlung von Büchern, die zum Teil aus seinem Palast kamen. Allen Menschen war es erlaubt, dort zu lesen, zu studieren und Abschriften zu machen. Unter den Lehrern werden Juristen, Koranleser, Grammatiker, aber auch Philosophen und Mediziner genannt, manche von ihnen vom Kalifen selbst bestellt. Der berühmteste Wissenschaftler war der Astronom Ibn Yunus (gest. 1009), der seine außerordentlich genauen Beobachtungen in einem Handbuch festhielt und in Tafeln zur Zeitmessung umsetzte, die in Kairo bis ins 19. Jahrhundert benutzt wurden; im Jahr 1012 begann man auch mit dem Bau eines Observatoriums.
Mäzenatentum muslimischer Machthaber
Ohne das Mäzenatentum muslimischer Machthaber, die Gelehrte verschiedener Kulturen und Sprachen zusammenführten und die Schriften der Alten sammelten, hätte es keine Tradition des vor- und außerislamischen Wissens gegeben, die nicht zuletzt der christlichen Welt des Mittelalters zugute kam. Das erste Zentrum dieser Art war Bagdad, die von den Abbasiden geschaffene Hauptstadt im Zweistromland, wo arabisierte und islamisierte Iraner in der Verwaltung nach allem Wissenswerten der Hellenen, Syrer und Inder für ihre Tätigkeit verlangten. Wie später al-Hākim in Kairo errichtete der Kalif al-Ma’mun (813–833) in seiner Residenz ein „Haus der Wissenschaft“, durch das er die systematische Übersetzung griechischer Literatur und die Weiterentwicklung von Philosophie und Naturwissenschaft förderte. Eine exemplarische Übersetzergestalt war Hunayn ibn Ishāq, ein nestorianischer Christ aus al-Hīra(h), der sich um die Übertragungen medizinischer Texte unmittelbar aus dem Griechischen verdient machte. Sein Sohn wandte sich Werken der Philosophie zu, die Gebrüder Banu Musa, die aus Chorasan stammten, engagierten sich besonders für Mathematik und Astronomie. Von Indern und Chinesen übernahmen die Araber nicht nur segensreiche Erfindungen wie (vermutlich) das Spinnrad und den horizontalen Trittwebstuhl, sondern auch ethische Lehren (Übersetzung des Fürstenspiegels »Pañcatranta«) und mathematische Kenntnisse. Das indische Zahlensystem, das mit neun Ziffern in einer dezimalen Stellenordnung auskam und das Rechnen enorm erleichterte, benutzte im westasiatischen Umkreis allerdings wohl erstmals ein Syrer, der Bischof Severos Sebokht (662). Vermutlich hatte er das System durch persische Vermittlung kennen gelernt, zumal er auch Aristoteles vom Persischen ins Syrische übersetzte. Wann die Araber selbst die von ihnen als „indisch“ bezeichneten Ziffern angewandt haben, lässt sich nicht sicher sagen; gut möglich, dass ihnen erst eine indische Gesandtschaft am Hof des Kalifen nach 770 das Wissen vermittelt hatte. Die Araber sind es dann aber wohl gewesen, die die Null erfunden haben – ohne sie als eigene Ziffer zu betrachten. Die freie Entfaltung der Wissenschaft geriet jedoch im Kalifat an ihre Grenzen, als al-Ma’mun eine eigene arabische Philosophie unterstützte; schon 849 setzten sich die opponierenden Religions- und Rechtsgelehrten wieder durch. Keineswegs hatte aber der Kalifenhof allein das „goldene Zeitalter“ der islamischen Kultur herbeigeführt, vielmehr sind gerade durch die politische Zersplitterung des „Hauses des Islam“ zahlreiche Fürstenhöfe entstanden, die kulturell miteinander rivalisierten. Auch in Städten ohne Residenzen hat es eine oder mehrere Bibliotheken gegeben. Zwischen den Höfen und Städten mit ihren Buchmagazinen und Schulen zogen die Studenten „von Meister zu Meister auf der Suche nach Wissen und Einsicht“ (Claude Cahen).
Wissenschaft in al-Andalus
Die frühen muslimischen Eroberungen hatten die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die im Orient ins Arabische übersetzten, kommentierten und selbständig fortentwickelten Werke griechischer und fernöstlicher Gelehrsamkeit ins lateinische Europa gelangten. Diese nahmen ihren Weg im Allgemeinen über die arabisch-berberischen Herrschaften in Spanien, teilweise wurden sie auch über das südliche Italien vermittelt. Zuwanderer aus dem Osten oder aus Afrika brachten die Texte mit, doch reisten ihre Nachkommen auch zu den Quellen, um sie zum Studium zu besitzen. In al-Andalus lassen sich zielstrebige Bemühungen um die Wissenschaft nicht vor Mitte des 10. Jahrhunderts erkennen; wie al-Ma’mun im Bagdad des 9. Jahrhunderts, waren es im muslimischen Spanien die Kalifen (‘Abd ar-Rahman III., al-Hakam II.) beziehungsweise die „Taifen“-, also Partikularherrscher (1031–1086) und später die almohadischen Fürsten, die als Liebhaber der Wissenschaft in Erscheinung traten. Die Muslime bildeten aber auch besondere Schulen aus, die weit über das Land verstreut waren. Das erste dieser Netzwerke war um den Astronomen und Mathematiker Maslama aus Madrid (gest. um 1007) zentriert, dessen Adepten allesamt das Werk von al-Chorismi und den Gebrauch der Sindhind (planetarische Theorie) beziehungsweise des Astrolab studierten. Fast in jeder Hauptstadt eines wichtigen Taifenreiches saß ein Angehöriger dieser Gelehrtengruppierung. Eine andalusische Schule für Agronomie mit Toledo als Mittelpunkt lässt sich seit Mitte des 11. Jahrhunderts fassen, und die Aristoteliker unter den Philosophen waren im 12. Jahrhundert auf Sevilla und um Ibn Tufail konzentriert, den der almohadische Emir förderte. Wem Vorhandenes nicht genügte, der begab sich in ferne Länder. So ging der aus Jaén stammende Mathematiker Ibn Mu’adh zwischen 1012 und 1017 nach Ägypten, wo er wohl die neue, erst kurz zuvor entwickelte Trigonometrie kennen lernte; jedenfalls verfasste er darüber eine seiner Abhandlungen in arabischer Sprache. Außerdem kommentierte er den Euklid und stellte astronomische Tafeln zusammen. Sein Zeitgenosse al-Udri (1003–1085) hatte in seiner Jugend gar zehn Studienjahre in Mekka verbracht und schrieb später ein geographisch-historisches Werk über die Provinzen von al-Andalus. Agronomischen Studien widmete sich, ebenfalls noch im 11. Jahrhundert, al-Udris Landsmann Ibn Bassal in Sizilien, Ägypten und Chorasan, während Abul Salt aus Denia, der über philosophische, astronomische und pharmakologische Probleme arbeitete, sich mit Alexandria und Kairo als Stätten neuer Anregungen begnügte. Im 13. Jahrhundert trieb es Yahya ibn Abi Shukr al-Andalusi bis zum mongolischen Observatorium in Maragha(h) (Aserbaidschan), so dass er nachher zu Hause über die chinesischen Beobachtungen zu Himmelskunde und Kalenderwesen berichten konnte. Neben der gelehrten Hochkultur, die im Wesentlichen höfisch geprägt war, stand in Andalusien, besonders seit 1086, das traditionelle Studium an den Moscheen, das sich auf die Exegese der heiligen Schriften beschränkte.