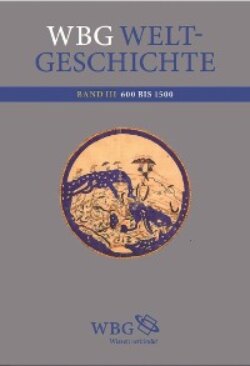Читать книгу wbg Weltgeschichte Bd. III - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеErnst-Dieter Hehl
„Mittelalter“
Das westliche Geschichtsbild versteht den Zeitraum, dem sich dieser Band der Weltgeschichte widmet, meist als „Mittelalter“. Ein Begriff, der auf die Abgrenzung einer europäischen Neuzeit von den vorausgehenden Jahrhunderten, auf deren neuartige Rückbindung an die antike Welt des Mittelmeerraums zielt, kann jedoch nicht als Leitfaden für eine weltgeschichtliche Darstellung dienen. Weder das Bewusstsein der historischen Kontinuität, in der mit Bezug auf das Römische Reich sich das oströmisch-byzantinische Reich bis zu seinem Untergang 1453 sah, noch die Entstehung der islamischen Welt im 7. Jahrhundert lassen sich mit der Vorstellung von einer mittleren Zeit fassen, der eine neue und erfüllte folgt, sie taugt nur als chronologische Chiffre.
Dreiteilung der Welt
Drei Ereignisketten können den fast tausendjährigen Zeitraum strukturieren. An ihnen lässt sich ein grundlegender Wandel zu der vorausgehenden Epoche erkennen, deren kulturelle und geographische Pole der Mittelmeerraum zusammen mit dem Vorderen Orient sowie der Ferne Osten bildete. Diese gleichsam zweigeteilte Welt wird im 7. und 8. Jahrhundert zu einer dreigeteilten, denn mit dem Islam tritt eine weit ausstrahlende Kultur in Erscheinung, die sich zwar variabel, aber doch stabil politisch etabliert. Vom Westen der südlichen Mittelmeerküste bis in das nördliche Indien und in zentralasiatische Gebiete erstreckt sich der islamische Herrschafts- und Einflussbereich. Es ist ein größerer Kultur- und Herrschaftsraum, als Alexander der Große zu schaffen vermochte, und er erlangte Dauer. Europa, speziell das lateinischwestliche, befand sich in einer Randlage. Sein Ausgreifen in den Vorderen Orient im Zeichen der Kreuzzüge blieb Episode. Im 13. Jahrhundert schlugen die Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Erben eine Brücke zwischen dem Fernen und dem Nahen Osten. Ihr Reich dürfte das größte sein, das sich bisher in der Welt überhaupt gebildet hat. Seine weitere Ausdehnung ist an den muslimischen Mamluken Ägyptens gescheitert. Zwischen 1200 und 1300 scheint die alte Welt stärker vernetzt gewesen zu sein als jemals zuvor. Erst mit ihren Entdeckungsfahrten gewannen die Europäer seit dem 15. Jahrhundert maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Welt. Das geschah jedoch nicht deshalb, weil sie das politische Übergewicht über die Muslime gewonnen hatten. Diese fanden vielmehr nach dem Zerfall des Mongolenreichs unter den Osmanen zu neuer, bis in das 18. Jahrhundert andauernder Stärke. Allein im westlichen Mittelmeerraum hatten die christlichen Mächte durch die Erfolge der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, gipfelnd in der Eroberung Granadas (1492), die Oberhand gewonnen. Von dort aus versuchten sie den muslimischen Machtkomplex zu umgehen, indem sie den Weg nach Indien und in den Fernen Osten über das Meer suchten. Gefunden haben sie gleichzeitig einen neuen Kontinent: Amerika.
Großräumige Vernetzungen
Der Islam und die Mongolen sind im „Mittelalter“ die eigentlichen Träger einer politisch großräumigen Vernetzung. Diesen Zeitraum aus einer überwiegend europäischen Perspektive zu betrachten, führt in die Irre. Deshalb sollen im vorliegenden Band vielmehr die Eigenständigkeiten der muslimischen und asiatischen Reiche und Kulturen herausgestellt werden. Einleitend zu behandeln ist aber auch die Vielfalt des Christentums. Gerade auf Grund dieser Vielfalt, die oft nicht auf einer politischen Machtbasis aufbaute, stellten auch die Christen ein „globales“ Element des Mittelalters dar. Ohne politische Machtbasis waren auch die Juden in ihrer Diaspora; der Buddhismus entfaltete in China seine Wirksamkeit, ohne zur „Staatsreligion“ zu werden.
Die christlichen Welten
Das Christentum gilt heute als religiöses Kennzeichen der westlichen Welt; auch in seinen säkularisierten Erscheinungsformen übt es immer noch entscheidende Einflüsse auf diese aus. Der Blick richtet sich dabei sowohl auf die römisch-lateinische Form des Christentums, die sich unter der Leitung des Papsttums als römisch-katholische Kirche organisiert, als auch auf die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts aus dieser hervorgegangenen Kirchen und Glaubensströmungen. Der historischen Vielgestalt des Christentums trägt diese religiös grundierte Konstruktion einer westlichen Welt wenig Rechnung. Kaum berücksichtigt werden die griechisch-orthodoxen Kirchen und ihre Entsprechungen im östlichen Europa. Ignoriert wird die seit der Spätantike kontinuierliche Existenz christlicher Staaten und ihrer Kirche wie Georgien, Äthiopien und in gewissem Maße auch Armenien; übergangen werden die syrisch-orientalischen Kirchen mit ihrer langen Geschichte.
Christentum = Westen?
Warum sich aber eine solche Gleichsetzung des Westens mit der lateinischen Form des Christentums und seinen Ableitungen vornehmen lässt, ist in Entwicklungen begründet, die vom 7. bis 15. Jahrhundert stattfanden. Denn am Ende des 15. Jahrhunderts war allein die lateinische Kirche in den Staaten etabliert, von denen die Entdeckungsfahrten, die europäische Expansion und damit die Herausbildung der westlichen Welt ausgingen. Neben Portugal und Spanien, den anfänglichen Trägern dieses Ausgreifens, traten dann seit dem 16. und 17. Jahrhundert das reformierte Holland und vor allem England, dessen Hochkirche und reformierte Kirche sich aus der römisch-lateinischen Kirche gelöst hatten. Die griechisch-orthodoxe Kirche hatte mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das östliche christliche Kaisertum als staatlichen Bezugspunkt verloren. Über den russischen Raum und seine Kirche erstreckte sich bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts die Vorherrschaft der Goldenen Horde. Dieses mongolische Reich bekannte sich im frühen 14. Jahrhundert zum Islam. Sowohl unter dem Nowgoroder Großfürsten Alexander Newskij (†1263) als auch unter dem sich aus der mongolischen Vorherrschaft lösenden Großfürstentum Moskau ist eine kirchliche Abgrenzung vom Westen zu beobachten. Die Politik der Großfürsten selbst zielt auf die „Sammlung der russischen Erde“, die Expansion in der Frühen Neuzeit ist nach Osten gerichtet und kontinental bestimmt. Deshalb hat die russische Kirche einen geringen Anteil an der Entwicklung des Christentums zu einer weltumspannenden Religion. Geographische Lage, politische Umstände und eigene Tradition haben die russische Kirche auf ihre kontinentalen Nachbarn ausgerichtet.
Die Ausbreitung des Christentums.
Bereits mit der frühen Expansion des Islam im 7. Jahrhundert hatten die Christen des Vorderen Orients, Ägyptens und Nordafrikas ihren Rückhalt bei einer christlichen Herrschaft eingebüßt. Bis zu den wachsenden Erfolgen der Reconquista seit dem 11. Jahrhundert galt das auch für den größten Teil der Christen auf der Iberischen Halbinsel. So sind es vor allem politische Faktoren, wegen derer die westlich-lateinische Kirche und Christenheit zum religiösen Kennzeichen von Verwestlichung und Globalisierung geworden sind. Dass sich die lateinische und die griechische Kirche zunehmend auseinanderlebten und sich schließlich endgültig voneinander trennten, verstärkte diese Entwicklung. Als die Lateiner 1204 auf dem Vierten Kreuzzug Konstantinopel eroberten, zerstörten sie nämlich gleichzeitig die Möglichkeit, die 1054 zerbrochene Einheit wiederherzustellen, was früher bei den lateinisch-griechischen Auseinandersetzungen immer wieder gelungen war. Im heutigen Geschichtsbewusstsein ist jedenfalls die Vorstellung von der Vielgestalt, die das Christentum in der Spätantike gewonnen hatte und mancherorts bis in die Gegenwart bewahren konnte, weitgehend verloren gegangen.
600 als Epoche
Um das Jahr 600, mit dem dieser Band der »Weltgeschichte« einsetzt, zeigt sich eine doppelte Entwicklung: Die westlich-lateinische Christenheit gewann neue Einheitlichkeit, während für den Osten christliche Vielfalt charakteristisch blieb. Politische und dogmatische Entwicklungen stehen dahinter. Die Restaurationspolitik des römischen Kaisers Justinian hatte mit dem nordafrikanischen Reich der Vandalen und dem Ostgotenreich in Italien zwei der germanischen Königreiche besiegt, die auf dem Boden des Imperiums entstanden waren und der arianischen Richtung des Christentums folgten. Nachdem das Konzil von Nicäa 325 diese Lehre verurteilt und sich in einem längeren Prozess die Lehre der Wesensgleichheit von Gottvater und Gottsohn im Imperium durchgesetzt hatte, markierte der Gegensatz Arianismus – Orthodoxie eine Grenze zwischen germanischer und romanischer Bevölkerung. An der Wende vom 5. zum 6. Jahrhunderts hatten sich die Franken unter Chlodwig direkt der katholischen Form des Christentums zugewandt, am Ende des 6. Jahrhunderts traten der westgotische König und sein Reich vom Arianismus zum Katholizismus über. Die Langobarden, die in das Machtvakuum Italiens eingedrungen waren, schwankten einige Zeit zwischen arianischem und katholischem Christentum, bis auch sie sich auf Dauer zum Katholizismus bekannten. In der Mitte des 7. Jahrhunderts waren die arianischen Formen des Christentums erloschen. Der lateinische Westen folgte mit dem Katholizismus der Form des Christentums, die auch die Reichskirche des Ostens prägte.
Probleme der Reichskirche
Hier gestalteten sich die Verhältnisse schwieriger. Christologische Auseinandersetzungen erschütterten Kirche und Reich im Osten. Wenn Christus Gott sei, in welchem Verhältnis standen dann seine menschliche und göttliche Natur zueinander? Das waren auch Diskussionen darüber, mit welchen Methoden die biblischen Texte zu interpretieren seien. Folgte man in Antiochia einer eher wörtlichen Interpretation und betonte die menschliche Natur Christi, so ließ die theologische Schule des ägyptischen Alexandria die menschliche Natur Christi gleichsam in der göttlichen aufgehen. Diese theologischen Auseinandersetzungen verknüpften sich mit einer Rivalität zwischen den Patriarchatssitzen von Antiochia und Alexandria. Der Patriarch von Konstantinopel wurde als geistlicher Führer der Reichshauptstadt in diese Konflikte einbezogen, der Kaiser wollte ihnen steuern, um die religiöse Einheit des Reiches zu bewahren. Dem Konzil von Chalkedon (451) gelang es nicht, den Konflikt zu beenden, als es die Gleichrangigkeit und Unvermischtheit der göttlichen und menschlichen Natur Christi feststellte. In Ägypten bildeten sich zwei rivalisierende Kirchen, von denen die eine der chalkedonensischen Lehre folgte und deshalb der Reichskirche zuzählen ist, während die andere an ihrer älteren Theologie festhielt, was nun als Monophysitismus (Einnaturenlehre) gebrandmarkt wurde. Die antiochenische Theologie fand eine neue Heimstatt bei den syrischen Christen außerhalb des Reiches, die sich zunehmend an den Lehren des Patriarchen Nestorius von Konstantinopel orientierten, den das Konzil von Ephesos 431 als führenden Kopf der antiochenischen Christologie verurteilt hatte. Für die Religionspolitik des Imperiums spielten diese „Nestorianer“ eine nur untergeordnete Rolle. In der syrischen Christenheit stand ihnen in der syrisch-orthodoxen Kirche eine monophysitisch orientierte Glaubensgemeinschaft (Jakobiten) gegenüber. Die „Monophysiten“ Ägyptens in die Reichskirche zu integrieren, gelang jedoch nicht. Glaubensformeln, mit denen der Kaiser und die östliche Reichskirche einen Ausgleich vermitteln wollten, scheiterten nicht nur, sondern führten auch zu heftigen Konflikten mit der westlich-lateinischen Kirche, die strikt an den Definitionen von Chalkedon festhielt.
Christentum und islamische Expansion
Die Entstehung des Islam und die blitzartige Ausbreitung islamischer Herrschaft unter den ersten Kalifen hatten für das Christentum unterschiedliche Konsequenzen. Nur auf der Arabischen Halbinsel führten sie zu einem Ende des christlichen Glaubens sowie des Judentums; hier duldete der Islam keine Religion neben sich. Außerhalb ihres Kernlandes verzichteten die arabischen Eroberer jedoch auf die gewaltsame Ausbreitung ihres Glaubens unter Juden und Christen, denen als „Schriftbesitzer“ zwar ein minderer Rechtsstatus zugewiesen, doch gleichzeitig Schutz gewährt wurde. Vor allem die monophysitischen Christen waren durch die islamische Herrschaftsbildung den Repressionen durch die Reichskirche entzogen und unterstanden nun einer gegenüber den innerchristlichen Streitpunkten neutralen Herrschaft. In ihrem Kernland Ägypten sicherten sie sich das Übergewicht gegenüber den Anhängern der chalkedonensischen Reichskirche (Melkiten). In Alexandria herrschte ein Schisma unter den ägyptischen Christen an, hier residierten zeitweise zwei Patriarchen, ein koptischer (monophysitischer), der 1077 seinen Sitz in die fatimidische Hauptstadt Kairo verlegte, und ein melkitischer. Der melkitische Patriarch stellte bis in das 14. Jahrhundert das diplomatische Bindeglied der in Ägypten jeweils herrschenden Muslime zum byzantinischen Kaiser dar; der koptische war politisch bedeutsam, weil die Christen Numidiens und Äthiopiens in ihm ihr geistliches Oberhaupt sahen. Für die Nestorianer wechselte nur die Religionszugehörigkeit der Herrschaftsträger. In Ägypten und dem Vorderen Orient einschließlich des Zweistromlandes bedeutete die Errichtung der islamischen Herrschaft kein Ende des Christentums. Doch waren die Christen der Versuchung ausgesetzt, sich durch den Übertritt zum Islam einen rechtlich besseren Status zu verschaffen, und unterlagen politisch und religiös bedingten Schwankungen in der Religionspolitik ihrer Herren, die sich auch in einem rabiaten Vorgehen gegen nichtmuslimische Untertanen äußern konnten.
In diese Zusammenhänge gehört die Zerstörung der Grabeskirche in Jerusalem, die der fatimidische Kalif al-Hākim 1009 verfügte. Sie ist wohl aus innerägyptischen Spannungen zwischen der ismaelitisch-schiitischen Führungsschicht und den Sunniten, die die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung stellte, und damit überhaupt in die Spaltung des Kalifats der damaligen Zeit (sunnitsch-abbasidisch in Bagdad; schiitisch-fatimidisch in Kairo, 969–1171; sunnitsch-omaijadisch in Córdoba, 929–1031) einzuordnen sowie in den schlichten Finanzbedarf des Kalifen, dem auch jüdische Einrichtungen ihren Tribut zu zollen hatten. Mit einer grundsätzlichen Christenfeindschaft hat das wenig zu tun; al-Hākim selbst beendete 1019 diese Repressalien. Seine guten Beziehungen zum byzantinischen Kaiser, der sich weiterhin als Schutzherr der Christen in den an die Muslime verlorenen Gebieten des Imperiums fühlte, wurden durch die Verfolgungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt.
Islamische Welten um 1300.
Asien
Das nestorianische Christentum erlebte unter muslimischer Oberherrschaft für mehrere Jahrhunderte seine Blütezeit. Sein Oberhaupt Timotheus I. (780–823) hatte seine Residenz nach Bagdad, an den Sitz des Kalifen verlegt. Nestorianische Christen hatten durch Übersetzungen griechischer Philosophen, wie Aristoteles, und Wissenschaftler erheblichen Anteil an der Rezeption antiken Wissens durch die Muslime, die in diesem Bereich seit dem 12. Jahrhundert verstärkt auf die westlich-lateinische Christenheit einwirkten. Bagdad schließlich wurde zum Zentrum der Ausbreitung des nestorianischen Christentums bis nach China. Erst der Übertritt der mongolischen Ilkhane zum Islam beendete die Blüte des nestorianischen Christentums im nördlichen Syrien und im Zweistromland. Im heutigen Grenzgebiet von Syrien, Irak und Iran hat es als „Apostolische Kirche des Ostens“ bis heute überlebt. In Zentralasien ist es den Feldzügen Timurs (Tamerlan, gest. 1405) zum Opfer gefallen, seine indischen Niederlassungen an der Malabarküste (Thomaschristen) haben sich im 16. Jahrhundert den Portugiesen und damit der römischen Kirche angeschlossen. Spuren der missionarischen Bemühungen der Dominikaner aus dem 14. Jahrhundert fanden die Portugiesen nicht mehr vor, jedoch erschien ihnen die auf Syrisch verfasste religiöse Literatur der Thomaschristen so häretisch zu sein, dass sie diese zum größten Teil vernichten ließen. Den Missionserfolgen der römischen Kirche, die vor allem den neuen Orden der Dominikaner und Franziskaner zu verdanken waren, hatte in China die Beseitigung der mongolischen Herrschaft und die Etablierung der Ming-Dynastie (1368) ein Ende bereitet. Im westlichen und inneren Asien überlebten sie nicht die Eroberungszüge Timurs. Auf der Krim, im genuesischen Caffa, bestand bis zur Eroberung der Stadt durch die Osmanen (1475) ein katholisches Bistum, das zum Ausgangspunkt neuer missionarischer Bemühungen hätte werden können.
Afrika
Das am oberen Nil in Nubien und Äthiopien existierende Christentum ist in seinen Glaubensinhalten von den monophysitischen Christen Ägyptens beeinflusst worden und blieb organisatorisch deren Patriarchen verbunden Die Mamluken haben seit dem 13. Jahrhundert die nubischen Herrschaftsbildungen zunehmend bedrängt, die dann im 14. Jahrhundert zerfallen sind und islamisiert wurden. Äthiopien hingegen konnte sich als christlicher Staat behaupten und im 14. Jahrhundert sogar eine expansive Politik gegenüber seinen muslimischen Nachbarn betreiben. Im frühen 16. Jahrhundert fand es in den Portugiesen einen christlichen Bundesgenossen. In Nordafrika ist das Christentum in einem längeren Prozess untergegangen. Eine Zeitlang hatten hier melkitische Flüchtlinge vor den Arabern Zuflucht gefunden, unter ihnen Maximus der Bekenner (†662), einer der heftigsten Kritiker der auf Ausgleich zwischen den Anhängern und Gegnern Chalkedons zielenden Religionspolitik Kaiser Herakleios’ und seiner Nachfolger. Der Zusammenbruch dieser Kirche ist überraschend und kaum rekonstruierbar. Bis in das 12. Jahrhundert lassen sich Bischöfe in Nordafrika nachweisen, die letzten Spuren eines autochthonen Christentums verschwinden nach 1400.
Spanien
Auf der Iberischen Halbinsel, die 711 von der muslimischen Expansion erreicht wurde, ist das Christentum nach dem Untergang des Westgotenreichs unter der neuen muslimischen Herrschaft nie verschwunden. Unter muslimischem Schutz wurde hier vielmehr die christologische Debatte fortgeführt, die das Geschick der östlichen Christenheit nach Chalkedon bestimmt hatte. Von Toledo ausgehende Vorstellungen, Christus sei der Adoptivsohn Gottvaters, bedeuten einerseits eine Annäherung an den strengen Monotheismus des Islam, andererseits bezeugen sie das fortbestehende theologische Interesse und die intellektuellen Kapazitäten der spanischen Christenheit. Für Karl den Großen, den Frankenherrscher, boten diese Lehren hingegen den Anlass, sich als Hüter der katholischen Orthodoxie zu erweisen.
Rolle der Patriarchen
Der islamischen Expansion und Herrschaft kommt nicht allein Bedeutung für die Christen der jeweiligen Regionen zu. Es steigerte sich nämlich gleichzeitig die Bedeutung der beiden Patriarchensitze, die von dieser Expansion nicht erreicht wurden. Sowohl Rom als auch Konstantinopel wurden nun zu den unbestrittenen Führern der chalkedonensisch orientierten Christenheit, sie allein verfügten über autonome Handlungsmöglichkeiten, wobei der Patriarch von Konstantinopel weiterhin in die kaiserliche Politik eingebunden war. Die Patriarchen von Antiochia und Alexandria hatten ihre gesamtkirchliche Kompetenz eingebüßt, die gerade ihrem Amtsbruder in Konstantinopel in den religiösen Streitigkeiten seit dem 4. Jahrhundert so große Schwierigkeiten gemacht hatte. In der westlich-lateinischen Christenheit war mit Nordafrika ein wichtiges Zentrum theologischer Reflexion verloren gegangen und eine Kirche zur Wirkungslosigkeit verurteilt, die gegenüber dem Zentralismus der römischen Kirche wiederholt auf ihrer Eigenständigkeit und der Notwendigkeit des gleichberechtigten Zusammenwirkens bestanden hatte.
Griechen und Lateiner
Der Patriarch von Konstantinopel hatte in der Hauptstadt des Imperiums seinen Sitz, seine kirchliche Politik musste Rücksicht auf den Kaiser nehmen. Der Patriarch des Westens, der römische Bischof, residierte hingegen am Rande des politischen Zentrums der lateinischen Welt, wo Italien an Bedeutung verloren und sich mit dem Aufstieg der Franken und dem Kaisertum Karls des Großen (800) der Schwerpunkt nach Norden verlagert hatte. Als die ostfränkisch-deutschen Könige seit Otto dem Großen das westliche Kaisertum (962) auf Dauer in ihren Besitz brachten, hat sich an dieser Randlage nichts geändert. Die römischen Bischöfe und Päpste konnten somit unabhängiger agieren als ihr Gegenüber in Konstantinopel. Gingen diese von einer Gleichberechtigung der Patriarchensitze aus, wobei sie unter den östlichen nach der muslimischen Expansion auch faktisch einen Vorrang besaßen, so hielt der römische Bischof als Nachfolger auf dem Bischofsstuhl des heiligen Petrus an dem Primat seiner Kirche und ihrer Bischöfe, der Päpste, fest. Theologisch begründet wurde dieser Primatsanspruch zudem damit, dass die römische Kirche niemals geirrt habe oder vom wahren Glauben abgefallen sei. Unterschiedliche Lehrmeinungen sind auf diese Weise zu einem Mittel der Auseinandersetzung geworden. Geringfügige Unterschiede in der Formulierung des Glaubens und im liturgischen Vollzug ließen sich als Beleg für Häresie und Glaubensabfall werten. Politische Konflikte zwischen Rom und Konstantinopel ließen sich religiös überhöhen.
Konkrete Konflikte bestanden seit dem frühen 8. Jahrhundert, als der Kaiser das Illyricum dem Papst entzog und dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellte, ebenso mit Süditalien und Sizilien die Regionen Italiens, in denen Byzanz damals eine noch unangefochtene Herrschaft ausübte. Im 9. Jahrhundert verband sich der Streit um das Illyricum mit dem Problem, ob die Bulgaren von Rom oder von Konstantinopel aus zu missionieren und diesen Patriarchaten zuzuordnen seien. In diesen Streitigkeiten warfen sich die beiden Kirchen ihre unterschiedlichen Bräuche vor. Der Patriarch Photios prangerte zudem an, im Westen werde die Lehre geduldet, der Heilige Geist gehe von Gottvater und Gottsohn aus, während die spätantiken Glaubensdokumente ihn nur vom Vater ausgehen ließen. Mit diesem Streit um das filioque war ein in der Folgezeit immer wieder belebter Streitpunkt beider Kirchen benannt. Im 11. Jahrhundert kam die Auseinandersetzung dazu, ob bei dem Messopfer ungesäuertes Brot, wie es der jüdischen Paschasitte entsprach und in der lateinischen Kirche praktiziert wurde, oder gesäuertes Brot zu verwenden sei. Gleichzeitig führte die Errichtung der normannischen Herrschaft in Süditalien und die Verdrängung der Byzantiner zu dem Problem, ob hier eine lateinische und damit auf Rom bezogene Kirchenorganisation einzurichten sei und an die Stelle der byzantinischen treten solle. 1054 eskalierte der Konflikt: Der von Papst Leo IX. zu eher politischen Verhandlungen als Legat nach Konstantinopel entsandte Kardinalbischof Humbert von Silva Candida exkommunizierte den Patriarchen Michael Kerularios und wurde im Gegenzug selbst von diesem exkommuniziert.
Verfestigung der Kirchenspaltung
Eine dauernde Kirchenspaltung war mit diesen gegenseitigen Exkommunikationen nicht beabsichtigt, und doch hat sie sich daraus entwickelt. Papst Urban II. wollte 1095 mit dem Kreuzzug dem von den Seldschuken bedrängten Byzanz zu Hilfe kommen und hoffte auch auf kirchenpolitischen Ausgleich. In Wirklichkeit steigerten die Kreuzzüge jedoch die Entfremdung zwischen der lateinischen und griechischen Christenheit. Die Lateiner sahen in der mangelnden Unterstützung durch die Byzantiner Verrat und witterten Häresie. Die Griechen erblickten in der Errichtung einer lateinischen Kirchenorganisation im Heiligen Land, wo in Antiochia und Jerusalem lateinische Patriarchen eingesetzt wurden, einen unrechtmäßigen Übergriff der römischen Papstkirche. Die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204), die Errichtung des Lateinischen Kaiserreichs und die Einsetzung eines lateinischen Patriarchen führte zu dem endgültigen Bruch zwischen beiden Kirchen. Dass Papst Innozenz III. damals auch einen lateinischen Patriarchen für Alexandria ernannte und damit alle vier östlichen Patriarchen auf Rom ausgerichtet sein sollten, zeigt, dass auch die lateinische Kirche 1204 zu einem generellen „Neuanfang“ nutzen wollte. Das scheiterte an der Beharrungskraft der griechischen Kirche: Auf eine Union unter Führung des Papsttums ließ sich diese nicht ein. Selbst als der byzantinische Kaiser und der griechische Patriarch von Konstantinopel eine solche in Zeiten höchster Not vereinbarten, um die Lateiner zu Bundesgenossen im Kampf gegen die Osmanen zu gewinnen, konnten sie eine auf den Konzilien von Lyon 1274 und Florenz 1439 vereinbarte Union nicht durchsetzen.
Mission
Die christliche Kirche, die im Mittelalter den größten Raum erfasste, war die nestorianische. Als lateinische Missionare im 13. Jahrhundert an den Hof des mongolischen Großkhans im Fernen Osten kamen, fanden sie dort Nestorianer, auf ihrem Weg dorthin waren sie immer wieder auf nestorianische Gemeinden und Kirchen gestoßen. Das Zentrum der Nestorianer war Bagdad, der nestorianische Katholikos war Nachbar des muslimischen Kalifen. Und offensichtlich legte dieser der christlich-nestorianischen Mission in Gebieten, die herrschaftlich nicht muslimisch organisiert waren, keine Steine in den Weg, solange es nicht zu christlichen Herrschaftsbildungen kam. Die nestorianische Mission erfolgte ohne staatliche Rückendeckung. Sie war wie die frühchristliche auf die freiwillige Annahme des Glaubens angewiesen, wie es einer nie aufgegebenen christlichen Überzeugung entsprach. Dass solch freiwillige Annahme des neuen Glaubens in den sozialen Bindungen von Familie und größerer Verbandsbildungen erfolgte, politischer Absicherung diente oder neue Chancen schaffen sollte, lässt sich bei den Missionierungs- und Christianisierungsprozessen in Europa genauer verfolgen. Annahme des Christentums durch einen Herrscher vermochte dessen Selbständigkeit gegenüber einem bereits christlichen Nachbarn zu schützen. Speziell die lateinische Kirchenorganisation ermöglichte es, durch die Errichtung von Erzbistümern sowohl kirchliche als auch politische Unabhängigkeit gegenüber einem benachbarten christlichen Reich zu behaupten. Der Papst, ohne dessen Billigung kein Erzbistum gegründet werden konnte, wurde auf diese Weise zum Beschützer neuer Königreiche. Für Polen und Ungarn lassen sich derartige kirchliche Verselbständigungsprozesse im 10. Jahrhundert verfolgen; im 12. Jahrhundert verknüpften sie sich hinsichtlich Skandinaviens mit dem Konflikt zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und dem Papsttum. Auf diese Weise haben Missionierung und Christianisierung einerseits zur religiösen Einheitlichkeit, andererseits zur politischen Vielfalt des lateinischen Europa beigetragen. Ausbreitung des Christentums durch blanke Gewalt, Zwangsmission bei gleichzeitiger politischer Unterwerfung bildeten eher die Ausnahme. Ein frühes Beispiel dafür sind die Sachsenkriege Karls des Großen, die mit der Ausdehnung des Frankenreichs bis an die Elbe endeten. Doch schon bei den bald darauf folgenden Kämpfen gegen die Awaren forderte Karls wichtigster kirchlicher Berater Alkuin, von derartig gewalttätigen Missionsmethoden abzulassen. Im Inneren der christlichen Reiche sind Juden wiederholt zum Opfer von Zwangstaufen geworden. Dass dies der offiziellen Lehre der Kirche widersprach, hat ihnen wenig geholfen. Denn die einmal gespendete Taufe galt als gültig. Nur im Vorfeld versprach ein amtskirchliches Eingreifen Erfolg. So konnte Bernhard von Clairvaux der Judenhetze eines Kreuzzugspredigers entgegentreten, der die Juden vor die Alternative „Taufe oder Tod“ stellen wollte; doch hat er selbst gleichzeitig den Kreuzzug gegen die heidnischen Slawen östlich der Elbe unter solchen Vorzeichen begründet. In ihnen glaubte Bernhard Gegner des Christentums zu sehen, die „freiwillig“ ein Bündnis mit dem Teufel eingegangen waren, der auf diese Weise den Kreuzzug in den Orient und die Bekehrung der Heiden generell behindern wollte. Die Christianisierung Preußens, wo der Deutsche Orden schließlich seinen „Staat“ errichtete, erfolgte im Zeichen von Gewaltmission und Unterwerfung. Die kreuzzugsähnlichen „Preußenfahrten“ verbanden sich mit der Christianisierung Litauens, doch sicherte 1385 der Großfürst Władysław II. Jagiełło durch seine Taufe dessen Unabhängigkeit und erlangte gleichzeitig die polnische Königskrone.
Osma-Beatus-Karte (1086). Die von einem Heiligenschein umrahmten Häupter der zwölf Apostel sind systematisch über die bewohnte Erde verteilt. Siehe auch S. 66.
Liturgische Sprachen
Kirchenpolitische Konkurrenz zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche und den hinter diesen stehenden Reichen wirkte auf die Missionierung und Christianisierung des europäischen Raumes ein und eröffnete den „Betroffenen“ Spielräume. Im 9. Jahrhundert schwankten die Bulgaren, ob sie sich der Mission durch die römische oder die griechische Kirche öffnen sollten, das Gleiche wiederholte sich im 10. Jahrhundert bei der Christianisierung Russlands. In beiden Fällen fiel die Entscheidung zu Gunsten des Patriarchen von Konstantinopel. Die fränkischbayerischen Bischöfe vermochten hingegen ihre Missionsbestrebungen in Böhmen und Mähren gegen die „Slawenapostel“ Kyrill und Method abzusichern. Vor allem deren Gebrauch des Slawischen als Sprache der Liturgie stieß auf heftigen Widerstand, obwohl sich Kyrill und Method dabei zeitweise auf die päpstliche Billigung stützen konnten. Es entstand eine kirchliche Teilung Europas in einen an Rom orientierten Bereich lateinischer Liturgiesprache und einen an Konstantinopel ausgerichteten Raum, der sich in der Liturgie entweder des Griechischen oder des Kirchenslawischen bediente. Die von Kyrill und Method favorisierte Verwendung der Volkssprache als liturgische Sprache in den zu missionierenden Gebieten eröffnet eine neue Entwicklung: Bis dahin bestimmte die liturgische Sprache der Kirchen, von denen die Mission ausging, die Sprache der neu errichteten Kirchen. Syrisch war zum Beispiel die Kirchensprache der Nestorianer auch im fernen Ostasien, das ägyptische Koptisch die der Äthiopier. Diese Kirchen blieben nicht allein organisatorisch, sondern auch sprachlich untereinander verbunden. In der von Konstantinopel ausgehenden Mission kam es hingegen zur Ausbildung von zwei Kirchensprachen, des althergebrachten Griechischen und des Kirchenslawischen. Die Verbindung zur Kirche von Konstantinopel wurde durch Entsendung von Griechen auf die wichtigsten Bischofssitze der missionierten Kirchen geschaffen. In der russischen Kirche war Kyrill von Kiew (1249–1281) der erste Metropolit slawischer Herkunft. Erst nach dem Sturz Erzbischof Isidors von Moskau, wohin der Metropolitansitz im 14. Jahrhundert verlegt worden war, setzte eine ununterbrochene Reihe von Metropoliten russischer Herkunft ein. Isidor hatte die in Florenz vereinbarte Union zwischen der lateinischen und griechischen Kirche befürwortet und selbst an dem Konzil (1438–1439) teilgenommen. Nicht allein die Union ist gescheitert, sondern der Plan hat auch zu einer weiteren Verselbständigung der russischen Kirche gegenüber dem Patriarchat von Konstantinopel beigetragen. Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 überdeckte diese Entwicklung. Ihren Abschluss fand sie in der Gründung des Moskauer Patriarchats 1589. Doch inzwischen sahen sich die Großfürsten von Moskau als die Erben des byzantinischen Kaisertums.
Christianisierung und Schriftlichkeit
Missionierung und Christianisierung waren mühsame, lang andauernde Prozesse der Akkulturation der „Bekehrten“. Das historische Wissen über deren Kultur ist in vielen Fällen nur aus den Berichten der Missionierenden und aus archäologischen Quellen geschöpft. Gerade die Räume außerhalb der alten Hochkulturen verdanken der Christianisierung und Missionierung oft die Entstehung einer eigenen Schriftlichkeit. Diese erlaubte es nun, die eigene Geschichte – einschließlich der Zeit vor der Annahme des neuen Glaubens und des Christianisierungsprozesses selbst – zu fixieren und zu interpretieren. Bewusstsein von Eigenständigkeit und Einfügung in ein christliches „Ganzes“ konnten sich hierbei miteinander verschränken. Die unterschiedliche Behandlung der Volkssprache in der von Rom oder von Konstantinopel ausgehenden Mission zeitigte jeweils lang nachwirkende Konsequenzen. In den Gebieten volkssprachlicher Liturgie waren die Bildungs- und Wissensunterschiede zwischen Klerikern und Volk geringer als in den Räumen, die an fremdsprachiger Liturgie festhielten. Der Zugang des Einzelnen zu Glaubensinhalten war unmittelbarer. Räume mit liturgisch begründeter Zweisprachigkeit erleichterten hingegen Kommunikation über weite Entfernungen – und auch lange Zeiten. Das Festhalten am Lateinischen als Liturgiesprache im „Westen“ lenkte nämlich gleichzeitig das Interesse auf die dadurch sprachlich zugängliche antike Literatur und ermöglichte Kontinuitäten und Neubelebungen des Wissens, die für das lateinische Europa konstituierend wurden, während sie im griechischsprachigen Byzanz nie abgerissen waren.
Christliche Ehenormen
Die schwerwiegendste Folge der Christianisierung Europas dürfte jedoch die Durchsetzung der Einehe und das Verbot der Verwandtenehe gewesen sein. Augustinus hatte in der Spätantike auf die gesellschaftlichen Folgen des biblischen Verbotes der Verwandtenehe hingewiesen. Es vergrößere den Kreis derjenigen, die durch Liebe, Verschwägerung und Freundschaft untereinander verbunden seien, und erhöhe so die Chance auf Frieden unter den Menschen. Das blieb Illusion. Nicht allein der als Verteidigung begriffene Kampf gegen Fremde und Andersgläubige, sondern auch die Auseinandersetzung unter Verwandten waren bestimmende Elemente des politischen Lebens.
Erst am Ende des Mittelalters lässt sich das Christentum als ein einheitliches begreifen. Aber das gilt nur in dem Sinn, dass nur noch das lateinische Christentum über eigenständige Handlungsmöglichkeiten verfügte; seine Vielgestalt hatte das Christentum jedoch bewahrt.
Vielfalt der Welt
Vielfalt der Welt ist deshalb auch die Leitlinie dieses Bandes. Die Welt, deren Geschichte nachgezeichnet wird, ist letztlich noch die Welt der antiken Oikumenen, die in Band II im Mittelpunkt stand. Sie erstreckt sich von Europa, das mehr und mehr erschlossen wird, bis hin nach Island und Grönland, über das vordere und mittlere Asien und Indien bis nach China, Japan und Korea. Das nördliche Afrika gehört zu dieser Oikumene, und hier bildet Ägypten wie in den Jahrtausenden zuvor einen Kernraum. Das nilaufwärts gelegene Nubien und Äthiopien bleiben dieser Welt verbunden, Äthiopien gewinnt sogar durch das gegenüberliegende Arabien neue Bedeutung. Arabische und indische Händler kennen die Ostküste Afrikas bis Madagaskar. Das westliche Afrika südlich der Sahara ist mehr als ein Raum, aus dem der Norden Gold und Sklaven importierte und der von islamischen Expansionen erreicht wurde. Neben indigenen Kräften sind ältere Zusammenhänge mit den antiken Oikumenen bei den Reichsbildungen in diesem Raum zu bedenken.
Ein Geflecht von Kommunikationen ermöglicht es, die Geschichte des soeben skizzierten Raumes als „Weltgeschichte“ zu beschreiben. Amerika, die Neue Welt, liegt noch außerhalb dieses Kommunikationssystems und findet in dem vorliegenden Band keine explizite Berücksichtigung. „Weltgeschichte“ beruht nicht auf geschichtsphilosophischer Konstruktion, sondern auf der schlichten Tatsache, dass man voneinander, oft rudimentär, Kenntnis hatte, dass Reisende als Händler, Pilger und Missionare unterwegs waren. Diese nahmen die Welt weniger als eine einheitliche, sondern als eine vielgestaltige wahr. Christentum und Islam als auf eine die ganze Menschheit und die ganze Welt ausgerichtete Religion vermochten keine einheitliche Welt zu schaffen, ebenso wenig die Mongolen, die mit ihrem Reich einer Herrschaft über die „bekannte Welt“ so nahe kamen wie niemand vor ihnen. Im christlichen Europa konkurrierten ein östliches und ein westliches Kaisertum mit jeweiligem universalen Selbstverständnis, dazu trat das universal ausgerichtete römische Papsttum. Seine politische Gestalt fand Europa jedoch in regional begrenzten und definierten Herrschaften, meist in Königreichen. Die Ordnung der Welt war eine regionale.
Religiöse Deutungen der Welt zielten in gleichem Maße auf die Bewältigung des Lebens in der Welt als auch auf das Abschütteln der Welt in asketischen Lebensweisen. Beides war nur zu leisten durch gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt und den Lebensformen und -möglichkeiten des Menschen. Nicht zuletzt daraus ergaben sich Möglichkeiten von Rationalität, Verwissenschaftlichung und komplexer kognitiver Ordnungen.
In drei großen Abschnitten, Vielfalt der Welt – Ordnung der Welt – Deutung der Welt, sollen diese Linien einer Weltgeschichte von 600 bis 1500 nachgezeichnet werden. Diese Epoche aber ist in vielerlei Hinsicht mit den „Entdeckungen und neuen Ordnungen“ verzahnt, die in Band IV (1200–1800) mit Rückbezügen auf den vorliegenden Band dargestellt werden.