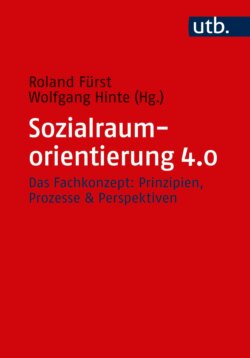Читать книгу Sozialraumorientierung 4.0 - Группа авторов - Страница 14
1.Kritik der Kritik aus dem Elfenbeinturm
ОглавлениеEine „Kritik der Kritik“ am Konzept der Sozialraumorientierung erfordert es, die Kanten zu schärfen und aufzuzeigen, dass die gegenüber dem Konzept SRO und dessen konkreter Umsetzung in verschiedenen Kommunen bislang formulierten Besorgnisse eher einem Generalverdacht gleichen.
Ein engführendes Missverstehen zentraler Elemente der SRO wie des „Willens“ und ein Anspruch von theoretischer Deutungshoheit zum Begriff „Sozialer Raum“ münden in vordergründigen Argumenten: SRO diene sich als Komplizin neoliberaler Workfare-Methoden der Individualisierung, Responsibilisierung und Aktivierung an und betreibe – naiv oder als „hidden agenda“, da sind sich die Expert/innen im Elfenbeinturm nicht ganz einig – die Kürzung von Sozialbudgets, sie habe das politische Mandat im Sinne kritischer Sozialarbeit stillschweigend entsorgt (vgl. Bettinger 2012; Diebäcker 2008; Kessl/Reutlinger 2010; Otto/Ziegler 2008).
Zugegeben, auch meine erste Reaktion als Praktiker (2006) in der Sozialen Arbeit mit Straffälligen auf die fundamentale Infragestellung des aktuellen Gepräges der Sozialarbeit und Sozialpädagogik durch die Sozialraumorientierung war vor vielen Jahren ein kritisches „Woher nimmt sich dieses Konzept das Recht, die Verhältnisse neu zu deuten und zu gestalten?“.
Tatsächlich ist diese Reaktanz schon selbstreferenziell; zeugt die massive Skepsis doch davon, dass die Erschütterung, die das Konzept der SRO v. a. für das nur vermeintlich geltende, gemeinsame Verständnis von Fachlichkeit in der Sozialen Arbeit darstellt, tiefgeht, tatsächlich – im Sinne von an die Wurzel gehend – radikal ist und so die Frage aufwirft: Was will die Soziale Arbeit im Europa des 21. Jahrhunderts? Wenn der SRO en passant Beliebigkeit und Konturlosigkeit vorgeworfen wird (Schreier/Reutlinger 2013), drückt sich hier etwa die eigene professionelle Verunsicherung einer Profession auf tönernen Füßen aus? Im Gefolge dieser Debatte spitzt sich offensichtlich eine Ex-Kathedra-Diskussion zu: Was dürfen die Adressat/innen und die Profis wollen?
Die Antwort darauf ist vielschichtig, weil sie viele gewohnte Annahmen vom Kopf auf die Beine stellen muss. Die Ursachen liegen dabei m. E. auch in den nach wie vor wirksamen Entwicklungslinien Sozialer Arbeit in deutschsprachigen Ländern theokratischer Prägung und monarchisch-obrigkeitsstaatlicher Tradition sowie deren Tendenz, einen an konkreten Lösungen orientierten Pragmatismus dem Moloch einer nur scheinbar verallgemeinerbaren, theoretischen Begründbarkeit des Handelns zu opfern.
Der Unterschied in der historischen Entwicklung ähnelt dem im angloamerikanischen Raum prominenten „Case Law“ zum kontinentaleuropäisch materiell-rechtlichen Zugang zur Rechtsprechung und Fortschreibung, indem auf die Komplexität des jeweiligen Sachverhalts nicht in erster Linie ein formalistischer Katalog angelegt wird, sondern die Form dem Inhalt folgt und pragmatisch-evolutionär passgenaue Lösungen weiterentwickelt werden.
An den fachlichen Verwerfungen rund um den Respekt vor dem Willen der Adressat/innen Sozialer Arbeit zeigt sich eine Starrheit Sozialer Arbeit in behördlich-obrigkeitsstaatlicher Tradition („Europäische Schule“) im Vergleich zu einer adaptiv-flexiblen Provenienz („Angloamerikanische Schule“). Die „Titanic“-Sozialarbeit, die sich in erster Linie als Teil staatlicher Hoheitsverwaltung versteht und als solche dem Eigenwillen der Nutzer/innen prinzipiell eher argwöhnisch begegnet, bewegt sich auf Kollisionskurs mit dem „Eisberg“ der Sozialraumorientierung.
Diesem traditionellen Diskurs auf dem falschen Dampfer stellt sich SRO ja in den Weg als Ausdruck eines theoretisch breit fundierten, jedoch unprätentiösen, „polytheistischen“ Pragmatismus, wie er von Ludwig Marcuse (1994) beschrieben wird und von dessen streitbarem Geist auch die angloamerikanische Sozialarbeit durchdrungen ist.