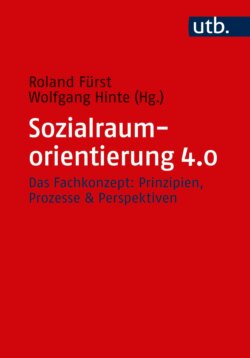Читать книгу Sozialraumorientierung 4.0 - Группа авторов - Страница 8
1.„Sozialraumorientierung umsetzen?“
ОглавлениеAngesichts der Konjunktur von „Sozialraumorientierung“ überrascht es nicht – auch wenn es hier und da zwiespältige Gefühle hinterlässt –, dass immer mehr öffentliche und freie Träger, insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe sowie der Behindertenhilfe, in Fachaufsätzen und/ oder in Werbematerialien darüber informieren, dass sie „Sozialraumorientierung umsetzen“. Eine solche Formulierung mutet schon sprachlich merkwürdig an, doch vor allen Dingen zeigt sie, dass die für sich werbende Institution konzeptionell (vielleicht auch nur sprachlich) noch nicht Tritt gefasst hat. Zumindest das hier vertretene „Fachkonzept Sozialraumorientierung“ kann man nicht „umsetzen“, aber man kann es als konzeptionelle Leitlinie für professionelles Handeln nutzen. Damit diese konzeptionelle Folie nachhaltige Konsequenzen für das alltägliche Handeln der Professionellen zeitigt, hat es sich zum einen bewährt, das Personal durch systematische (verpflichtende) Qualifizierungen zu unterstützen. Zum anderen aber (und das ist gelegentlich mit „Umsetzung“ gemeint) sind bestimmte organisatorische Strukturen, Abläufe, Finanzierungs- und Kooperationsstrukturen hilfreich, damit die Prinzipien des Fachkonzeptes ihre Wirkung entfalten können.
Die fünf Prinzipien sowie die daraus folgenden Hinweise für Methodik, Struktur und Finanzierung als Orientierung zu wählen, liegt natürlich auf der Hand. Die aktuellen Herausforderungen, die sich in zahlreichen Prozessen in den Gebietskörperschaften stellen, beziehen sich auf Arbeitsfelder, die durch Rechtsansprüche aus verschiedenen Sozialgesetzbüchern, die sich fast ausschließlich auf Einzelansprüche beziehen, gerahmt werden. In diesen häufig traditionell geprägten, gelegentlich sogar stärker juristisch als sozialarbeiterisch beeinflussten Prozessen des Leistungsgeschehens sich konsequent an den Prinzipien des Fachkonzepts auszurichten, ist angesichts der tradierten Prägungen in vielerlei Hinsicht schwierig (anders etwa als im Arbeitsfeld Gemeinwesenarbeit – s. dazu Hinte 2018). Leistungsfelder, die überhaupt nur deshalb existieren, weil Menschen als bedürftig, notleidend, belastet, gehandicapt usw. etikettiert werden müssen, sperren sich naturgemäß solchen Ansätzen, die die Ressourcen und Potentiale, den Willen und die Ziele sowie die eigenen Kräfte der Menschen in den Fokus stellen und damit so manche korrekte Leistungsfeststeller/in ins Schwitzen bringen. Feststellung, Rahmung und Erbringung der gesetzlich verbrieften Leistungen bieten einige Herausforderungen, wenn man die Prinzipien der Sozialraumorientierung ernst nimmt.
Beispiele dafür:
–Wenn der Wille der leistungsberechtigten Menschen eine wesentliche Grundlage professionellen Handelns im gesamten Hilfeverlauf darstellt, dann muss insbesondere die Phase der Leistungsfeststellung („Falleingangsphase“) so gestaltet werden, dass die Fachkräfte methodisch und zeitlich in der Lage sind, mit den betroffenen Menschen deren Willen herauszufinden (und evtl. daraus folgende Ziele mit ihnen zu formulieren). Methodisch hat das zur Folge, dass eine „kundenorientierte Haltung“ mit einer Frage wie: „Was kann ich für Sie tun?“ weniger angezeigt ist als eine Haltung, aus der heraus systematisch die Interessen und der Willen der betroffenen Menschen erkundet werden. Hohe Klarheit seitens der beteiligten Akteure/innen über den Willen der leistungsberechtigten Menschen führt häufig zu ganz anderen als den gerade vorhandenen und institutionell standardisierten Leistungen. Grundsätzlich gilt: Leistungsumfang und Leistungserbringung müssen (natürlich auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen) dem Willen und den Zielen der Menschen folgen und nicht umgekehrt. Somit ist die Frage danach, was den Menschen auf der Grundlage eines Katalogs versäulter Angebote „zusteht“, oftmals irreführend: Sie verführt die Akteure/innen dazu, die Menschen der Logik des Systems anzupassen anstatt das System herauszufordern, sich auf den Eigensinn der Menschen mit einer flexiblen Angebotsstruktur einzulassen.
Grundlage jedweder Leistung sind die gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Gesetzeskreisen. Das ist selbstverständlich. Doch während derzeit immer noch relativ eng und standardisiert danach geschaut wird, was dem leistungsberechtigten Menschen zusteht bzw. was ihm nicht zusteht, wird diese Frage mit einem sozialraumorientierten Blick gerahmt durch die am Anfang des Leistungsgeschehens zu stellende Frage, was der (möglicherweise) leistungsberechtigte Mensch in seiner jeweiligen Situation erreichen will, was für ihn in seinem Leben wichtig ist, welche (realistischen) Perspektiven ihn leiten und welche Lebenszusammenhänge für ihn Relevanz besitzen. Damit wird die Konzentration auf zahlreiche andere Ausschnitte seiner Lebenswirklichkeit gelenkt als ausschließlich auf die zu diagnostizierende bzw. empfundene Bedürftigkeit: Nicht das, was der Mensch „braucht“, steht im Mittelpunkt, sondern das, was er will. Damit wird bereits zum Beginn des Leistungsgeschehens fokussiert auf seine eigene Energie, seine Lebenserfahrungen, sein eigenes Radar und seinen Lebensentwurf. Erst auf dieser Grundlage wird darüber nachgedacht, wie die in dem jeweiligen Gesetz zur Verfügung stehenden sozialstaatlich garantierten Ressourcen genutzt werden zur gemeinsamen mit den betroffenen Menschen vorzunehmenden Gestaltung eines Hilfearrangements. Dieses setzt sich aus personellen und sachlichen Leistungen des professionellen Systems wie auch aus zahlreichen anderen Mosaiksteinen zusammen, die u. a. aus lebensweltlichen Ressourcen jedweder Art bestehen. Diese schon in der Anfangsphase des Leistungsgeschehens zu gestaltende Kombination von Bürokratie und Lebenswelt, von sozialstaatlich garantierten und professionell geleisteten Elementen sowie durch vorhandene Netze erbrachte Unterstützungsleistungen zieht sich dann wie ein roter Faden durch das gesamte Leistungsgeschehen.
–Wenn man konsequent verfolgt, die Ressourcen und die eigene Aktivität der Menschen als wesentlichen Bestandteil der Leistungserbringung anzusehen, muss sich der Fokus in der Falleingangsphase genau darauf richten und nicht auf die häufig im Vordergrund stehende „Bedürftigkeit“, die zu Gesprächssequenzen folgt, die eher eine Problemtrance befördern, bei der die demoralisierenden Erfahrungen, Niederlagen und Misserfolge der Menschen im Vordergrund stehen. Somit ist klar, dass etwa das Formularwesen in einer Institution die Professionellen darauf orientieren muss, möglichst diejenigen Tatsachen zu dokumentieren, die Aufschluss geben über die Stärken der Menschen, ihre bisherigen Bewältigungsstrategien sowie die zahlreichen kleineren und größeren Kraftquellen, aus denen sie bislang geschöpft und mit denen sie so manche schwierige Situation mehr oder weniger gut überstanden haben.
–Leistungsrahmung: Die derzeit geradezu reflexartig gestellte Frage seitens der Leistungsträger: „Wer nimmt bzw. wer kriegt den Fall?“ oder: „Wo kriegen wir ihn unter?“ wird abgelöst von der gemeinsam mit den Leistungserbringern vorzunehmenden Suche nach einem passgenauen Arrangement, bei dem der professionelle Anteil durchaus auch in Kooperation von mehreren Leistungserbringern erbracht werden kann.
Wenn der Wille und die Ziele der Menschen im gesamten „Fallverlauf“ im Vordergrund stehen, braucht es möglichst regional aufgestellte Einrichtungen, die allenfalls einen geringen Grad an Standardisierung und Versäulung aufweisen und stattdessen konsequent darum bemüht sind, mit Blick auf die jeweilige individuelle Situation eine „passgenaue Maßnahme“, die sich im Extremfall ständig ändern kann, zu kreieren. Es braucht also ein Hilfearrangement, das in seinen Einzelaspekten die Stärken und Potentiale des leistungsberechtigten Menschen ergänzt und unterstützt, neue Ressourcen und Optionen schafft und einen Mix darstellt aus professioneller Tätigkeit, sozialräumlichen, materiellen wie personellen Ressourcen, technischen Hilfsmitteln und eigener Aktivität des leistungsberechtigten Menschen, der letztlich immer wieder selbst darüber befinden muss, ob das vereinbarte Arrangement ihn in guter Weise unterstützt.
–Das wiederum hat Konsequenzen sowohl für die Leistungserbringung als auch die Finanzierung der gewährten Leistungen. Fachleistungsstunden, Tagessätze und Pflegesätze sind nur selten unterstützend für passgenaue Hilfearrangements, weil sie der in Geld gegossene Ausdruck einer vorgehaltenen, standardisierten und unabhängig von der jeweils leistungsberechtigten Person entwickelten Hilfeform sind, die häufig die Menschen an die vorhandene Struktur anpasst und sich nicht an ihrer Individualität ausrichtet. Flexible Leistungserbringer, die passgenau und nicht auf der Grundlage festgelegter Stundensätze oder Betreuungsdetails eine flexible Hilfe durchführen, benötigen Pauschalfinanzierungen in Form von Pools, Budgets oder anderen stundenunabhängigen Finanzierungsvarianten, die viel Freiheit lassen für nicht vorhersehbar auftauchende Entwicklungen, die nicht vorab prognostiziert, geschweige denn in Stundenaufwänden prospektiv beschrieben werden können. Auf der Grundlage des in der Phase der Leistungsrahmung vereinbarten Arrangements wird dann ein flexibles Hilfesetting erbracht, das ständig geändert werden kann. Völlig deplatziert sind also im Vorhinein fest vereinbarte Stundenkontingente oder immer wieder neu zu „verschreibende“ vorgehaltene Leistungen, die dann, koste es, was es wolle, auf jeden Fall erbracht oder „an die Person“ gebracht werden müssen.
So weit einige Beispiele dafür, was es heißt, wenn man die inhaltlichen Aspekte des Fachkonzeptes konsequent zu Ende denkt und entsprechende Konsequenzen für Struktur und Finanzierung zieht.