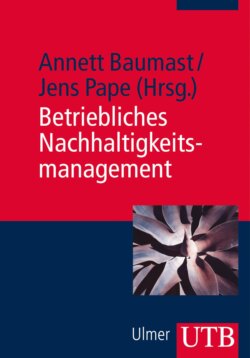Читать книгу Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement - Группа авторов - Страница 35
1.2Geschichte und Meilensteine der Leitbildentwicklung
ОглавлениеEtwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist das Bewusstsein darüber gewachsen, dass der Mensch mit seiner Lebens- und Wirtschaftsweise die Umwelt und damit letztlich auch sich selbst schwerwiegend belastet. Seit den 1970er Jahren ist zudem die globale Dimension der Umweltprobleme ins Blickfeld geraten, wozu auch die Erfolge der Raumfahrt beigetragen haben, denn die von der US-Raumkapsel Apollo bei der Umkreisung des Mondes aufgenommenen Bilder vom „blauen Planeten“ veranschaulichten, dass die Erde ein ganzheitliches Ökosystem ist und ihr Schutz Sache der gesamten Menschheit sein muss. So lautete auch das Motto des ersten Erdgipfels, der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen (UN) 1972 in Stockholm: „Only one Earth“. Zwar waren die Ergebnisse nicht bahnbrechend, weil die Vertreter der Entwicklungsländer in dem Bemühen der Industrieländer für eine bessere Umwelt vor allem eine Einschränkung ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung sahen. Dennoch ist mit der Stockholm-Konferenz das weltweite Umweltgewissen erwacht.
Wie sehr das von den Industrienationen bereits erzielte und das von den Entwicklungsländern angestrebte Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt und damit letztlich auch auf die des Menschen geht, veranschaulichte der gleichfalls 1972 erschienene Bericht an den Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al. 1972). Hierin wurde mit einem Weltmodell und mathematischen Berechnungen erstmals aufgezeigt, dass die natürlichen Ressourcen endlich sind und die Erde ein ständiges Bevölkerungs- und materielles Produktionswachstum langfristig nicht trägt, sondern die Menschheit sparsamer mit den Ressourcen umgehen muss.
Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich Wissenschaftler und Umweltverbände schon seit Ende der 1970er Jahre mit der Frage nach einem neuen wirtschaftlichen Leitbild, das letztlich bereits die heute aktuellen Nachhaltigkeitsthemen in sich trug, ohne dass hierfür jedoch der Begriff des Sustainable Development geprägt wurde. Seinerzeit brachte das populäre Schlagwort vom „qualitativen Wachstum“ die Debatte auf den Punkt.
Den wichtigsten Beitrag zur Verbreitung des Begriffes Sustainable Development und den wesentlichen Anstoß zur Problematisierung politischer Aspekte leistete schließlich die von der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland geleitete Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED) mit ihrem 1987 veröffentlichten Abschlussbericht „Our Common Future“ (WCED 1987) („Brundtland-Bericht“). Wenngleich dieser ein weltweites, wirtschaftliches Wachstum befürwortete – und deshalb bis heute nicht kritiklos ist (z. B. Luks 2007) –, zeigte er Wege zu nachhaltigen Formen der Entwicklung auf.
Internationale politische Vereinbarungen hierfür wurden schließlich auf dem zweiten Erdgipfel getroffen, der Konferenz für „Umwelt und Entwicklung“ der Vereinten Nationen (UNCED) vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro. Eines der wichtigsten Dokumente, das aus der UNCED hervorging, ist das von mehr als 170 Staaten verabschiedete Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, die Agenda 21 (BMU o.J.), mit deren Unterzeichnung die internationale Staatengemeinschaft die Selbstverpflichtung eingegangen ist, den Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern zu fördern. Hierfür werden in den 40 Kapiteln der Agenda 21 die maßgeblichen Politik- und Handlungsbereiche angesprochen sowie jeweils entsprechende Ziele und Maßnahmen aufgeführt. Weitere rechtsverbindliche Beschlüsse, die heute noch eine tragende Rolle spielen, sind die Klimarahmenkonvention und das Übereinkommen zur biologischen Vielfalt.
Darüber hinaus sind alle Staaten dazu aufgerufen worden, eigene Strategien zu entwickeln und nationale Aktionspläne zur Umsetzung der UNCED-Ergebnisse zu erstellen. Diesem Aufruf sind die einzelnen Staaten mit unterschiedlichem Engagement gefolgt. So ist die nationale Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland erst 2002 – zehn Jahre später – rechtzeitig zur Rio+10-Konferenz in Johannesburg erarbeitet worden. Zwar enthält diese keine verbindlichen Rahmenvorgaben und konkreten Umsetzungshinweise für die verschiedenen administrativen Ebenen und gesellschaftlichen Akteure, doch werden „21 Umweltindikatoren für das 21. Jahrhundert“ (s. BR 2002b) sowie darauf bezogene Ziele als „Wegmarken der Politik“ (s. BR 2002a) benannt, an denen die Entwicklungen seither gemessen werden. Mit der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie hat die Bundesregierung zudem im Jahr 2001 den Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) berufen, der sie seitdem in ihrer Nachhaltigkeitspolitik berät und den gesellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit fördern soll (www.nachhaltigkeitsrat.de).
International stand der vorletzte und größte jemals abgehaltene Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg im Zeichen der Globalisierung. Zwar wurde die Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung erneuert, kritischen Stimmen von Vertreterinnen und Vertretern aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Entwicklungsländern zufolge ist jedoch der Geist von Rio, der eine Art Aufbruchsstimmung für die Gestaltung einer umwelt- und sozialverträglichen wirtschaftlichen Entwicklung entfacht hatte, in Johannesburg gestorben. Als ein Erfolg von Johannesburg lässt sich jedoch der Beschluss anführen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu stärken, um Gedanken und Strategien nachhaltiger Entwicklung besser als bisher in der Gesellschaft zu verankern. So finden derzeit im Rahmen der „UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 2005–2014 international und national zahlreiche Projekte statt, die insbesondere Kinder und Jugendliche für nachhaltige Entwicklungen sensibilisieren (zur Übersicht s. www.bne-portal.de).
Im Großen und Ganzen sind aber die Erfolge bisher weit hinter den Zielsetzungen zurückgeblieben. Für Deutschland lässt sich dies aus dem Fortschrittsbericht der Bundesregierung (2008) herauslesen, mit deutlicher Kritik stellen dies sowohl der RNE in seinem „Ampelbericht“ (2008) als auch die zweite Studie für ein „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ (BUND et al. 2008) heraus. Erfolge können bisher insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie bei relativen Indikatoren verzeichnet werden, wie etwa der Steigerung der Ressourceneffizienz. Absolut betrachtet werden letztere aber durch Produktionszuwächse und damit verbundenen vermehrten Ressourcenverbrauch wieder aufgebraucht (sog. Rebound-Effekt). In der Studie von BUND et al. (2008) wird daher ein radikaler Kurswechsel gefordert.
Diese Entwicklungen führen in der Wissenschaft und bei Umweltverbänden zu einer Renaissance der Kritik am materiellen Wirtschaftswachstum und münden heute, etwa 40 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums“ in Forderungen nach einer Postwachstumsökonomie bzw. -gesellschaft (Paech 2009, Seidl und Zahrnt 2010).
Hiermit verbunden flammt auch die Kritik am Indikator zur Messung des Wirtschaftswachstums, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), erneut auf. Ähnlich wie der französische Staatspräsident Sarkozy es 2009 veranlasste, hat die Bundesregierung 2010 mit der Einsetzung einer Enquête-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wachstum und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ reagiert. Diese „Wohlstandsenquête“ soll nach Möglichkeit einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP ergänzt und konkrete politische Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges Wirtschaften erarbeiten.
International wurde 20 Jahre nach Rio neue Hoffnung in die Rio+20-Konferenz gesetzt, die 2012 auf höchster politischer Ebene mit den Staats- und Regierungschefs – wiederum in Rio de Janeiro – abgehalten wurde. Die Bilanz der Konferenz ist ambivalent: Während Politiker lobende Worte finden, sprechen Umwelt- und Naturschützer von einem kolossalen Scheitern und bemängeln insbesondere klare Ziele und verbindliche Fristen. Neue politische Impulse durch den Weltgipfel 2012 sind damit ausgeblieben.