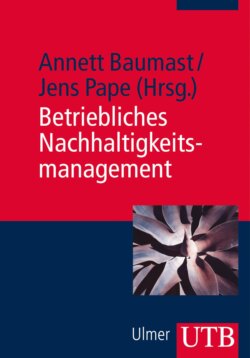Читать книгу Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement - Группа авторов - Страница 42
1.5.3Nachhaltigkeitsstrategien
ОглавлениеNeben den Managementregeln sind für den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung drei Strategien richtungweisend:
Die Effizienzstrategie wird vornehmlich von Ökonomen, zunehmend aber beispielsweise auch in der aktuellen Energiepolitik angeführt. Zur Reduzierung des übermäßigen Stoff- und Energieverbrauchs sowie den damit verbundenen Umweltbelastungen geht es – im klassischen ökonomischen Sinne – darum, die Ressourcenproduktivität zu steigern, d.h. Leistungen auf sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette mit dem geringstmöglichen Einsatz an Stoffen und Energie zu erfüllen und damit die Wirtschaftsaktivitäten zu „dematerialisieren“ (s. Schmidt-Bleek 1994).
Relativ gesehen ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Absolut betrachtet wird hierdurch allein jedoch das Problem des ständig steigenden Ressourcenverbrauchs – bedingt durch Produktionssteigerungen (Rebound-Effekt), das Konsumverhalten und das Anwachsen der Bevölkerung – nicht behoben.
Ergänzend wird deshalb vor allem von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Suffizienzstrategie angeführt. Ausgehend von der Tatsache, dass sich das Konsumverhalten der industrialisierten Welt aufgrund der aufgezeigten Wachstumsgrenzen nicht auf die gesamte Menschheit übertragen lässt, ist hiermit die Forderung nach Genügsamkeit verbunden und erfordert letztlich vor allem in den Industrieländern eine Änderung der Lebensstile.
Dieses ist jedoch problematisch, weil die Forderung nach Konsumverzicht konträr zu den vorherrschenden wirtschaftlichen Interessen nach materiellem Wachstum steht und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung gering ist. Insofern bedarf es noch eines längerfristigen Bewusstseinswandels, bevor diese Strategie spürbare Wirkungen entfalten kann. Welche Wege dorthin führen können, wurden beispielsweise bereits in der ersten Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ (s. BUND und Misereor 1996) aufgezeigt. Auch in der zweiten Studie werden in Zeitfenstern anschaulich Visionen für 2022 dargestellt (BUND et al. 2008).
Die Konsistenzstrategie – von Huber wegen der Wortverwandtschaft zu den beiden erstgenannten als solche bezeichnet (s. Huber 1996; von Gleich et al. 1999) – wird ergänzend vornehmlich von ökologisch orientierten Vertreterinnen und Vertretern eingebracht. Während sich die Effizienz- und Suffizienzstrategie ausschließlich auf die Reduzierung des Mengendurchsatzes an Stoff- und Energieströmen konzentrieren, bezieht diese dritte Strategie die qualitativen Aspekte der Stoffe mit ein. Damit wird bewusst ein Kontrapunkt zu der Auffassung gesetzt, anthropogene Stoff- und Energieströme seien unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten per se zu minimieren. Vielmehr müsse es darum gehen, sie so umzugestalten, dass eine Rückführung in die natürlichen Stoffkreisläufe gewährleistet ist (vgl. Kap. 1.3). Als Beispiel wird u.a. die Nutzung der Solarwasserstoff-Technologie angeführt, die nach heutigem Wissen nicht zu gravierenden Umweltproblemen führt, obwohl sie sehr materialintensiv ist. Insofern zielt die Konsistenzstrategie vor allem auf Basisinnovationen ab, die grundlegend neue Pfade der Technik- und Produktentwicklung eröffnen (s. Huber 1996).
Zusammengefasst betrachtet handelt es sich jedoch nicht um alternative Strategien, nur der „Dreiklang“ aus Effizienz, Suffizienz und Konsistenz führt in eine nachhaltige Entwicklung (s. BUND et al. 2008; von Gleich et al. 1999).
Allerdings bestehen in dieser komplementären Sicht noch erhebliche Umsetzungsdefizite. Vielmehr sind die zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit großen Hoffnungen verbundenen technologischen Innovationen, die sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die nachhaltige Entwicklung sichern sollen, vornehmlich von der Effizienzstrategie geprägt (s. z. B. Petschow 2007).