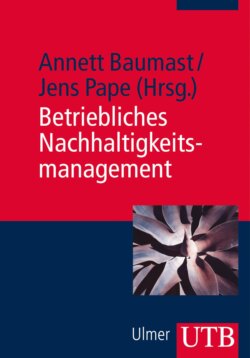Читать книгу Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement - Группа авторов - Страница 57
2.2.2Ethische Begründungen zum betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement
ОглавлениеGerade im wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang stellt sich unmittelbar die Frage, warum nun speziell Unternehmen zum soeben diskutierten Ziel der Nachhaltigkeit beitragen sollen. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist zunächst erneut die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Mit ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen erkennen die jeweiligen Staaten die Menschenrechte an. Historisch betrachtet sind es so zunächst die jeweiligen Nationalstaaten (bzw. die relevanten Staatsorgane), die als primäre Institutionen zur Wahrung der Menschenrechte und zugleich als deren größte Bedrohung verstanden wurden. Abgesehen von diesem nationalstaatlichen Fokus gehören Unternehmen jedoch schon seit jeher zu den Adressaten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. So erklärt die Präambel, dass „jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung gegenwärtig halten und sich bemühen, […] die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern [Hervorhebung d. V.]“ (UN 1948). Zudem besagt Artikel 29: „Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der alleine die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist [Hervorhebung d. V.].“ Damit ist es privaten Akteuren, deren Verhalten Einfluss auf den Status der Menschenrechte sowohl für jedes einzelne Individuum als auch für die Gesellschaft als Ganzes hat, nicht möglich, sich einer (Mit-)Verantwortung zur Aufrechterhaltung dieser Menschenrechtsstandards und damit zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung zu entziehen (für umfassende normative-ethische Begründungen siehe z. B. die Arbeiten von Wettstein 2009; Ruggie 2008; Cragg 2010). Dies scheint nun umso relevanter, je mehr Unternehmen durch ihre Handlungen dazu beitragen können, Nachhaltigkeit zu fördern oder zu hemmen. Gerade in Fällen, in denen die Staatsgewalt eine verantwortliche (nachhaltige) Unternehmensführung nicht garantieren kann, ergibt sich daher eine Verschiebung der Verantwortung in den Aufgabenbereich privatwirtschaftlicher Unternehmen. Insbesondere multinationale Unternehmen haben durch ihre grenzüberschreitenden Aktionsmöglichkeiten und die Tatsache, dass sie zumindest teilweise jenseits der Reaktionsmöglichkeiten einzelner Staaten agieren, einen besonderen Einfluss auf die globale Entwicklung. Und gerade dieser Einfluss verdeutlicht nun die verstärkte unternehmerische Verantwortung.
Damit stellt sich jedoch die Frage, ob eine moralische Verantwortung für Nachhaltigkeit jenseits von Individuen überhaupt möglich ist. Zur Erörterung dieser Fragestellung bieten sich zwei grundsätzliche Argumentationsstränge an. Der erste betrachtet die Ebene der Individuen in Unternehmen. Hierbei kann grundsätzlich eine individualethische Verantwortung der einzelnen Unternehmensmitglieder als Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft konstatiert werden. Unternehmerische Verantwortung kann also auf das jeweilige handelnde Individuum heruntergebrochen werden. Gerade die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen eröffnet den einzelnen Individuen ein Set erweiterter Fähigkeiten und vor allem Ressourcen, welche deutlich über die individuellen Möglichkeiten des Einzelnen hinausgehen. Zugleich löst sich jedoch die individuelle Verantwortung des Einzelnen in seiner Eigenschaft als Mitglied von Unternehmen in den dort vorherrschenden komplexen Strukturen immer weiter auf. Komplexe Unternehmensentscheidungen sind zudem immer schwieriger auf Entscheidungen eines Einzelnen zurückzuführen. Auf der Ebene der Unternehmen als Träger von Verantwortung – als zweitem Argumentationsstrang – lässt sich konstatieren, dass diese z. B. in ihrer Eigenschaft als juristische Personen Empfänger eines kollektiven Vertrauens – von ihrer Kundschaft, von ihren Zulieferern, von ihren Mitarbeitern und anderen – sind. Zwar sind sämtliche Angehörige von Unternehmen als Individuen bereits nach innen wie nach außen rechenschaftspflichtig, doch erst die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen oder einer Organisation schafft nach außen jenes Vertrauen, welches individuell nicht postulierbar wäre (kollektive Verantwortung). Des Weiteren werden den Unternehmen sämtliche Verfügungsrechte, welche als Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit angesehen werden können, durch die Öffentlichkeit (und speziell durch die rechtsgebenden Organe) zur Verfügung gestellt. Schließlich erwachsen sämtliche Unternehmenshandlungen aus einer kollektiven Ratio, d. h. sie basieren auf unternehmerischen Zielsystemen, sind in einer Unternehmenskultur verankert und bauen auf unternehmerischen Werten und Visionen auf. Damit „sprechen organisationstheoretische Überlegungen dafür, Organisationen höhere Verantwortungsfähigkeit als Individuen zuzumuten“ (Kaufmann 1992, S. 83), da für sie angenommen werden kann, „dass sie im Unterschied zu individuellen Personen Entscheidungen rekonstruierbarer, kontrollierbarer und rationaler kommunizieren [[…] und damit auch] eine höher aggregierte Verantwortung leisten“ (Hubbertz 2006) können. Folglich kann eine unternehmerische Verantwortung für Nachhaltigkeit sowohl aus der kumulierten Individualverantwortung der Menge ihrer Mitglieder als auch aus den genannten unternehmensspezifischen Charakteristika hergeleitet werden.
Doch wie weit reicht eine solche unternehmerische Verantwortung? Um dieser Frage nachzugehen, sollen die angesprochenen nachhaltigkeitsbezogenen Menschenrechte aus analytischen Zwecken zunächst in so genannte negative und positive Rechte unterschieden werden (Hsieh 2004; Hahn 2009b). Dabei begründen negative Rechte „passive“ Pflichten der Akteure zur Vermeidung oder Verhinderung bestimmter Handlungsformen. Hierzu zählt z. B. das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, welches durch starke Umweltverschmutzung, den Klimawandel o.ä. für aktuelle wie auch künftige Generationen gefährdet sein kann. Positive Rechte begründen hingegen deutlich weitergehende Verpflichtungen zur „aktiven“ Wahrnehmung solcher Rechte. Dies kann geschehen, indem Unternehmen den Betroffenen aktiv eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und z. B. Maßnahmen zum Schutz vor Verarmung (Aufbau von Schulen zur Bildungsförderung, Aktivitäten zur Gesundheitsförderung o.ä.) durchführen. Eine Verantwortungszuordnung im Bereich der negativen Rechte erscheint zunächst unproblematisch, da solche Rechte grundsätzlich einzuhalten sind. Jeder hat die Pflicht, diese Rechte zu schützen, sie gelten für die gesamte Gesellschaft gleichermaßen und auf dieselbe Weise und damit direkt auch für Unternehmen, die diese Rechte ebenfalls nicht verletzen dürfen. Positive Rechte hingegen erzeugen kollektive und für den Einzelnen häufig unvollkommene Pflichten, da sie nicht auf das einzelne Individuum (oder die einzelne Organisation) heruntergebrochen werden können. Ihre vollständige Realisierung für alle Individuen erfordert Maßnahmen, welche die Möglichkeiten einzelner Akteure übersteigen (so kann z. B. kein einzelnes Unternehmen das Recht auf Arbeit oder einen angemessenen Lohn für die gesamte Bevölkerung garantieren). Damit gelten sie nicht für jeden in derselben Weise und es ist häufig unklar, wer für die Durchsetzung dieser Rechte verantwortlich ist.
Speziell mit Blick auf die Entwicklungsländer, in denen schon der Aspekt der intragenerativen Gerechtigkeit – wie zuvor erörtert – in weiten Teilen nicht erreicht ist, kann in bestimmten Fällen dennoch ein erweitertes Plädoyer für unternehmerische Verantwortung für Nachhaltigkeit auch für positive Rechte hergeleitet werden. Grundlage einer solchen Begründung ist die Tatsache, dass viele der dort tätigen Unternehmen zum Großteil Eigentum von Personen und/oder Institutionen aus entwickelten Ländern sind. In den entwickelten Ländern können diese Unternehmen auf günstigere Rahmenbedingungen aufbauen als dies in weniger entwickelten Ländern der Fall wäre. Auf dieser Basis kann erneut das Werk von John Rawls als ethische Begründungsgrundlage dienen. In seinem Werk „Recht der Völker“ argumentiert Rawls, dass „wohlgeordnete Völker […] eine Pflicht [haben], belastete Gesellschaften zu unterstützen“ (Rawls 2002), und dass zugleich die Notwendigkeit zur weiteren Verbesserung der positiven Rechte vor allem in jenen Gesellschaften besteht, in denen „politische und kulturelle Traditionen, das Humankapital, das Knowhow und oft auch die nötigen materiellen und technologischen Ressourcen [fehlen]“ (Rawls 2002), um wohlgeordnet zu sein. Diese Zweiteilung von wohlgeordneten und belasteten Völkern kann in vereinfachter Sichtweise in Bezug auf Industrie- und Entwicklungsländer fortgeführt werden. Ausgangspunkt der folgenden Argumentation ist nun der Aspekt, dass die genannten wohlgeordneten Gesellschaften auf staatlicher Ebene tatsächlich der Argumentation von Rawls zu folgen scheinen, da z. B. im Rahmen der Vereinten Nationen eine Zielvereinbarung für Entwicklungshilfeleistungen an solchermaßen belastete Gesellschaften von 0,7 % besteht. Dieses Ziel wird jedoch weltweit zumeist nicht erreicht (OECD 2007). Damit kann die bestehende und auf staatlicher Ebene bereits anerkannte Verantwortung direkt auf die jeweiligen Mitglieder der einzelnen Gesellschaften übertragen werden, da die in Rawls’ Werk geforderte Unterstützung auf politisch-staatlicher Ebene in der Regel nicht in ausreichender Weise geleistet wird. Eine spezifische unternehmerische Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung kann entsprechend zum einen daraus abgeleitet werden, dass diese Unternehmen häufig selbst „Mitglieder“ wohlgeordneter Völker sind und damit von deren positiven Rahmenbedingungen profitieren können. Zum anderen kann sich eine Verantwortung aus der kollektiven individuellen Verantwortung der jeweiligen Unternehmenseigner ergeben, die ebenfalls oft zu einem überwiegenden Teil Mitglieder wohlgeordneter Völker sind. Blickt man darüber hinaus auf jene Unternehmen mit Sitz und Anteilseignern innerhalb der entsprechenden „belasteten“ Länder, so lässt sich auch hier Rawls’ Argumentation zum Recht der Völker nutzen. Denn in diesen Ländern sind es insbesondere die „wohlgeordneten“ Schichten, welche die Geschicke der entsprechenden Unternehmen lenken und die damit – in analoger Argumentation zu Rawls – die Pflicht haben, eine entsprechende Verantwortung zur Entwicklung der „belasteten“ Bevölkerung zu übernehmen.
Schließlich wird eine unternehmerische Verantwortung für nachhaltige Entwicklung häufig aus den spezifischen Kapazitäten des privatwirtschaftlichen Sektors hergeleitet. Sowohl die Fähigkeiten als auch die gesammelten Kapazitäten von Unternehmen übersteigen systematisch die Kapazitäten von Individualakteuren (s. mit speziellem Bezug zu Menschenrechten auch Wettstein 2009). Unternehmen hingegen können direkt die Würde der von ihnen abhängigen Menschen (positiv wie negativ) beeinflussen (Hahn 2012), indem sie im Rahmen eines betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements auf intra- und intergenerative Gerechtigkeit einwirken. Folglich steht in diesem Argumentationsstrang die Betonung der „Fähigkeit“ zur Problemlösung im Mittelpunkt, und damit stehen eben die Kapazitäten der Unternehmen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, (vgl. erneut Abbildung 2.1) im Zentrum. Diese Argumentation (ganz ähnlich schon von Hans Jonas als „die Pflicht der Macht“ (Jonas 1984) postuliert) findet sich immer öfter und stärker sowohl in der gesellschaftlichen Diskussion als auch in der öffentlichen Meinung und wird zunehmend zu einem Wert, der für die Unternehmen unmittelbar handlungswirksam wird (so argumentieren auch von Oetinger und Reeves 2007 recht plakativ: „Größe verpflichtet“).