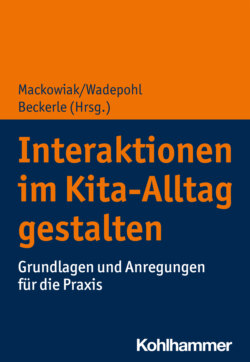Читать книгу Interaktionen im Kita-Alltag gestalten - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Entwicklungsförderliche Fachkraft-Kind-Interaktionen in Kindertageseinrichtungen: Einführung in den Themenschwerpunkt Katja Mackowiak, Christine Beckerle & Heike Wadepohl
ОглавлениеIn den letzten Jahren sind Kindertageseinrichtungen (Kitas) als Ort der institutionellen Bildung zunehmend in den Fokus gerückt. Politik, Gesellschaft und Wissenschaft betonen die Bedeutung frühpädagogischer Einrichtungen für die Entwicklung und das Lernen von Kindern; und auch internationale Forschungsbefunde belegen, dass vorschulische Bildungsinstitutionen kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse langfristig positiv beeinflussen und somit die Bildungschancen von Kindern erhöhen können (zusammenfassend Anders, 2013). Als Konsequenz haben alle Bundesländer in Deutschland schon vor einigen Jahren Orientierungs-/Bildungspläne für den Elementarbereich entwickelt. In ihnen werden »gesellschaftlich relevante Bildungsvorstellungen, Bildungsziele und Erwartungen an die pädagogische Arbeit mit Kindern im Vorschulalter« (Papke, 2010, n. d.) trägerübergreifend benannt und in Bezug auf die verschiedenen Entwicklungs-/Bildungsbereiche konkretisiert.
Bei der Umsetzung dieses Bildungsauftrags spielt die Qualität der Kita eine große Rolle. Qualität wird dabei als mehrdimensionales Konstrukt verstanden und beinhaltet strukturelle Merkmale (Strukturqualität, z. B. Gruppengröße, Ausbildungshintergrund des Personals), berufsbezogene Einstellungen und Überzeugungen des pädagogischen Personals (Orientierungsqualität, z. B. Bildungs- oder Inklusionsverständnis) und die konkrete Gestaltung des Kita-Alltags (Prozessqualität, insbesondere Interaktionen der Kinder mit ihrer sozialen und materiellen Umwelt) (Kluczniok & Roßbach, 2014; Kuger & Kluczniok, 2008). Während die Struktur- und Orientierungsqualität eher indirekt über die pädagogischen Prozesse wirken, scheint die Prozessqualität einen unmittelbaren Einfluss auf die kindliche Entwicklung zu haben (Tietze et al., 2012) und wird daher oft auch als »Zentralbereich pädagogischer Qualität« (Tietze, 1998, S. 225) bezeichnet. Von einer hohen Prozessqualität in Kitas kann dann gesprochen werden, wenn Kinder im Kita-Alltag eine sichere, wertschätzende und gesundheitsförderliche Betreuung sowie ein positives, anregungsreiches Interaktionsklima in der Gruppe erleben und wenn sie angemessen, d. h. passgenau zu ihren Kompetenzen und Interessen in allen relevanten Entwicklungs-/Bildungsbereichen gefördert werden (Fuchs-Rechlin & Smidt, 2015).
Die Gestaltung pädagogischer Prozesse liegt in der Verantwortung der frühpädagogischen Fachkräfte, weshalb ihr Handeln besonders in den Blick genommen wird. Fachkraft-Kind-Interaktionen lassen sich im Kita-Alltag nahezu ständig beobachten; relevant ist aber nicht nur, dass sie stattfinden, sondern wie sie gestaltet werden, um Kinder in ihrer Entwicklung und in ihren Lernprozessen zu unterstützen. Zur Beschreibung der Qualität von Fachkraft-Kind-Interaktionen in pädagogischen Kontexten werden häufig drei Facetten herangezogen (Hamre et al., 2013; Suchodoletz et al., 2014; vgl. auch Klieme, Lipowsky, Rakoczy & Ratzka, 2006): Die erste thematisiert die Beziehungsgestaltung und emotionale Unterstützung der Kinder und bestimmt neben der dyadischen Beziehung bzw. Bindung zwischen Fachkraft und Kind maßgeblich die Atmosphäre in der Lerngruppe. Die Organisation des Kita-Alltags und die Gestaltung des Settings als zweite Facette bilden den Rahmen für ungestörte und produktive Bildungsprozesse der Kinder. Die dritte Facette, die Lernunterstützung, fokussiert auf die konkrete Umsetzung einer entwicklungsangemessenen (adaptiven) Förderung der Kinder in der ›Zone der nächsten Entwicklung‹ (Vygotsky, 2002).
Insbesondere das adaptive, d. h. eng an den kindlichen Lernvoraussetzungen, Interessen und Bedürfnissen orientierte Handeln wird aktuell als zentrale Gelingensbedingung frühpädagogischer Förderung angesehen (Hardy, Decristan & Klieme, 2019). Es setzt ein enges Wechselspiel von Diagnostik und Förderung voraus. Interindividuelle Unterschiede zwischen Kindern, die sich beispielweise durch das Geschlecht, die Sprache, die Kultur, den familiären Hintergrund sowie durch spezifische Kompetenzen, Beeinträchtigungen und Interessen in bestimmten Entwicklungs-/Bildungsbereichen ergeben, müssen kontinuierlich beobachtet, analysiert und dann in der konkreten Situation berücksichtigt werden, um die Förderung an die individuellen Voraussetzungen der Kinder anpassen zu können. Außerdem ist in der konkreten Situation zu klären, welche Lernanlässe (Themen, Inhalte, Rahmenbedingungen) vorliegen: Ist das Kind an einem Gespräch über ein erlebtes oder anstehendes Ereignis interessiert oder steht eher ein spezifisches Bildungsthema im Vordergrund, können kreative bzw. ästhetische Prozesse unterstützt oder die Beziehung zum Kind gestärkt werden? Je nach kindlichen Voraussetzungen, Lernanlass und Zielsetzung der Fachkraft sind auf der Basis dieser Beobachtungen und Analysen lernunterstützende Interaktionen im Kita-Alltag zu planen und adaptiv zu gestalten. Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, die heterogenen Ausgangslagen der Kinder in (inklusiven) Kitas berücksichtigen (Lichtblau, 2018) und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder ermöglichen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018) zu können.
Studien, die die Interaktionsqualität in Kitas im deutschsprachigen Raum untersuchen, kommen zu dem Schluss, dass frühpädagogischen Fachkräften die Beziehungsgestaltung und die Organisation des Alltags bereits gut gelingt, während die Qualität der Lernunterstützung – insbesondere in weniger strukturierten und nicht vorbereiteten Settings (z. B. Freispielbegleitung) – gering ausfällt (z. B. Beckerle & Mackowiak, 2019a; Kammermeyer, Roux & Stuck, 2013; König, 2009; Kucharz et al., 2014; Suchodoletz et al., 2014; Tietze, 2008; Tietze et al. 2012; Wadepohl & Mackowiak, 2016; Wildgruber, Wirts & Wertfein, 2014; vgl. auch Wadepohl, 2016). Insbesondere Fachkraft-Kind-Interaktionen, die kindliche Denk- und Problemlöseprozesse anregen, kommen im Kita-Alltag noch zu selten vor (z. B. Beckerle et al., 2018; Mackowiak et al., 2015). Im Hinblick auf die adaptive Lernunterstützung lassen sich für einzelne Bildungsbereiche zwar erste gute Ansätze finden, allerdings auch große individuelle Unterschiede zwischen den Fachkräften (z. B. Beckerle & Mackowiak, 2019b; Bruns & Eichen, 2015; Hormann & Skowronek, 2019). Insgesamt ist die Forschungslage hier noch nicht ausreichend, um belastbare Schlussfolgerungen zu ziehen (Hardy et al., 2019).
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine qualitativ hochwertige Unterstützung kindlicher Entwicklungs- und Bildungsprozesse im Kita-Alltag eine besondere Herausforderung an die pädagogische Arbeit darstellt. Verständlich wird dies vor dem Hintergrund, dass pädagogische Situationen im Kita-Alltag »nicht standardisierbar sind, jedoch oft hochkomplex und mehrdeutig sowie vielfach schlecht vorhersehbar« (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch, 2011, S. 17). Entsprechend sind frühpädagogische Fachkräfte stets gefordert, selbstorganisiert, kreativ und reflexiv zu handeln und neue Herausforderungen zu bewältigen (Nentwig-Gesemann, Fröhlich-Gildhoff & Pietsch, 2011).
Hierzu ist eine Vielzahl an professionellen Kompetenzen erforderlich, die sich auf das Wissen, Können und Handeln (jeweils auch inhaltlich ausdifferenziert für verschiedene Entwicklungs-/Bildungsbereiche) sowie die berufsbezogene Reflexionsfähigkeit beziehen (Fröhlich-Gildhoff, Weltzien, Kirstein, Pietsch, & Rauh, 2014). Notwendig ist aber auch die grundlegende Bereitschaft, sich im Kita-Alltag immer wieder in Interaktionen mit Kindern zu begeben und mit ihnen gemeinsam Themen zu entwickeln und im Sinne einer forschenden Haltung (Nentwig-Gesemann, Fröhlich-Gildhoff, Harms & Richter, 2011) zu bearbeiten; damit verbunden ist ein Bildungsverständnis, welches die Bedeutung sozialer Auseinandersetzung für das Lernen hervorhebt (Ko-Konstruktion; Fthenakis, 2009).
In diesem Herausgeberband werden in acht Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven Impulse für die pädagogische Arbeit in Kitas geschaffen, denen folgende Merkmale gemeinsam sind: Im Zentrum stehen Fachkraft-Kind-Interaktionen, die unmittelbar im Kita-Alltag stattfinden (also nicht mit dem Einsatz bestimmter Programme oder Zusatzangebote verbunden sind, z. B. Hasselhorn & Kuger, 2014) und die entwicklungs- und lernförderlich sowie adaptiv gestaltet werden (sodass sie Kinder individuell in ihren Kompetenzen stärken).
Die einzelnen Kapitel des Herausgeberbandes zielen auf die Anregung bzw. (Weiter-)Entwicklung der professionellen Kompetenzen (angehender) frühpädagogischer Fachkräfte ab.
Hierzu ist ein Wissen um die theoretischen Hintergründe unabdingbar. Auf dieser Grundlage werden Möglichkeiten der praktischen Umsetzung anschaulich beschrieben, welche aus dem oben genannten Wechselspiel aus Diagnostik und Förderung bestehen. Praktische Beispiele und Fallvignetten, Materialien und Übungen erleichtern den Transfer auf den pädagogischen Alltag; Reflexionsfragen helfen zudem dabei, das eigene Handeln und das Bildungsverständnis immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Alle Beiträge sind wie folgt aufgebaut: Relevanz und Zielsetzung, theoretischer Hintergrund, Möglichkeiten der Umsetzung, welche sowohl diagnostische Schritte als auch konkrete Fördermaßnahmen beinhalten. Während in einigen Beiträgen Übungen und Materialien direkt im Text enthalten sind, arbeiten andere Beiträge mit einem zusätzlichen Online-Anhang.
In Kapitel 2 erläutern Wadepohl und Böckmann die Relevanz qualitativ hochwertiger und professionell gestalteter Fachkraft-Kind-Beziehungen bzw. -Bindungen als Basis für kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse. Auf der Grundlage der Bindungstheorie beschreiben sie die zentralen Facetten einer Fachkraft-Kind-Beziehung und geben einen Überblick, welche Faktoren die Qualität der Fachkraft-Kind-Beziehung beeinflussen können. Bzgl. der Förderung wird ein Fokus auf den Beziehungsaufbau während der Eingewöhnung gelegt, bevor im letzten Teil Anregungen zu einer sensitiv-responsiven Beziehungsgestaltung im Kita-Alltag gegeben werden.
Mackowiak, Mai, Keller, Johannsen, Linck und Bethke führen in Kapitel 3 in die zentralen Konzepte einer lernunterstützenden Interaktionsgestaltung ein, die auch von Relevanz für die anderen Beiträge sind. Sie legen ihren Fokus auf die kognitive Aktivierung und beschreiben hierzu die beiden Ansätze des Scaffolding und Sustained Shared Thinking.
In Kapitel 4 hebt Lichtblau die Bedeutung individueller Interessen von Kindern in lernunterstützenden Fachkraft-Kind-Interaktionen hervor. Neben der Unterscheidung zwischen situationalen und individuellen Interessen nimmt er eine inhaltliche Strukturierung kindlicher Interessen vor. Im Rahmen der Förderung liefert er Anregungen, wie kindliche Interessen erkannt und gefördert werden können. Dies gelingt sowohl über eine direkte als auch über eine indirekte inhaltliche Orientierung am individuellen Hauptinteresse des Kindes.
Beckerle, Linck und Bernecker beschreiben in Kapitel 5 Aufgaben und notwendige Kompetenzen frühpädagogischer Fachkräfte im Hinblick auf eine adaptive und alltagsintegrierte Sprachförderung. Sie stellen verschiedene Komponenten der Sprachförderdiagnostik vor und fokussieren hinsichtlich der alltagsintegrierten Sprachförderung einerseits das Sprachvorbild der Fachkraft, andererseits stellen sie eine Reihe von Sprachfördertechniken vor, die zum Erproben im Kita-Alltag einladen.
In Kapitel 6 thematisieren Schomaker und Hormann die Frage, wie Fachkräfte mit Kindern über Naturphänomene nachdenken, die kindlichen Vorstellungen und Annahmen erfassen und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen beitragen können. Dabei nutzen die Autorinnen konstruktive (Konzept-)Dialoge als eine Möglichkeit der Sichtbarmachung und (Weiter-)Entwicklung kindlicher, naturwissenschaftlicher Perspektiven.
In Kapitel 7 stellen Heinze, Feesche, Kula und Walter am Beispiel der Ernährungsbildung die Bedeutung gesundheitsförderlicher Fachkraft-Kind-Interaktionen vor. Dabei nehmen sie zum einen die Rolle der Fachkraft als Mittelsperson und Vorbild in den Blick, zum anderen geben sie Anregungen zur alltagsintegrierten Einbindung von ernährungsbezogenen Themen.
Hormann beschäftigt sich in Kapitel 8 mit der Arbeit in Lernwerkstätten in der Kita. Hierzu definiert sie die Begriffe der Lernwerkstatt und Lernwerkstattarbeit und stellt Besonderheiten der entwicklungsförderlichen Interaktionsgestaltung in dieser besonderen Lernumgebung heraus.
Auf die inklusionspädagogische Perspektive und die responsive Interaktionsgestaltung in heterogenen Lerngruppen geht Rothe in Kapitel 9 ein. Nach einer Begriffsklärung von Inklusion und Heterogenität wird ein Fallbeispiel ausführlich dargestellt, um das Zusammenspiel von Diagnostik und Förderung bei der Interaktionsgestaltung in Bezug auf die Dimensionen der Akzeptanz, Partizipation und Leistung abzubilden.