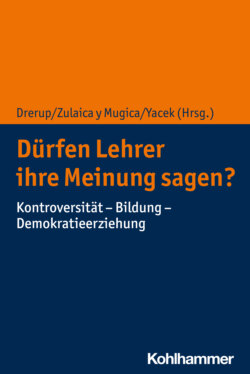Читать книгу Dürfen Lehrer ihre Meinung sagen? - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Mitteilen und Diskutieren
ОглавлениеDie Frage, ob Lehrpersonen ihre Meinung sagen sollen, kann unter einem weiteren Gesichtspunkt gesehen werden: Trägt das Mitteilen der eigenen Meinung dazu bei, in der Klasse eine lebendige Diskussionskultur zu etablieren, oder ist es diesem Ziel eher abträglich?
Diese Überlegung geht davon aus, dass die Diskussion von (vernünftigerweise) kontroversen Themen ein wesentlicher Bestandteil des schulischen Unterrichts sein sollte. Dies kann unterschiedlich gerechtfertigt werden – z. B. damit, dass Heranwachsende in die demokratische Diskussion kontroverser Fragen eingeführt werden sollen. Demnach gehört die öffentliche Argumentation zum Kern dessen, was demokratische Entscheidungsprozesse ausmacht. Dies wird insbesondere in Konzeptionen deliberativer Demokratie hervorgehoben (vgl. Gutmann & Thompson 2004). Schulische Diskussionen dienen also dem Einüben deliberativer Prozesse. Sie sind, sofern sie nicht an Praktiken schul- oder klasseninterner Demokratie gebunden sind, vom unmittelbaren Entscheidungsdruck entlastet.
Die Beteiligten begegnen sich auf Augenhöhe, insofern alle in gleicher Weise die Berechtigung haben, Argumente vorzubringen. In epistemischer Hinsicht sind alle gleich: Ein gutes Argument zählt, unabhängig davon, von wem es geäußert wird. Dennoch hat die Lehrperson eine herausgehobene Stellung: Sie ist es, die die Diskussion initiiert und anleitet. Sie setzt den Rahmen für das Geschehen in der Klasse und verfolgt dabei pädagogisch-didaktische Ziele. Sie tritt auch als Expertin auf, die Fachwissen zu den behandelten Themen vermittelt: Beispielsweise wird sie in einer Diskussion zur Sterbehilfe darauf verweisen, dass aktive von passiver und indirekter Sterbehilfe sowie von Suizidbeihilfe zu unterscheiden ist. Darüber hinaus dürften viele Lehrpersonen ihren Schülern und Schülerinnen argumentativ überlegen sein, insbesondere deshalb, weil sie mit gängigen Argumentationsmustern vertraut sind. In der Frage der Sterbehilfe etwa werden sie fähig sein, Erwägungen zum Problem der Autonomie in differenzierter Weise zu artikulieren. Trotz epistemischer Gleichberechtigung bleiben schulische Diskussionen also asymmetrisch strukturierte pädagogische Veranstaltungen.
Gelingende Diskussionen haben zum einen einen Eigenwert, zum anderen dienen sie unterschiedlichen Zielen, die sich teils mit den Anforderungen eines deliberativen Demokratiemodells verbinden lassen. In gut geführten Diskussionen können demokratische Grundhaltungen wie Toleranz und Respekt eingeübt werden: Die Schüler und Schülerinnen lernen idealerweise, den Auffassungen anderer in engagierter, sachlicher und fairer Weise zu begegnen. Sie können dazu angeleitet werden, andere ernstzunehmen, ihre Aussagen aber auch kritisch zu sehen und ihnen argumentativ entgegenzutreten. In der Diskussion kontroverser Themen kann Verständigung zwischen Vertretern unterschiedlicher Auffassungen geschehen, ohne dass ein Konsens angestrebt werden muss. Wichtiger ist zu erörtern, in welchen Fragen Konsens besteht und in welchen nicht.
Neben demokratischen Grundhaltungen können in diesem Kontext auch argumentative und begriffliche Kompetenzen entwickelt werden: Dies mag in lebendigen Diskussionen eine Stück weit wie von selbst geschehen, kann und soll aber durch didaktische Interventionen der Lehrperson unterstützt werden. So kann die Lehrperson die Diskutierenden dazu anregen, die verwendeten Begriffe zu klären oder ihre Argumenationsmuster genauer unter die Lupe zu nehmen.
Soll die Lehrperson sich mit ihrer eigenen Meinung einbringen? Es scheint klar, dass Meinungsäußerungen der Lehrperson Diskussionen beeinträchtigen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Lehrperson ihre Auffassung in kompetenter Weise rechtfertigt und sie so für die Lernenden schwer angreifbar macht. In vielen Fällen wird davon abzuraten sein, die eigene Meinung bereits in einem frühen Stadium der Diskussion zu äußern, um den Lernenden genügend Raum zur Entwicklung ihrer eigenen Argumente und Kontroversen zu lassen.
Die Mitteilung der eigenen Meinung kann aber in manchen Kontexten einer Förderung der Diskussion dienlich sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Lernenden untereinander »alle der gleichen Meinung sind« oder sich dies zumindest einbilden. Sind alle »für Suizidbeihilfe« oder »für aktive Sterbehilfe«, so kann es sinnvoll sein, wenn die Lehrperson ihre davon abweichende Auffassung ins Spiel bringt. In solchen Situationen ist es selbstverständlich auch möglich, die Gegenpositon als Advocatus Diaboli einzubringen oder mit den Lernenden einen Text mit einer alternativen Auffassung zu lesen. Äußert die Lehrperson ihre eigene Meinung, kann dies zur Folge haben, dass Schüler und Schülerinnen sich in besonderer Weise herausgefordert fühlen, ihre eigene Position zu rechtfertigen und zu entwickeln. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Meinung der Lehrperson sich nicht vollständig in dem den Lernenden bekannten Muster (»für oder gegen Sterbehilfe«) bewegt, sondern einen differenzierten Standpunkt ausdrückt. Das kann die Lernenden dazu bewegen, ihren Standpunkt ebenfalls zu präzisieren.
Diese Erwägungen machen deutlich, dass die Lehrperson in schulischen Diskussionen nie als einfache Teilnehmerin gelten kann, die den anderen auf Augenhöhe begegnet, sondern stets ihre pädagogisch-didaktischen Ziele im Blick haben muss, wenn sie ihre Meinung äussert oder sich damit zurückhält.